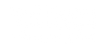Das Glück, zu leben
Ein freundlicher junger Mann wird immer eigenartiger. Niemand weiß, warum. Nicht einmal er selbst...

©
"Sag mal, hast du heute Morgen den Bewohner auf Zimmer 3 vergessen? Und die Dame auf der 16? Du weißt doch, dass die ganz pünktlich ihre Medikamente brauchen!" Benjamin Naumann erstarrt. Vor dem jungen Krankenpfleger steht eine Kollegin und streckt ihm zwei Schälchen mit Tabletten entgegen. "Lange kann ich das nicht mehr dulden!", sagt sie. Benjamin wird blass, stammelt eine Entschuldigung: "Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte ... vielleicht, weil ... ach, keine Ahnung." Die Kollegin wendet sich ab, Benjamin bleibt zurück, entsetzt über sich selbst: Schon der zweite Fehler in diesem Monat. Beim ersten Mal hätte er die Medikamente beinahe vertauscht. Benjamin Naumann arbeitet in einem Altenheim in Bremen – sein Traumberuf. Der 25-Jährige mag ältere Menschen, freut sich, wenn er helfen kann, unterhält sich gern mit ihnen. Doch in letzter Zeit strengt ihn der Papierkram an. Berichte schreiben, Dienstpläne abgleichen . Er kann sich immer schlechter konzentrieren. Was ist nur los mit ihm?
Zwei Monate später verbringt Benjamin einen freien Tag zu Hause, als überraschend sein Chef vor der Tür steht. Benjamin bittet ihn herein. "Herr Naumann, Sie haben sich sehr verändert. Sie vernachlässigen Patienten und vergessen einfachste Dinge. Bevor etwas Schlimmes passiert, müssen wir Ihnen kündigen", eröffnet ihm dieser. Benjamin merkt, wie er weiche Knie bekommt – und gleichzeitig erleichtert ist. "Ich mache das doch nicht mit Absicht! Was wird denn jetzt aus mir?", denkt er im ersten Moment. Und dann: "Aber vielleicht ist es besser so. Dann muss ich nicht mehr so viel Verantwortung tragen." Noch am selben Tag holt er seine Sachen aus dem Spind im Altenheim. Dann fährt er heim, schaltet das Fernsehgerät ein. Bloß nicht nachdenken!
Ein paar Wochen später klingelt es wieder. Diesmal stehen Benjamins Eltern vor der Tür. "Wie sieht es denn hier aus!", entfährt es Johanna Naumann. Die zierliche Frau mit den rötlichen Haaren starrt ihren Sohn an. Benjamin war immer der zuverlässigste und ordentlichste ihrer drei Jungs. Aber jetzt erkennt sie ihren Ältesten nicht wieder. Seine Wohnung ist verdreckt, sein Haar ungekämmt, der Blick leer, der Jogginganzug voller Flecken. "Na und? Wen interessiert das", antwortet er. Stundenlang sitzt er jetzt vor dem Rechner, versinkt in der virtuellen Welt der Computerspiele. Seine Eltern sind beunruhigt. "Du hast dich verändert: Gestern waren wir verabredet, und du bist nicht gekommen. Stattdessen müssen wir deine Rechnungen bezahlen, weil du dich um nichts mehr kümmerst. Du isolierst dich immer mehr! Was ist los mit dir?", versucht der Vater seinen Sohn wachzurütteln. Benjamin starrt weiter auf den Computer. Er weiß, die beiden haben recht. Aber er hat keine Antwort auf ihre Frage, kann nichts gegen seine Lethargie tun. Er hat Angst, will sie aber nicht zugeben. Er schickt die Eltern weg: "Lasst mich in Ruhe."
Fast zwei Jahre lang geht das so, Benjamin ist das normale Leben längst entglitten. Er hat keinen Job, keine Freunde. Niemand versteht ihn, mit keinem kann er reden. Er hat keine Schmerzen, also kann er auch nicht krank sein. "Ich will nicht mehr leben", sagt Benjamin. Erst nur zu sich, dann auch zu den Eltern. Am Telefon, fast beiläufig, in einem Nebensatz. Bei Johanna und Peter Naumann schrillen die Alarmglocken. Als Krankenschwester ist Johanna gut vernetzt, bekommt für ihren Sohn rasch einen Termin beim Psychiater. Der zieht Kollegen in einer Fachklinik zu Rat. Doch auch die wissen nicht weiter: soziale Phobie, Depressionen oder ADS, also eine Aufmerksamkeitsdefizitstörung – so die vage Diagnose. Eines Tages kommen die Schmerzen. Der Schmerz wird unerträglich. Benjamin ruft seine Mutter an. "Mein Kopf tut so weh, als würde er platzen. Das geht schon seit Tagen so", klagt er. Johanna Naumann fährt sofort zu ihrem Sohn, packt ihn ins Auto, steuert einen Neurologen an. Der veranlasst auf der Stelle eine Magnetresonanztomografie. Bei einer MRT wird der Kopf scheibchenweise durchleuchtet. "Eigentlich wäre ich ja froh, wenn der Arzt etwas finden würde", denkt sich Benjamin. "Dann wüsste ich endlich, was los ist." Nach der Untersuchung wartet seine Mutter mit ihm auf das Ergebnis. Nervös geht Johanna auf und ab. Sie spürt, dass etwas Entscheidendes passieren wird.
Der Arzt ruft die beiden ins Sprechzimmer. Er hat etwas auf der MRT-Aufnahme gefunden: einen Gehirntumor, etwa so groß wie ein Tennisball, wahrscheinlich seit sechs Jahren in Benjamins Kopf. Dessen erstes Gefühl ist Erleichterung: "Ich bin nicht verrückt, es ist etwas Organisches. Gott sei Dank!" Er versucht ein Lächeln. Was jetzt folgt, ist doch sicher Operation, Entfernung des Tumors, Genesung – er wird wieder der Alte. Auch seine Mutter ist fast froh, nimmt ihren Jungen fest in die Arme. Endlich gibt es wieder Hoffnung! Am 6. Januar 2009 ist es soweit – Benjamin wird operiert. Acht Stunden lang kämpfen die Ärzte um sein Leben. Es gelingt ihnen, den Tumor, der die komplette linke Gehirnhälfte ausfüllt, fast restlos zu entfernen.
Am späten Nachmittag dürfen Naumanns auf die Intensivstation. Sie wollen bei Benjamin sein, wenn er aufwacht. Blass, den Schädel kahl rasiert, an Maschinen und Schläuche angeschlossen, den Kopf bandagiert, liegt er da. Nur kurz wacht er auf, begreift nicht, wer da an seinem Bett steht. Die Mutter fasst die Hand ihres Mannes. "Er erkennt uns nicht." Einen Tag später klingelt bei den Naumanns das Telefon: "Es hat Komplikationen gegeben. Wir mussten eine Notoperation machen. Bitte kommen Sie." Die Familie hastet ins Krankenhaus. Die Worte des Arztes sind niederschmetternd: "Weil sich Hirn- und Wundwasser angestaut haben und nicht ablaufen können, mussten wir ein Loch in Benjamins Schädel bohren. Leider kam es dabei zu einer schweren Infektion. Wir haben kaum noch Hoffnung." Doch Benjamin überlebt. Nach drei Wochen kommt er langsam wieder zu sich, darf die Intensivstation verlassen. Das Erste, was er bewusst spürt, ist Hunger. Heißhunger auf Süßigkeiten. Aber er kann es niemandem sagen. Nicht weil da niemand wäre, sondern weil er nicht sprechen kann. Benjamin will aufschreiben, dass er Schokolade möchte, aber auch das geht nicht: Seine rechte Körperhälfte ist gefühllos, er kann sie nicht bewegen. Panik steigt in ihm auf – und er kann sie nicht äußern. Benjamin hat bei der Operation nicht nur seine Sprache verloren, sondern auch einen Teil seines Gedächtnisses. Nur ganz allmählich kommt er zu Kräften, langsam kehren Erinnerungen zurück. Nach ein paar Wochen geht er in die Reha. Er muss alles neu lernen: aufstehen, laufen, sich anziehen, auf die Toilette gehen. Unablässig übt Benjamin. Manchmal voller Eifer, manchmal voller Verzweiflung. Seine Mutter übt mit ihm. Oder sie sitzt an seinem Bett, fragt: "Wer bin ich? Wie heiße ich? Was ist das?" Dabei hält sie ihm mal ein Buch, mal einen Kamm, mal einen Kugelschreiber vor die Nase. Nur schwer kommen ihrem Ältesten die Begriffe über die Lippen.
Sechs Monate lang tastet Benjamin sich mithilfe von Ergotherapie, Logopädie und Krankengymnastik zurück ins Leben. Der Tumor ist zwar weg, aber die Bestrahlungen, die nach der Operation nötig waren, haben viel gesundes Gewebe zerstört. "Du wirst nie mehr der Alte sein", sagt ihm sein Vater ehrlich. "Du wirst nie mehr richtig sehen können, oft Dinge vergessen – und du wirst eine Art von epileptischen Anfällen haben." Benjamin lässt sich nicht entmutigen. Er will leben. Anfang 2010 passiert, was Benjamin selbst als Wunder bezeichnet. Durch seine Behinderung fühlt der Schüchterne sich noch mehr eingeschränkt. An Liebe, daran, eine Beziehung zu haben, traut er sich gar nicht zu denken. Ihm würde es schon reichen, Menschen kennenzulernen, die ebenfalls ein Handicap haben und mit denen er sich austauschen könnte.
Er stellt sein Profil ins Internet. Es meldet sich Nicole, die von Geburt an eine spastische Lähmung in den Beinen hat. Sie wohnt wie Benjamin in Bremen. Die beiden treffen sich einmal, zweimal – und verlieben sich ineinander. "Benjamin ist einfach wunderbar", sagt Nicole strahlend. Bereits ein Jahr später zieht das junge Paar zusammen. "Wir führen ein ganz normales Leben. Wie gehen aus, machen einen Tanzkurs, treffen uns mit Freunden", erzählt Nicole. Sie arbeitet als Sekretärin in einer Bremer Schule, verdient das Geld, Benjamin macht den Haushalt: kochen, backen, im Garten arbeiten. Ein- bis zweimal wöchentlich geht er zur Krankengymnastik. Alle drei Monate muss der heute 32-Jährige eine MRT machen lassen, um sicherzustellen, dass sich kein neues bösartiges Gewebe bildet. Aber er denkt positiv. "Nicki und meine Eltern haben bestimmt mehr Angst als ich", meint er.
Pläne haben die beiden auch. Dieses Jahr wollen sie heiraten und dann Kinder haben. "Das ist mein größter Wunsch", sagt Benjamin. Er und Nicole gehen ganz locker an die Zukunft heran. Sie sind sich sicher, dass sie ihren Kindern gute Eltern sein werden. "Wir können so viel Liebe geben, gerade weil wir schon so viel durchmachen mussten", sagt Benjamin und fasst sich kurz an den Kopf. Er trägt Glatze, seine Haare rasiert er sich selbst. "Die soll ruhig jeder sehen", erklärt er und zeigt auf die 15 Zentimeter lange Narbe. "Mich erinnert sie täglich an alles, was hinter mir liegt. Aber sie erinnert mich auch an mein Glück." Er hält kurz inne. "Irgendwie bin ich dem Schicksal dankbar."