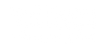Flucht aus Afghanistan
Nach der Flucht aus der Hölle Kabuls in Afghanistan finden der Autor und seine Familie in den Niederlanden eine neue Heimat

©
Diesen Artikel gibt es auch als Audio-Datei 
Selbst die Sonne schien das Chaos nicht mit ansehen zu können und ging schneller unter als sonst. Die Nachricht vom Fall Kabuls im Juli 2021 verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Flammen des Hasses loderten in den Blicken der Taliban-Kämpfer und trafen eine schockierte, verängstigte Gesellschaft. Jede Frage, jeder Widerspruch galt als offene Feindseligkeit gegen den Allmächtigen. Die Flucht aus der verwüsteten Stadt hatte begonnen.
Ich nahm meine Söhne an die Hand und verließ zusammen mit meiner Ex-Frau das Haus. Wir flohen vor den Taliban, um unsere beiden Jungen in Sicherheit zu bringen. Sie fragten: „Wohin gehen wir?“ Ich wusste es nicht. Durch verwinkelte Gassen erreichten wir das Tor des Flughafens. In der Dunkelheit warteten verzweifelte Männer, Frauen und Kinder darauf, in ein Flugzeug zu gelangen – Menschen mit blassen Gesichtern, die von einem Augenblick zum anderen alles verloren hatten. Auf der anderen Seite der Mauer waren die Flugzeuge bereit zum Abflug. Westliche Soldaten versuchten zu helfen. Frauen und Kinder zuerst. Die Menschen standen dicht gedrängt. Mein jüngster Sohn, Shahriar, vergrub sein Gesicht in meinen Armen und bekam kaum Luft. Zum ersten Mal in meinem Leben überkam mich die Angst vor dem Tod. Im letzten Moment kamen wir an die Reihe und ein amerikanischer Soldat hob Shahriar ins Flugzeug. Wir traten aus der Dunkelheit ins Licht.
Fort aus Afghanistan
Als das Militärflugzeug abhob, tauchten vor meinem inneren Auge Bilder aus der Vergangenheit auf: meine Eltern, die nie lesen und schreiben gelernt hatten. Meine Kindheit in unserem abgelegenen Dorf am Fuß des Pamir-Gebirges, an den Ufern des Flusses Amudarja, unweit der Grenze zu Tadschikistan. Meine Hände, die immer nach Gras und Pferdemähnen rochen. Ich ging damals aus unserem Dorf fort und reiste 800 Kilometer nach Kabul, um dort eine weiterführende Schule zu besuchen und anschließend zu studieren. „Wie alt bist du?“, fragte mich ein Beamter, als ich einen Ausweis beantragte. "Ich weiß es nicht", sagte ich kläglich. Bei uns im Dorf gab es keine Kalender. Der Mann musterte mein Gesicht mit dem dünnen Schnurrbart und schrieb irgendein Datum auf. Ich war jetzt offiziell 15 Jahre alt. Meine Liebe für Literatur und Philosophie hatte mich vom Islam entfremdet – und damit auch von meiner Familie. Die Religion vergiftete unsere Beziehung. Meine Mutter sagte stets: „Behalte deine törichte Meinung für dich und erspare uns die Schande!“ Ihr Konflikt zwischen mütterlicher Liebe und Ablehnung meiner Überzeugungen quälte mich. Doch als mich im Flugzeug der Trennungsschmerz überkam, erschienen alle diese Streitigkeiten bedeutungslos. Wir landeten in Karatschi, Pakistan, wo die jetzt Heimatlosen in Gruppen aufgeteilt und in verschiedene NATO-Länder geflogen wurden. Das Schicksal brachte uns in die Niederlande.
Groningen
Ich ging still durch die fremden, sauberen Straßen von Groningen im Norden der Niederlande, nicht weit von der zentralen Aufnahmestelle für Asylsuchende in Ter Apel. Einige Passanten grüßten mich mit einem Lächeln, andere schauten mich neugierig an. Ich fragte mich: „Was denken sie, wenn sie mich sehen? Wirke ich bedrohlich? Oder bin ich für sie jemand, der nach Glück und Reichtum strebt? Oder ein Mann, der dem Tod entronnen ist?“ Auch mein Sohn hatte Fragen: „Papa, warum sind die Menschen hier so groß und ihre Hunde so klein?“
Bert
Meine ersten Eindrücke von den Niederlanden wurden in der Regionalzeitung Dagblad van het Noorden veröffentlicht. Ich bekam einen Brief von einem Leser: Bert war Biologe und Profisegler – und der größte Mann, den ich je in meinem Leben umarmt habe. Er war von meiner Geschichte fasziniert und wollte mehr über mich erfahren. Also lud er mich auf einen Kaffee zu sich nach Hause ein. Als sich zwischen uns Vertrauen entwickelte, begannen wir, lange Gespräche zu führen und gemeinsam durch den nördlichen Teil der Niederlande zu reisen.
Zum ersten Mal in meinem Leben bestieg ich ein Boot. Vor Sonnenuntergang setzte Bert den Anker im spiegel-glatten Meer. Bei einsetzender Ebbe zog sich das Wasser langsam zurück, und das Boot kam wie ein flügelloser Vogel auf dem Meeresboden zu liegen. Nach einigem Zögern fragte ich Bert, ob das Wasser zurückkehren würde. Er lächelte und antwortete: „Mach dir keine Sorgen. Das Meer ist wie unser Leben, immer in Bewegung.“
Wir liefen über den nassen Sand und suchten nach Muscheln. Ein Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit durchströmte meinen Körper. Ich wünschte, diese Nacht würde nie enden.
Während ich auf den fernen Horizont starrte, schlugen Erinnerungen wie tobende Wellen über mir zusammen. In Berts Stimme lag eine bezaubernde Harmonie. Der alte Mann und das Meer. Bert ist sehr praktisch veranlagt. Er zeigt mir lieber das Land, anstatt mir alles theoretisch zu erklären. Wenn ich Näheres über einen Ort wissen möchte, verweist er mich nicht auf Bücher, sondern reist mit mir dorthin, damit ich direkt mit der Kultur und Geschichte in Berührung komme. Wir fuhren nach Winsum. Die Häuser in diesem Dorf waren wie aus einem Gemälde. Mit seinen gemütlichen Gassen, den gewundenen Kanälen und bunten Blumen wirkte es wie das Paradies auf Erden.
Esfandiar
Eines Abends bekam ich einen Anruf vom Flüchtlingszentrum in Amsterdam, in dem meine Ex-Frau und meine Söhne untergebracht waren: Mein ältester Sohn Esfandiar war aus dem vierten Stock gefallen. Ich war wie gelähmt. Jeroen, ein Mitarbeiter des Zentrums in Groningen, wo ich mich aufhielt, griff nach meiner Hand. Ein Taxi brachte mich in die Amsterdamer Universitätsklinik. Dort traf ich meine Ex-Frau, die wie ein Schmetterling zitterte. Sie sagte: „Es war nicht meine Schuld, der Sturm hatte das Fenster beschädigt, Esfandiar wird gerade operiert.“
Esfandiars Sturz brachte wieder Leid in unser Leben. Eine große Frau, eine Kinderchirurgin, informierte uns, dass das Herz und der Kopf meines Sohnes alles gut überstanden hätten, doch Arme und Beine seien mehrfach gebrochen. Esfandiar wurde aus dem Operationssaal geschoben. Er war bewusstlos und hatte Blutspuren im Gesicht. Mit Mühe öffnete er die Augen und wisperte kläglich: „Papa!“ Es schien, als ob das Wort „Papa“ schon seit Stunden auf seiner Zunge gewartet hätte. Als ich seine schwache Stimme hörte, fiel ich in Ohnmacht. Die Ärztinnen und Ärzte kümmerten sich um uns wie liebende Mütter und verantwortungsvolle Väter. Ich sprach zu meinem verletzten Sohn in wirren Worten: „Mein Vogel, du bist hoch geflogen und du hast auf wundersame Weise überlebt, in den Händen von Ärzten, die nicht nach deinem Namen fragen, die deine Herkunft nicht kennen, nicht auf die Farbe deiner Augen oder deines Haares achten, sondern dein Herz, deine gebrochenen Arme küssen. Mein Vogel, werde wieder gesund!“
Am Abend sah mich die Krankenschwester freundlich an, und in ihrem Lächeln lag tiefes Verständnis und Mitgefühl. „Ich mache den Nachtdienst und bin für Sie da“, versicherte sie. Ich telefonierte mit meiner Mutter. Sie sagte mir, dass sie für Esfandiar bete und ihm die Gnade Gottes sicher sei. Ich erzählte ihr von der Freundlichkeit der Ärzte, und sie fragte: „Wie kann es sein, dass Menschen, die keine Muslime sind, so hilfsbereit sind?“ Das Gespräch brach ab. Esfandiar wurde wieder gesund.
Zohal
In jenen Tagen lernte ich Zohal zufällig in der Kantine des Flüchtlingsheims kennen. Sie war Psychologin und Menschenrechtsaktivistin. Wir brauchten beide jemanden zum Reden. An einem ruhigen Nachmittag gingen wir im Wald spazieren. Sie erzählte, dass sie nicht vor den Taliban, sondern vor ihren Brüdern fliehen musste, für die eine ungläubige Frau ein Schandfleck war und kein Recht auf Leben hatte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. „Es stimmt, dass man nicht an Einsamkeit stirbt. Aber was, wenn Demütigung, Exil und der Hass der Familie hinzukommen?“, fragte sie. Der Himmel verdunkelte sich, und wir lehnten uns an einen Baum. Plötzlich lächelte sie: „Weißt du, immer wenn ich in diesem Wald bin, rechne ich damit, dass jeden Moment ein riesiger Holländer aus dem Boden wächst, wie ein Baum. Ich habe das Gefühl, dass die Bäume und die Menschen hier miteinander wetteifern, wer größer ist.“ Wir lachten.
Wir fühlten uns erleichtert und machten uns auf den Weg zurück zum Flüchtlingszentrum. Sie griff nach meiner Hand und schmiegte sich leicht an mich. Um uns herum war alles still. Enten flogen über das Wasser. Sie sagte: „Jetzt fühle ich mich völlig frei, wie ein Lichtwesen.“ Ich spürte ihren Atem.
Sie blieb stehen und flüsterte mir leise ins Ohr: „Danke!“ Ich drehte den Kopf zu ihr und sah, dass ihre Lippen ganz nah waren. Wir küssten uns. Dann hüpfte sie wie ein Vöglein davon und verschwand. Wir sahen uns nie wieder. Aber ich hatte gelernt, dass ein gutes Gespräch auf wundersame Weise heilen kann.
Niederlande
Ich bin immer wieder von der Direktheit der niederländischen Kultur überrascht. Nie hätte ich gedacht, dass menschliche Beziehungen so eindeutig sein können und die Sprache so frei von leerer Höflichkeit. Bei meinem ersten Besuch bei Bert bot mir seine Frau einen Kaffee an. Wie es die afghanischen Umgangsformen vorschreiben, die oft mit übertriebener Bescheidenheit verbunden sind, lehnte ich freundlich ab – in der Erwartung, dass sie ihr Angebot wiederholen würde. Aber sie fragte mich kein zweites Mal, und ich bekam keinen Kaffee.
Ich erinnerte mich, wie meine Mutter unseren Gästen mehrere Minuten lang immer wieder Tee anbot, und diese zunächst ablehnten. Es war ein Ritual: Der Gast lehnte ab, und meine Mutter drängte ihn immer wieder, manchmal berief sie sich dabei auch auf Gott und den Propheten. Aber wenn der Gast dann zu lange blieb, schimpften wir später über ihn. Dieses Prozedere soll ein Zeichen tiefen Respekts sein, aber jeder weiß, dass es nicht ehrlich gemeint ist.
Die kulturellen Unterschiede werden auch offensichtlich, wenn jemand stirbt. Auf der Beerdigung von Berts Mutter gab es Kaffee und Kuchen, und es wurde sogar gelacht. Die Feier lief so angenehm ab, dass sie eher an eine Hochzeit erinnerte. In Afghanistan ist eine Beerdigung ein schreckliches Drama. Die Frauen zerreißen ihre Kleider, schlagen sich auf den Kopf und ins Gesicht. Ich frage mich,
ob Niederländer ihre Trauer einfach nicht zeigen.
Eine Frau im Sprachklub sagte einmal lachend: „Wir Niederländer halten unsere Gefühle zurück wie ein Damm das Wasser. Vielleicht haben wir Angst, dass unser Inneres überflutet wird, wenn wir unsere Gefühle zulassen, so wie bei einem Dammbruch.“
Gelegentlich bin ich zwischen zwei Kulturen hin- und hergerissen: Als ich – unter dem Einfluss der niederländischen Lebensweise – meine Schwester einmal bat, mich nicht unangemeldet zu besuchen, lachte sie und sagte: „Wenn du jemals, Gott bewahre, in dein Heimatland zurückkehrst, musst du dich zuerst wieder in deine ursprüngliche Kultur integrieren!“
Ein Neuanfang beginnt dort, wo alle Wege versperrt scheinen – und man das Licht dennoch nicht aus den Augen verliert. Ich werde nie vergessen, wie wir voller Angst aus unserer Heimat flohen. Vielleicht erzählen wir diese Geschichten eines Tages unseren Enkeln. Dann werden sie wissen, dass wir durchgehalten, dass wir überlebt haben. Und dass es auf unserem Weg Menschen gab, die uns in diesen schweren Zeiten Hoffnung und Schutz gewährt haben.