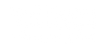Waschen, schneiden, Leben retten
Eine Stammkundin erscheint nicht zum Termin. Ihr Friseur ahnt: Da stimmt etwas nicht!

©
Dass etwas nicht stimmt, ahnt Frank Tavernier schon, als er um viertel nach acht aus dem Fenster seines Friseursalons am Bayreuther Marktplatz blickt. Die Bank auf der anderen Straßenseite ist leer. Eigentlich sitzt dort freitags um diese Zeit, eine Dreiviertelstunde vor ihrem Termin um neun Uhr, stets eine Stammkundin – jede Woche, seit 36 Jahren. Normalerweise betritt die 88-Jährige dann um halb neun den Salon, um einen Kaffee zu trinken, in den Klatschzeitschriften zu blättern und zu tun, was man beim Friseur eben so tut: plaudern.
„Bei den älteren Leuten geht es beim Friseurtermin ja gar nicht so sehr um die Haare“, sagt Tavernier, „sondern um den sozialen Kontakt.“ Frank Tavernier ist 51 Jahre alt. Mit 15 hat er hier im Salon, den damals sein Vater führte, seine Lehre begonnen. Die Kundin, die jetzt, um zwanzig vor neun, immer noch nicht da ist, kennt er seit seinem ersten Arbeitstag.
„Hat sie abgesagt?“, fragt er seine Angestellte. „Nein“, antwortet diese. Sie bereitet gerade den Stammplatz der Kundin vor. Die zierliche Frau ist in den letzten Jahren zwar etwas vergesslich geworden, aber zu ihrem Termin kam sie kein einziges Mal zu spät: Freitag, neun Uhr – ein Fixpunkt im Leben der 88-Jährigen.
„Vielleicht muss sie noch ein paar Besorgungen machen“, denkt Tavernier. Schließlich ist es der Tag vor Heiligabend. Andererseits: Die alte Dame hat nur noch einen Verwandten, einen Neffen. Wie viele Geschenke wird sie da am letzten Tag vor dem Fest noch brauchen?
Um kurz vor neun blickt Tavernier noch einmal hinaus, die Sitzbank ist weiterhin verwaist. Er wählt die Telefonnummer der Kundin. Sie nimmt nicht ab. Um kurz nach neun versucht er es noch mal. Nichts. Nun schickt der Friseurmeister seine Angestellte los. Ein guter Friseur weiß alles über seine Kunden, auch ihre Adressen.
Kurz darauf ruft die Angestellte im Salon an: Die Wohnung wirke, als sei niemand zu Hause. Auch auf mehrmaliges Klingeln hat ihr niemand die Tür geöffnet.
Etwas muss passiert sein, denkt Tavernier. Einer seiner Angestellten ist bei der Freiwilligen Feuerwehr. Dessen gute Kontakte ermöglichen es Tavernier, in den beiden Kliniken der Stadt nachzufragen. Aber auch dort ist die Kundin nicht. Das Gefühl, das Tavernier seit dem frühen Morgen hat, wird immer mehr zur Gewissheit: Da stimmt etwas nicht. Er ruft die städtische Polizeiwache an.
Der Beamte am Telefon scheint ihn anfangs nicht ganz ernst zu nehmen. Als Tavernier aber erklärt, dass die Dame seit 36 Jahren jede Woche kommt und noch nie einen Termin verpasst hat, ohne abzusagen, verspricht der Beamte, eine Streife bei ihr vorbeizuschicken.
Kurz darauf klingelt das Telefon im Friseursalon. Es ist ein Polizist, der vor der Tür der Frau steht. „Ist sie mittlerweile im Salon?“, fragt er.
„Nein.“
„Okay, dann gehen wir jetzt rein.“
Die nächste Stunde hören Tavernier und seine Mitarbeiter erst einmal nichts mehr. Kunden kommen und gehen in dem kleinen Salon, den Taverniers Vater 1965 eröffnet hat. Als Frank Tavernier hier anfing, hatten sie vorn im Herrensalon zwei Schneideplätze und acht Wartesitze. War ein Herr fertig frisiert, setzte er sich nicht selten wieder in den Wartebereich. „Habt ihr schon gehört …?“, hieß es dann.
Die jungen Leute heute, sagt Tavernier, hätten immer weniger Zeit und schauten, statt sich zu unterhalten, meistens aufs Smartphone. Aber es gibt sie noch, die alte Generation, für die ein Friseurbesuch mehr ist als Haareschneiden. Für sie ist Frank Tavernier ein geduldiger Zuhörer, ein Vertrauter, ein Freund. Und an diesem Tag sogar Lebensretter.
Eine Stunde nachdem die Feuerwehr die Tür der Kundin aufgebrochen hat, ruft deren Neffe an und berichtet: Seine Tante lag auf dem Wohnzimmerboden, mit einer blutverkrusteten Platzwunde an der Stirn. In der Nacht war sie gestolpert und mit dem Kopf auf der Tischkante aufgeschlagen. Als die Beamten sie fanden, war sie ansprechbar, aber zu schwach, um aufzustehen.
Noch am Vorabend, erzählt der Neffe, sei er bei ihr gewesen und hatte mit ihr verabredet, sie am zweiten Weihnachtstag abzuholen, um mit ihr bei seiner Familie zu feiern. Das heißt: Hätte ihr aufmerksamer Friseur keinen Verdacht geschöpft, hätte sie drei Tage und vier Nächte lang hilflos am Boden gelegen.
Zwei Tage nach Weihnachten kommt der Neffe mit zwei Flaschen Sekt und Neuigkeiten in den Salon. In der Klinik hat sich glücklicherweise gezeigt, dass alle Knochen seiner Tante noch heil sind, die Wunde am Kopf nur oberflächlich war. Die Ärzte hätten sie trotzdem gern noch ein bisschen im Krankenhaus behalten. Doch seine Tante bestand darauf, rechtzeitig entlassen zu werden. Sie hatte schließlich einen Termin: „Freitag, neun Uhr, Friseur.“