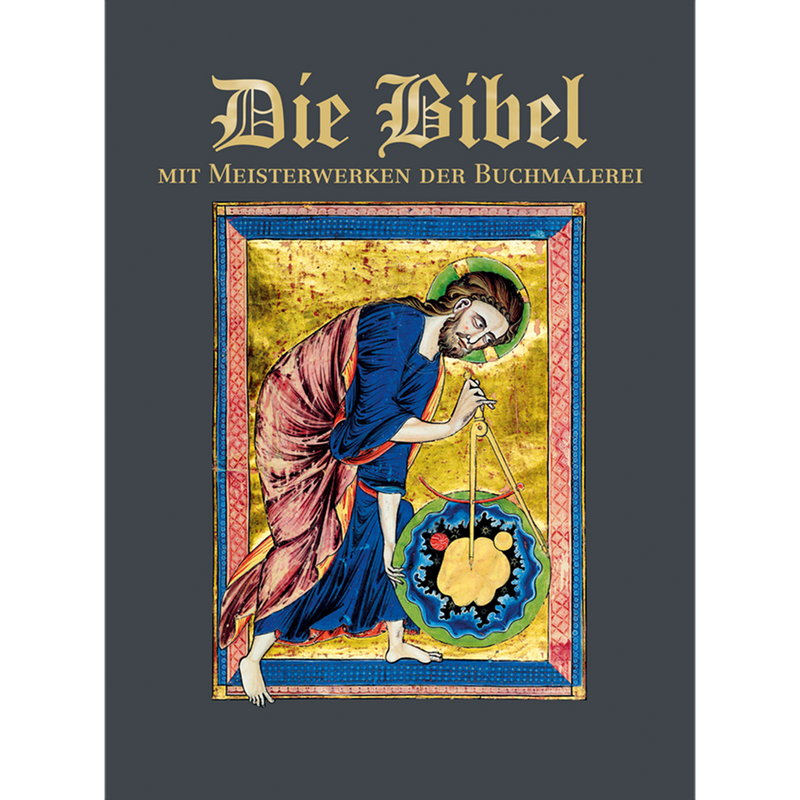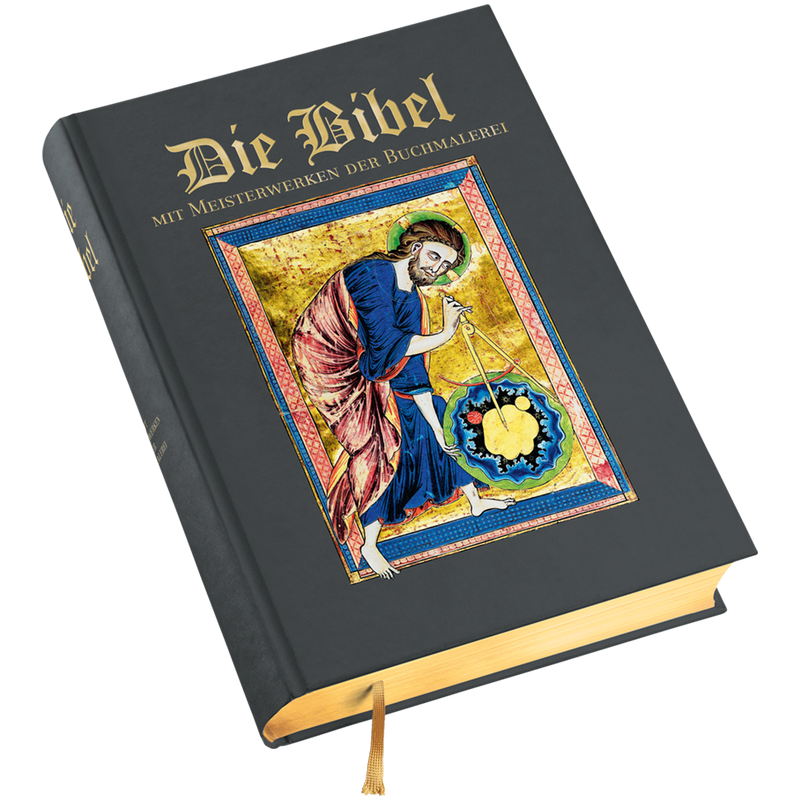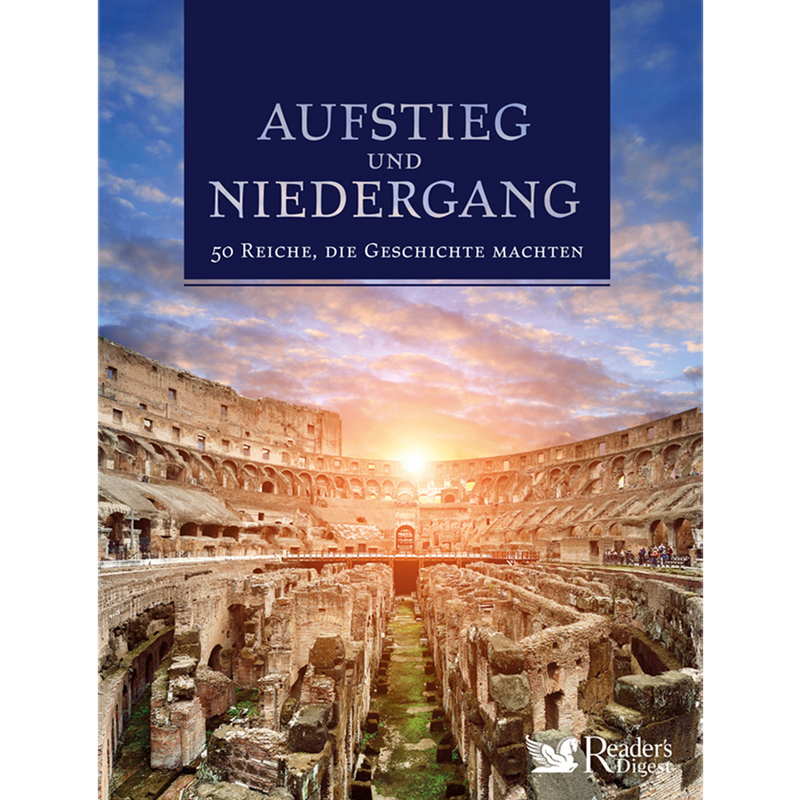Das Herz, geniale Hochleistungspumpe
Es hat die Größe einer geballten Männerfaust, doch das Herz ist eine Hochleistungspumpe – und zwar eine geniale...

©
Schon im 15./16. Jh. kam Leonardo da Vinci zu der Erkenntnis, dass das Herz ein muskulärer Hohlkörper ist. 1628 erhob dann der englische Arzt William Harvey in einer revolutionären Entdeckung das Herz zum Zentrum eines geschlossenen Blutkreislaufs. Seit dieser Zeit hat sich das Wissen über die Funktion des Herzens als Blutpumpe immer weiter verfeinert. Keine Frage, ohne den regelmäßigen Herzschlag könnten Sauerstoff und viele Nährstoffe im Körper nicht richtig verteilt werden.
Der Herzmuskel eines Erwachsenen hat etwa die Größe einer geballten Männerfaust – rund 8 cm breit, 6 cm tief, 13 cm lang – und wiegt lediglich 300 g. Zu zwei Dritteln liegt das Herz auf der linken Seite der Brustmittellinie, vollständig von den Lungenflügeln eingefasst – und auf dem Zwerchfell ruhend. Obwohl man sich das Herz gewöhnlich als Einzelorgan vorstellt, schwebt es keineswegs isoliert im Brustkorb. Der Herzbeutel verankert den „Supermuskel“ an Brustbein und Zwerchfell. Gleichzeitig dient der Herzbeutel als schützende und raumgebende Hülle. Das Herz selbst besteht aus drei Schichten. Die dicke Muskelschicht in der Mitte, der sprichwörtliche Herzmuskel, ist von außen und innen tapeziert – von außen mit einem feinen bindegewebigen Häutchen, von innen mit einer ebenso dünnen, die inneren Hohlräume auskleidenden glatten Zellschicht. Diese unterteilt das Herz in vier Bereiche, nämlich in zwei kleinere Vorhöfe, die als Empfangsbereiche für die Blutaufnahme dienen, und in die dahinterliegenden großen Pumpwerke der beiden Herzkammern.
Das Blut nimmt dabei immer denselben Weg: Die rechte Herzhälfte transportiert es zur Lunge, von wo es mit frischem Sauerstoff angereichert zurückkehrt; die linke verteilt es mitsamt dem geladenen Sauerstoff und den Nährstoffen bis in die letzten Winkel des Körpers. Das „verbrauchte“ Blut kehrt dann zur rechten Herzhälfte zurück und wird wieder auf die Reise geschickt, in einem ständigen Kreislauf der Erneuerung.
Der Herzmuskel ist kräftig gebaut
Die Wand der linken Kammer ist bis zu 1,5 cm mächtig, denn sie muss den enormen Druck erzeugen, der das Blut bis in unsere Finger- und Zehenspitzen sendet. Die rechte Kammer, die nur die Lungen beschickt, kommt mit viel weniger Druck aus und hat deshalb nur eine 0,5 cm dicke Muskelmasse.
Der eigentliche Herzschlag entsteht, indem sich die starken Kammerwände abrupt zusammenziehen. Da die Muskelschichten der Wände spiralig angeordnet sind, wringen sie bei jeder Kontraktion das Blut förmlich aus dem Herzen hinaus – in einer ersten Welle aus dem Vorhof in die Kammer, in einer zweiten aus der Kammer in die großen ableitenden Adern. Vier starke strapazierfähige Ventile, die Herzklappen, öffnen und schließen sich nach Bedarf und sorgen dafür, dass das Blut immer in der richtigen Richtung weiterfließt.
Die „Erregungsbildungszentren“ sorgen für den rhythmischen Herzschlag. Der Start erfolgt im sogenannten Sinusknoten, der im rechten Vorhof liegt. Dieser arbeitet zwar selbstständig, allerdings nicht ohne Kontrolle. Seine übergeordnete Instanz ist das Gehirn, das, über Nervenfasern aus dem Herzregulationszentrum steuernd, in den natürlichen Rhythmus eingreifen kann und dadurch beispielsweise das Herz schneller schlagen lässt. Jede vom Sinusknoten erzeugte Muskelkontraktion, auch Systole genannt, wird von einer Muskelerschlaffung, der sogenannten Diastole, abgelöst. Die Abfolge dieser Muskelbewegungen bildet den Herzzyklus: Auf die Kontraktion der Vorhöfe entfallen 0,08, auf die der großen Kammern 0,32 Sekunden.
Verdiente Ruhepausen
Obwohl schon wenige Minuten Aussetzen den Tod bedeuten würden, kann sich das Herz regenerieren – und zwar nach jedem einzelnen Schlag, selbst mitten in der härtesten Arbeit. Aus diesem fein abgestimmten Gleichgewicht von Anstrengung und Pause schöpft es die Kraft für seine lebenslange Dauerleistung. Da ein so aktiver Muskel einen besonders hohen Sauerstoffbedarf hat, zweigt das Herz 5–10 % jedes Blutschlages in seine eigenen Kranzschlagadern ab, die es kronenartig umziehen. Diese spalten sich in immer feinere Gefäße auf, bis jede Herzmuskelfaser von einer Kapillare erreicht wird. Entsprechende venöse Gefäße transportieren das verbrauchte Blut wieder zurück. Kürzester Kreislauf des Körpers wird dieses System genannt, das jeden Tag rund 520 l Blut durchschleust. Obwohl das Organ Herz also nichts anderes tut, als ständig Blut zu verteilen, benötigt es dennoch auch seine eigene Blutversorgung.