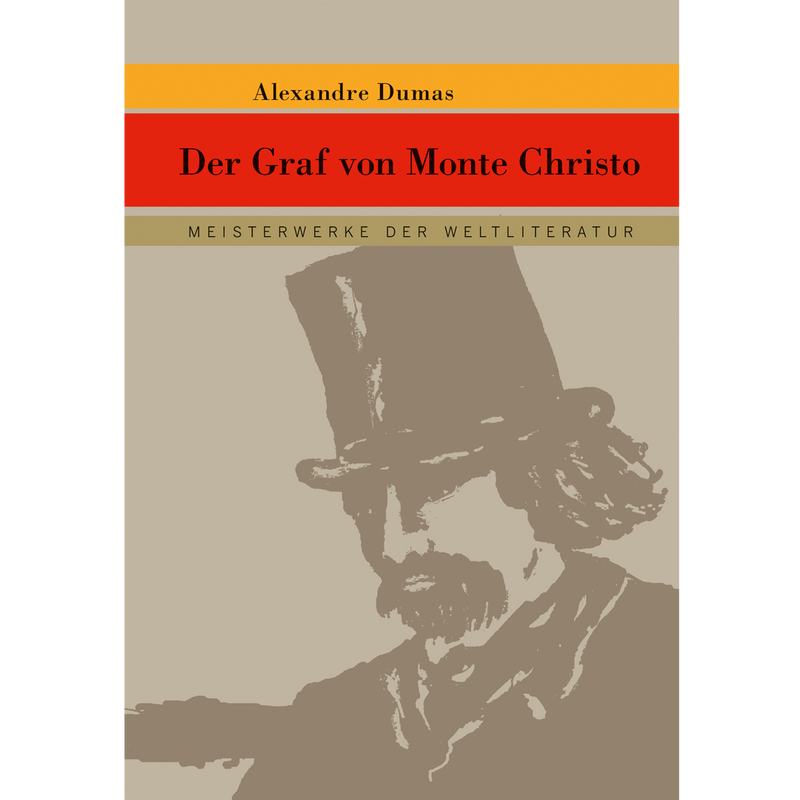Alexandre Dumas
Es gibt Dinge, die wären heutzutage einfach unvorstellbar … Da wird einem bekannten Schriftsteller von einem Ministerium vorgeschlagen, man werde ihm eine größere Auslandsreise finanzieren, falls er bereit sei, darüber eine umfangreichere Reportage zu schreiben. Der berühmte Mann sagt zu, verlangt jedoch, dass man ihm ein Kriegsschiff zur Verfügung stelle, damit er sicher reisen und auch entsprechend auftreten könne. Das Ministerium genehmigt ihm auch das. Der Künstler unternimmt die Reise, befiehlt »seinem« Schiff aber vor der Heimfahrt noch, einen Abstecher in ein feindliches Nachbarland zu machen. Er will dort zwei erfahrene Handwerker als Fremdarbeiter anwerben, die ihm zu Hause seine im Bau befindliche Villa kunstvoll ausgestalten sollen. Ein öffentlicher Skandal ist danach natürlich unvermeidlich. Das Parlament wirft der Regierung vor, sie habe nicht nur Steuergelder zum Fenster hinausgeworfen, sondern auch noch einem öffentlichen »Amüseur« ein Kriegsschiff zur Verfügung gestellt. Die Regierung muss jedoch von einer juristischen Verfolgung, ja selbst Kritik, des Autors absehen, denn die gesamte Öffentlichkeit stellt sich vor ihn und verzeiht ihm seine Allüren – schließlich hat er kurz zuvor mit einem seiner Romane monatelang das ganze Land in atemloser Spannung gehalten.
So geschehen im Frankreich der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die französische Regierung stellte dem Romanschriftsteller Alexandre Dumas für eine Reise nach Algier und längs der algerischen Küste im Jahre 1846 die Korvette »Le Véloce« mit vier Offizieren und 120 Mann Besatzung zur Verfügung. Dumas ließ, ohne dazu befugt zu sein, auch Tunis ansteuern, das zu dieser Zeit noch unabhängig war und von einem Frankreich feindlich gesinnten »Bei« beherrscht wurde. In Tunesien heuerte er zwei Handwerker an, die ihm in seinem Pariser Palais, das den Namen »Monte Christo« trug, ein sogenanntes »maurisches Zimmer« mit in Gips geschnittenen Arabesken und Koransprüchen verzieren sollten. Und der Roman, der das französische Publikum so in Aufregung versetzt und begeistert hatte, war »Der Graf von Monte Christo«, dem ein ungeheurer Erfolg beschieden gewesen war. Zur Verteidigung von Dumas sei jedoch gesagt, dass er mit den bald nach seiner Eskapade erscheinenden nordafrikanischen »Reiseeindrücken« ein amüsantes und unterhaltendes, wenn auch heute kaum noch bekanntes Werk schuf.
Ebenso fantastisch wie diese Episode sind die Umstände der Entstehung des Romans »Der Graf von Monte Christo«.
Im Jahre 1838 besuchte Alexandre Dumas, der ein Verehrer Napoleons war, die Mittelmeerinsel Elba, den ersten Verbannungsort des großen Korsen. Auf der Heimfahrt fiel ihm ein zuckerhutförmiger Berg auf, der aus dem Meer ragte. Er fragte seinen Bootsführer nach dem Namen der Erhebung. »Das ist die Insel Monte Christo«, bekam er als Antwort. Dumas, dem der Name sogleich gefiel, erwiderte: »Zur Erinnerung an meine Reise werde ich einem meiner künftigen Romane den Namen ›Monte Christo‹ geben.«
Nachdem der Titel einmal gefunden war, fehlte Dumas nur noch der Stoff. Er entdeckte ihn, wie die zu den meisten seiner anderen Werke, in alten Dokumenten. Ihm fiel ein, dass er bei früherer Lektüre in den »Mémoires tirés des Archives de la Police de Paris« von Jacques Peuchet im fünften Band ein Eselsohr gemacht hatte. Das markierte Kapitel trug den Titel »Der Diamant der Vergeltung«. Mit der ihm eigenen Arroganz fand Dumas die Geschichte »einfach idiotisch«, fügte jedoch hinzu: »Im Inneren der Auster war allerdings eine Perle verschlossen – die auf ihren Polierer wartete.«
Dumas machte sich an die Arbeit, die Perle zu polieren. Der Romancier übernahm von Peuchet den Handlungsfaden: Ein armer junger Mensch – bei Peuchet ein Schuster namens Picaud – wird als ausländischer Agent denunziert, verhaftet und sieben Jahre – bei Dumas sind es vierzehn – unschuldig eingekerkert. Im Gefängnis vermacht ihm ein aus politischen Gründen eingekerkerter reicher Italiener einen Schatz, den er nach seiner Entlassung hebt. Dumas lässt seinen Helden Edmond Dantès fliehen, und auch er findet einen versprochenen Schatz, Diamanten, Juwelen und Goldstücke. Beide nutzen die Reichtümer, um an jenen Rache zu nehmen, die sie in ihr Unglück gestürzt haben. Doch während Picaud seine Feinde eigenhändig grausam umbringt, wird Dantès scheinbar durch das Schicksal gerächt: Sein Widersacher Fernand nimmt sich das Leben, Danglars wird zugrunde gerichtet, Villefort verliert den Verstand. Als falscher »Graf von Monte Christo« hilft Dantès dabei nur etwas nach. Peuchet erzählt die Geschichte eines verabscheuungswürdigen Mörders, Dumas dagegen die eines edlen Charakters, sein Held gewinnt die Sympathie der Leser. Doch Dumas ist mit dieser »Veredelung« des vorgefundenen Romanstoffes noch keineswegs zufrieden.
Peuchets Geschichte spielt in den Jahren nach 1814. Dantès wird von 1815 bis 1829 auf Cháteau d’If eingekerkert, aber die eigentliche Handlung entwickelt sich erst nach 1838. Alexandre Dumas, der seinen Roman in der ersten Hälfte der Vierzigerjahre schreibt, greift nicht wie in den »Drei Musketieren« und anderen Romanen und Theaterstücken auf vergangene Epochen der Geschichte zurück, sondern er schreibt einen Gegenwartsroman. Fragen und Probleme der damaligen Zeit spiegeln sich unmittelbar im »Monte Christo« wider. Doch Dumas verlagert nicht nur die Handlung zeitlich, er verändert auch den gesamten Hintergrund, die Motivierung der Personen und die Art ihrer Konflikte. Für den Leser des in den Jahren 1844/45 erscheinenden Romans liegen die geschilderten Ereignisse kaum sechs Jahre zurück. Sie sind für ihn noch aktuell, befinden sich im Bereich persönlicher Erfahrungen, damit des Wahrscheinlichen. Das ist gewiss mit ein Grund für das außerordentliche Interesse damaliger Leserschichten und den Riesenerfolg des Buches.
In Frankreich hatte 1830 die Julirevolution der Restaurationsperiode ein Ende gesetzt. Ein neuer Aufschwung setzte danach ein. An die Stelle der Bourbonendynastie trat mit Louis-Philippe ein Vertreter der Linie der Orléans. Von einem seiner Minister, dem Bankier Lafitte, stammen die Worte: »Von nun an werden die Bankiers herrschen.« In der Tat stellte die Julirevolution von 1830 den Sieg der Finanzaristokratie über die feudalen Großgrundbesitzer dar. Bankiers, Börsenspekulanten, Eisenbahnkrösusse, Besitzer von Kohlen- und Eisenbergwerken nahmen die politische Macht in die Hände. Diese Kräfte des Bürgertums saßen auf dem Thron, sie diktierten den Kammern ihre Gesetze und vergaben die Staatsstellen, vom Ministerium bis zum Tabakbüro. Es war die Zeit des sogenannten »Bürgerkönigtums«. Das ist das große historische Fresko, vor dessen Hintergrund sich das Schicksal des Edmond Dantès abspielt.
In dieser bewegten Epoche war die Macht, die zuvor ausschließlich bei der Aristokratie gelegen hatte, in die Hände des Bürgertums übergegangen – und sie war käuflich geworden. Mit Geld ließen sich nicht nur Staatsstellungen, Ämter und Titel kaufen, sondern auch gesellschaftliches Ansehen und vor allem Macht. Das Streben, ja die Gier nach Reichtum kennzeichnete diese Gesellschaft, und alle Mittel waren gerechtfertigt. Soziale Beziehungen und familiäre Bande unterlagen diesem Prinzip ebenso wie die Moralgesetze: Geld bestimmte, was Recht war, deckte Ungerechtigkeiten und konnte jedes Verbrechen straffrei ausgehen lassen.
Edmond Dantès’ Denunzianten waren 1814, als der Roman beginnt, noch kleine Gauner wie Danglars oder korrupte untergeordnete Beamte wie Villefort. Doch fünfundzwanzig Jahre später sind sie durchweg auf unredliche Weise vermögend geworden, haben Ansehen und gesellschaftliche Stellung erobert. Die von ihnen begangenen Gaunereien und Verbrechen scheinen vergessen. Betrug, Habsucht und die Ungerechtigkeit haben scheinbar gesiegt.
Dantès Reichtum dagegen wurde auf redliche Weise erworben. In der Romanwelt Dumas’ dienen Gold und Reichtum nicht dazu, sich über die Moralgesetze zu stellen, Macht auszuüben und Gemeinheiten zu begehen, sondern um die Guten, Edlen zu belohnen und die Bösen zu bestrafen. Damit schenkt Dumas dem Leser den Traum vom Sieg der Gerechtigkeit, von einer »heilen Welt«, die im Gegensatz steht zu der ihn umgebenden Realität. Er überzeugt seine Leser, denn er schreibt keine trockene gesellschaftskritische Abhandlung, sondern einen Roman; der Schatz, Geld und Reichtum, ist kein Abstraktum, er drückt sich aus in einem eleganten Lebensstil, in Palästen, edlen Pferden, schönen Frauen und vor allem in Gold und Edelsteinen.
Doch Alexandre Dumas verleiht im »Monte Christo« zugleich einem weiteren charakteristischen Zug der damaligen Zeit Ausdruck. In dieser Periode zeichnete sich Frankreich bereits als kommende europäische Kolonialmacht ab. Die Industrie entwickelte sich rasant auf Kosten der ländlichen Hausindustrie und des Bauerntums. Sie machte sich auf die Suche nach Rohstoffen und Märkten. Überseeische Kolonien konnten Rohstoffe liefern und stellten Absatzmärkte dar. Mit der Eroberung und Besetzung Algeriens im Jahr 1830 hatte Frankreich diesem Bedürfnis erstmalig Rechnung getragen. Der Aufbau eines riesigen Kolonialreiches begann. In der Gesellschaft setzten ein Kult und eine Bewunderung alles Exotischen ein.
Dumas’ Fantasie bemächtigte sich geschickt dieses Phänomens. Für viele Menschen der damaligen Zeit verband sich die Vorstellung von Reichtum, von ungeheuren Schätzen, mit dem Bild des Orients, mit den arabischen Ländern am anderen Ufer des Mittelmeeres. Durch farbige Schilderungen verknüpft Dumas seinen Handlungsfaden geschickt mit diesen Vorstellungen. Briganten und Korsaren, die das Mittelmeer unsicher machen auf der Jagd nach aus dem Orient kommenden wertvollen Schiffsladungen, sind die Verbündeten des Grafen. Sein Pseudonym »Sindbad der Seefahrer« stammt aus der arabischen Märchenwelt, die Schatzhöhle Dantès' legt den Gedanken an »Aladin und die Wunderlampe« nahe, und die Sklavin Haydée lässt an die Scheherezade aus »Tausendundeiner Nacht« denken.
Doch künstlerische Fantasie ist mitunter ein zweischneidiges Schwert: Alexandre Dumas vermochte nie zwischen seinen Romanen und dem eigenen Leben eine scharfe Grenze zu ziehen. »Nachdem eine einzigartige Existenz ihm als Edmond Dantès grenzenlose Freuden verschafft hatte«, schreibt sein französischer Biograf André Maurois, »fühlte er sich versucht, diese Existenz in der wirklichen Welt zu leben.«
Dem stets in Schulden steckenden Dumas brachte der als Fortsetzungsroman erscheinende »Graf von Monte Christo« jährlich die stattliche Summe von rund zweihunderttausend Goldfrancs ein. War er nicht reich wie Edmond Dantès? Dass er versuchte, seinem Helden nachzuleben, davon zeugt die eingangs berichtete Episode seiner Reise nach Tunis. Diese Eskapade verzieh man ihm. Doch nicht immer bleibt die Verwirklichung von Fantasien ungestraft.
Im Bewusstsein, jährlich ein Vermögen einzunehmen, entschloss sich Dumas, das Schloss seiner Träume, das den Namen »Monte Christo« erhielt, in der Nähe von Paris zu bauen. Das »Schloss«, eher eine geräumige, in einem grotesken Stilgemisch erbaute Villa, die in einem weiten englischen Park in Saint-Germain liegt, existiert noch heute. Auch das von den tunesischen Handwerkern gestaltete »maurische Zimmer« mit seinen ziselierten Stuckarabesken und vergoldeten Koransprüchen ist noch vorhanden.
Zur Einzugsfeier lädt Dumas sechshundert Personen ein. Er gibt einen Empfang, der des »Grafen« würdig ist. Mit dessen Freizügigkeit und Edelmut beherbergt und bewirtet er in den folgenden Wochen und Monaten all seine Freunde, leistet sich jede Extravaganz und hält sich einen Harem: eine »Sultanin« wechselt die andere ab. Wer kommt, wird empfangen und kann bleiben – derweil Dumas in einem kärglich möblierten, nüchternen Zimmer sitzt und unermüdlich schreibt.
Die Wirklichkeit holt ihn jedoch ein, er ist nicht der Graf von Monte Christo. Die Einkünfte aus Romanen und Dramen vermögen die ständig steigende Flut seiner Schulden nicht einzudämmen. 1849 liegt auf Schloss »Monte Christo« eine Hypothek von 232.469 Goldfrancs. Er verliert zudem einen Prozess gegen seine frühere Frau und seine Tochter, muss die Mitgift seiner Frau zurückerstatten und Unterhaltsgeld für die Tochter zahlen. Schloss »Monte Christo« wird gepfändet und schließlich für kaum 30.000 Goldfrancs zwangsversteigert. Dumas ist wieder einmal bankrott.
Aber sowenig das Schicksal Edmond Dantès zerbrechen kann, sowenig kann es unseren Romancier vernichten. Der Staatsstreich des Louis Bonaparte 1851 gibt ihm Gelegenheit, vorübergehend zu verschwinden – er geht nach Belgien ins Exil. Als er sich 1853 mit seinen Gläubigern geeinigt hat, kehrt er nach Paris zurück. Doch der Preis ist hoch. Dumas hat ihnen fünfundvierzig Prozent der literarischen Eigentumsrechte an seinen derzeitigen und künftigen Werken abgetreten. Von nun an schuftet er fast ausschließlich für seine Schulden. Ungeachtet dessen führt er in Paris, wie sein Sohn Alexandre Dumas der Jüngere, der Verfasser der »Kameliendame«, schreibt, »sein unstetes, zügelloses und zersplittertes Leben fort, das er mit allen Sinnen genießt«.
Er gründet eine Abendzeitung, »Le Mousquetaire«, die bald wieder eingeht – und macht neue Schulden. 1860 reist er mit seiner »Jacht«, einem einfachen Segelboot, nach Italien und schließt sich dem Vorkämpfer der italienischen Unabhängigkeit Garibaldi an, der ihn zum Verwalter der Altertümer in Neapel ernennt. Gewissermaßen nebenbei verfasst er einen Band »Denkwürdigkeiten Garibaldis«, schreibt eine elfbändige »Geschichte der Bourbonen« und einen seiner besten Romane, »La San Felice«. Von Garibaldi enttäuscht, kehrt er nach Paris zurück, mietet eine bescheidene Wohnung und schafft unermüdlich weiter Werk um Werk. In den Jahren nach dem »Grafen von Monte Christo« entstehen solch große Romane wie »Die Königin Margot«, die Geschichte des »Mannes mit der Eisernen Maske«, »Der Vicomte von Bragelonne« und »Das Halsband der Königin«, daneben etliche Dramen und eine ganze Serie von Reisebeschreibungen. Den Sommer des Jahres 1868 verbringt er in der Bretagne und schreibt ein »Wörterbuch der Kochkunst«.
Doch der große Mann ist ausgebrannt. Halb gelähmt von einem Schlaganfall zieht er sich nach Puys in das Haus des Sohnes zurück. Auf einem Tisch neben seinem Bett liegen zwei Goldstücke. »Als ich in Paris ankam«, sagt er eines Tages zu seinem Sohn, »hatte ich zwei Goldstücke. Schau – ich habe sie noch.« Zwei Goldstücke, das ist alles, was ihm von seinem unermüdlich geschaffenen Werk geblieben ist. Am 5.� Dezember� 1870 stirbt er. Frankreich verliert den populärsten Schriftsteller seiner Zeit.
Wenn auch Dumas’ Behauptung, 1.200 Bände geschrieben zu haben, wie alles bei ihm, eine Übertreibung war, so zählte doch die bei Michel Levy 1862–89 herausgegebene Gesamtausgabe nicht weniger als 301 Bände. Ein Standardwerk, die »Geschichte der französischen Literatur« von Gustave Lanson, würdigte in der Auflage von 1903 Alexandre Dumas als unerschöpflichen Erzähler mit einer »ein wenig kindischen Erfindungsgabe« und fährt fort: »All dieses Geschreibe, vulgär in Gedanken und Form, ist längst veraltet.«
Dumas veraltet? Der Wissenschaftler Alberto Martino hat 1990 in seinem Buch »Die deutsche Leihbibliothek« nachgewiesen, dass Alexandre Dumas in der Zeit von 1889 bis 1914 im deutschsprachigen (!) Raum unter den Erfolgsautoren an vierter oder fünfter Stelle stand und über zehn Prozent aller entliehenen Bücher auf unseren Autor entfielen. Bis heute gehören seine großen Werke in allen öffentlichen Bibliotheken nach wie vor zu den am meisten gelesenen Büchern. Sie werden immer wieder neu aufgelegt. Seine Stoffe flimmern in unzähligen Fassungen über Kinoleinwände und Bildschirme.
Einige seiner Romane sind unsterblich geworden und finden eine sich von Generation zu Generation erneuernde Leser- und Zuschauerschar, die nur zu gern bereit ist, sich durch seine Erzählweise verzaubern zu lassen. Zu diesen zählt ohne Zweifel auch »Der Graf von Monte Christo«.
Bibliografische Hinweise
Reader's Digest Meisterwerke der Weltliteratur – die besten Romane aller Zeiten
Format: 14,5 x 21 cm; Hardcover; 640 Seiten
Titel der 1845/46 erschienenen französischen Originalausgabe: Le Comte de Monte Christo
© 2013 Reader's Digest Deutschland, Schweiz, Österreich – Verlag Das Beste GmbH Stuttgart, Appenzell, Wien
ISBN: 978-3-89915-971-4
Hersteller
Reader's Digest, Verlag Das Beste GmbH
Willy-Brandt-Str. 50
70173 Stuttgart
kundenkontkat@readersdigest.de