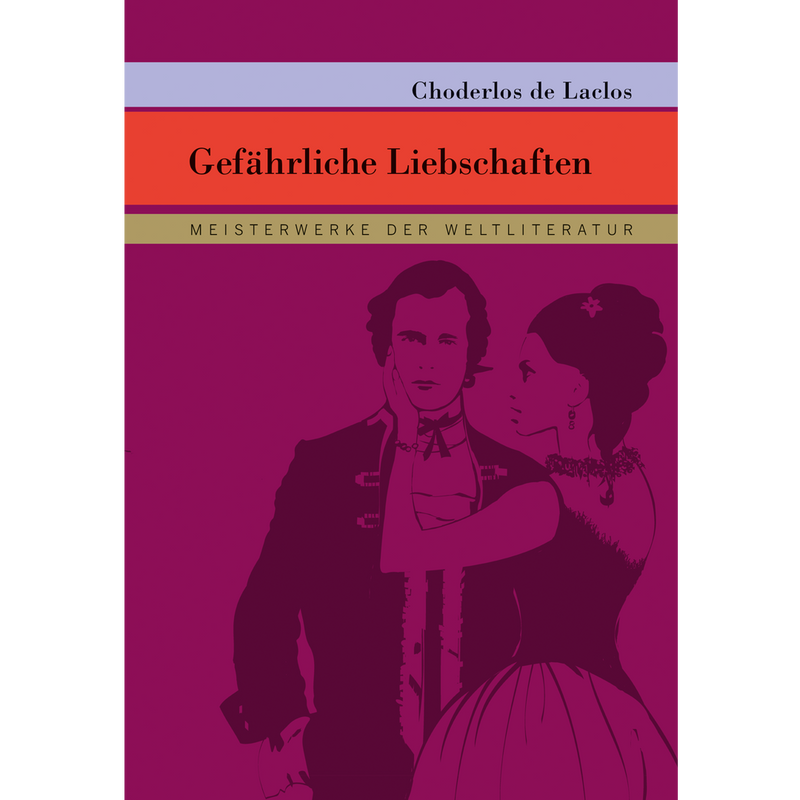Choderlos de Laclos
Die »Gefährlichen Liebschaften« sind das einzige bedeutende Werk des Autors Laclos – und es ist erstaunlich, dass es ihm innerhalb weniger Monate förmlich aus den Fingern geflossen ist. Laclos verstand sich in erster Linie nicht als Schriftsteller, sondern als Militär. Die meiste Zeit seines Lebens übte er diesen Beruf auch durchaus erfolgreich aus. Doch brachten es die Umstände mit sich, dass dem talentierten, ehrgeizigen Laclos die obere Offizierslaufbahn über Jahrzehnte verschlossen war. Letzteres ist unser Glück – denn er hätte vermutlich sonst niemals die Muße gefunden, die »Gefährlichen Liebschaften« zu verfassen.
Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos wurde am 18. Oktober 1741 im französischen Amiens geboren. Die bürgerliche Familie wurde erst 1750 in den Adelsstand erhoben. Sein Vater war Sekretär der Verwaltung der Picardie und von Artois, und es ist wohl seinem Einfluss zu verdanken, dass Laclos die Soldatenlaufbahn anvisierte. Er entschied sich für die Artillerie und wurde 1760 in die Königliche Schule der Artillerie von La Fère aufgenommen. Bereits ein Jahr später wurde er zum Leutnant ernannt und etwas später in La Rochelle stationiert. Doch der Pariser Vertrag von 1763 setzte dem Siebenjährigen Krieg ein Ende. Es folgte ein Frieden von fast 30 Jahren – was gut für die Bevölkerung war, aber schlecht für Laclos‘ Karriere. Er war eine Weile in Straßburg und Grenoble stationiert, wurde zum Hauptmann befördert – und langweilte sich. In guter aufklärerischer Tradition wendete er sich der Freimaurerei zu und wurde in eine Straßburger Loge, später in die Pariser Loge Henri IV. aufgenommen.
Im Jahr 1774 wurde ein königlicher Erlass ausgegeben, wonach die obersten Offiziersränge der Armee Adeligen vorbehalten sein sollten, die seit mindestens vier Generationen Adelstitel trugen – damit wurde seinen beruflichen Ambitionen endgültig ein Riegel vorgeschoben. Es wurde häufiger die Behauptung aufgestellt, dass dieser Umstand Laclos‘ Groll auf den französischen Geburtsadel Nahrung gegeben und er deswegen die »Gefährlichen Liebschaften« geschrieben habe. Doch dies bleibt reine Spekulation und wird der Vielschichtigkeit dieses Buches auch in keinster Weise gerecht. Fakt ist: Laclos schrieb schon zuvor literarische Texte. Einige seiner Gedichte wurden im Almanach der Musen publiziert. 1777 schrieb er die komische Oper »Ernestine«. Der ersten und einzigen Aufführung, die ein fulminanter Misserfolg war, wohnte immerhin Königin Marie Antoinette bei. Im selben Jahr hielt Laclos in der Freimaurer-Loge »Großer Orient« eine bemerkenswert frauenfreundliche Rede über die Aufnahme von Frauen in die Loge.
1777 wurde er mit der Gründung einer Artillerieschule in Valence betraut, zu deren Schülern später auch der junge Napoleon Bonaparte gehörte. 1778, stationiert in Besançon, verfasste er einige Texte, die seine Bewunderung für den Philosophen Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) zum Ausdruck brachten. Besonders dessen bekannter Briefroman »Julie oder Die neue Heloise« hatte es ihm angetan, ein Werk, das in weiten Teilen ein Plädoyer für die Liebesheirat ist und das Gefühl über die menschlichen Sitten stellt – ein Thema, das auch in den »Gefährlichen Liebschaften« immer mitschwingt. 1778 begann Laclos seine Arbeit an diesem Buch.
Ein Jahr darauf wurde er, inzwischen Offizier, nach Île-d’Aix versetzt, um bei der Instandsetzung der Befestigungsanlagen zu helfen. Gegen Ende des Jahres nahm er gleich sechs Monate Urlaub, die er in Paris mit Schreiben verbrachte. Der Briefroman wurde am 23. März 1782 in vier Bänden veröffentlicht und aus dem Stand zum Erfolg: Die erste Auflage, 1.000 Exemplare, war in nur einem Monat vergriffen. Es gab in nur zwei Jahren etliche Neuauflagen, selbst Marie Antoinette soll ein Exemplar des Buches besessen haben – unauffällig in edles Leder gebunden. Der Roman geriet sogleich zum Skandal und wurde im Laufe der Zeit etliche Male verboten – was seiner Popularität aber eher nützte. 21 Auflagen erreichte das Buch bereits zu Laclos‘ Lebzeiten.
Sofort nach Erscheinen des Romans wurde Laclos zu seiner Garnison zurückbeordert und 1783 nach La Rochelle versetzt – vermutlich eine Strafversetzung. Dies brachte ihm beruflich kein Glück – privat aber umso mehr. Hier lernte er nämlich Marie-Soulange Duperré kennen, seine spätere Ehefrau. Es heißt, sie habe ihm aufgrund seines schlechten Rufs zunächst den Eintritt in ihren Salon verwehrt. Drei Jahre später, am 3. Mai 1786, heiratete er sie, gegen den Widerstand ihrer Familie. Zu dem Zeitpunkt hatte sie bereits ein zweijähriges Kind von ihm, das er nachträglich als seines anerkannte. Es hat viele Versuche gegeben, Laclos eine Ähnlichkeit mit seiner Romanfigur Valmont anzudichten – und ihn auf diese Weise menschlich und moralisch zu diskreditieren. Und es mag sein, dass Laclos in seiner Jugend in dieser Hinsicht kein unbeschriebenes Blatt war, doch dies ist reine Spekulation. Sicher ist jedoch, dass die Ehe mit Marie-Soulange Duperré glücklich verlief. Das Paar bekam noch zwei weitere Kinder, und Laclos war bis zum Ende seines Lebens ein liebevoller und fürsorglicher Ehemann und Vater.
Tatsächlich ist Laclos‘ Verständnis der Ehe stark von Rousseau geprägt, und sein Frauenbild ist erstaunlich emanzipatorisch: In seiner 1783 verfassten Abhandlung »Über die Erziehung von Frauen« verurteilte er die Erziehung der Mädchen, die nur dazu diene, »sie an die Knechtschaft zu gewöhnen«. Ganz im Sinne Rousseaus plädierte er für eine naturnahe Erziehung. Auffällig ist, dass das Thema Frauenemanzipation auch in seinem Roman angesprochen wird, nämlich im 81. Brief der Marquise. Und es liegt nahe, deren Falschheit als direktes Resultat einer permanenten Unterdrückung zu interpretieren.
Als hätte Laclos sich beruflich mit den »Gefährlichen Liebschaften« nicht schon genug in eine Sackgasse manövriert, verfasste er im Jahr seiner Hochzeit einen offenen Brief, in dem er sich über die veralteten Festungen Vaubans lustig machte. Zwar hatte er als Spezialist der Artillerie recht – doch gegen Vauban, General unter Sonnenkönig Ludwig XIV., vorzugehen, stellte ein solches Sakrileg dar, dass der Kriegsminister persönlich ihm weitere Veröffentlichungen ohne Genehmigung verbot. 1788, am Vorabend der Französischen Revolution, erwirkte Laclos seine Entlassung aus der Armee. Er trat in den Dienst des Herzogs von Orleans und versuchte sich recht erfolgreich als persönlicher Sekretär in der Diplomatie und der Politik. Bei Ausbruch der Revolution ging er mit ihm ins englische Exil, kehrte aber bald nach Frankreich zurück. Der Revolutionär Danton verhalf ihm zu einer Stelle im Kriegsministerium, wo er für die Umstrukturierung der Armee zuständig war. Der Sieg der Revolutionsarmee bei Valmy (1792) wird auch ihm zugeschrieben. Dennoch geriet er in die Mühlen der Terrorherrschaft unter Robespierre: Er wurde als Anhänger des Hauses von Orleans verhaftet und entkam mit so viel Glück der Guillotine, dass ihm bis heute nachgesagt wird, er habe Robespierre bei der Formulierung seiner Reden geholfen – vermutlich nur eine weitere Verleumdung, mit der er zu kämpfen hatte. Mit dem Sturz Robespierres am 9. Thermidor – dem 27. Juli 1794 – kam er frei. Der Nachwelt erhalten blieben seine liebenswürdigen, schlichten Briefe an Frau und Kinder, die so wenig mit der ausgefeilten, boshaften Korrespondenz seines Romans gemein haben, dass man kaum glauben kann, dass sie derselben Feder entstammen.
1799 trat er in den Dienst Napoleons und wurde von ihm zum General befördert. Ein Jahr später nahm er an der Rheinkampagne teil und wurde 1803 zum Oberbefehlshaber der italienischen Reserve-Artillerie ernannt. Doch im selben Jahr erkrankte er in Italien an der Ruhr. Am 5. September 1803 erlag er dieser Krankheit in einem Kloster in Taranto. Beigesetzt wurde er in den Mauern einer Festung, die unter seiner Leitung errichtet worden war – das Forte de Laclos. Sein Grab ist heute unauffindbar, es wurde 1815 von den Bourbonen zerstört.
Laclos‘ einziger, großer Roman ist auch das Sittengemälde einer gelangweilten Adelsgesellschaft am Vorabend der Revolution. Der Autor wusste, wovon er schrieb, kannte er doch die Verhältnisse des Hochadels so gut, dass gemunkelt wurde, er hätte die Protagonisten nach leibhaftigen Vorbildern geschaffen. Dies ist vermutlich nicht der Fall. So lebensecht und nuanciert ihm die einzelnen Figuren auch gelungen sind: Er porträtierte eine Gesellschaftsschicht. Seit der konsequenten Einführung des Absolutismus unter Ludwig XIV. war der Hochadel politisch entmachtet. Verwaltung und Armee befanden sich in den Händen des Königs und seiner Verwalter. Und so reduzierte sich der Daseinszweck des Hochadels auf reines Hofleben und Repräsentation: Man hatte Geld wie Heu, das man in eine exquisite Garderobe und luxuriöse Bälle steckte, man hatte unendlich viel freie Zeit zur Verfügung, war gebildet und kultiviert – und langweilte sich prächtig. Und so kommt es, dass all der brillante Verstand der Protagonisten, ihr schillernder Ehrgeiz und jegliches Streben sich auf rein gesellschaftliche Ziele im Rahmen ihres eigenen illustren Zirkels richtet. Gefühl ist verpönt, geradezu peinlich, die Verfeinerung der Sinne hingegen wird angestrebt. Von wirklicher politischer Herrschaft ausgeschlossen, dient die zynische Manipulation anderer Menschen allein der eigenen Machtausübung, dem eigenen Lustgewinn. Während der Vicomte sich hierbei lediglich geschickt der gängigen Liebescodes bedienen muss, ist die Marquise gezwungen, ihren Ruf nach außen hin zu wahren – was ihr Handeln noch perfider, noch gefährlicher macht. Und so gerät die erotische Liebe der Protagonisten zum strategischen Schlachtplan, zum Krieg – etwas, womit sich der Offizier Laclos gut auskannte.
Es ist zudem frappierend, mit wie viel psychologischem Gespür Laclos diese Entwicklung beschreibt. Der eigenen Eitelkeit opfern die Hauptfiguren sehenden Auges alles: Der Vicomte zerstört die Beziehung zu der Frau – und die Frau gleich mit –, in die er sich offensichtlich ernsthaft verliebt hat, die Marquise verliert durch ihre Ränke ihren einzigen Vertrauten.
Der Briefroman war zu Laclos‘ Zeit eine beliebte Gattung. Doch kaum jemand beherrschte diese Kunstform so virtuos wie er: In 175 Briefen entfaltet er ein ganzes Universum, verleiht jedem Schreibenden eine eigene, unverwechselbare Stimme, spielt mit der Lesererwartung und schafft es sogar, durch Rückblicke unterschiedliche Zeithorizonte zu eröffnen. Besonders raffiniert aber wird die Romankonstruktion durch die fingierten Vorworte des Autors, der die Lesererwartung so gleich mehrfach ironisch bricht. Und so streiten sich bis heute die Geister, inwieweit Laclos die amoralische Libertinage seiner Protagonisten nicht doch insgeheim bewunderte und er die Vorworte – und die drakonische Bestrafung vor allem der Marquise – nur angefügt hatte, um der Zensur zu entgehen.
Letzteres gelang nur eingeschränkt – das Buch wurde mehrfach verboten. Obwohl mit keinem Wort Sexualität explizit beschrieben wird, galt der Roman jahrhundertelang als Schundliteratur. Erst die Verfilmungen im 20. Jh. sorgten für die breite Wiederentdeckung des Romans und die Anerkennung seines literarischen Werts. Laclos hätte dies sicher gefreut – und auch ein wenig gewundert. Denn, was noch erstaunlicher ist: Die Handlung, zugeschnitten auf die dekadente Adelsschicht des 18. Jh., funktioniert selbst in Filmadaptionen, die im New York der Jetztzeit oder in Korea spielen. Sein Buch wurde in viele Sprachen übersetzt und verkauft sich weltweit blendend. Laclos hat, vielleicht ohne dies im Geringsten anzustreben, ein zeitloses, in mancher Hinsicht fast allgemeingültiges Meisterwerk geschaffen.
Bibliografische Hinweise
Reader's Digest Meisterwerke der Weltliteratur – die besten Romane aller Zeiten
Format: 14,5 x 21 cm; Hardcover; 464 Seiten
Titel der 1782 erschienenen französischen Originalausgabe: Les Liaisons dangereuses. Aus dem Französischen von Heinrich Mann.
© der deutschen Übersetzung: Insel Verlag Frankfurt am Main und Leipzig 2003.
© 2020 by Reader’s Digest – Deutschland, Schweiz, Österreich – Verlag Das Beste GmbH, Stuttgart, Appenzell, Wien
ISBN: 978-3-95619-413-9
Hersteller
Reader's Digest, Verlag Das Beste GmbH
Willy-Brandt-Str. 50
70173 Stuttgart
kundenkontakt@readersdigest.de