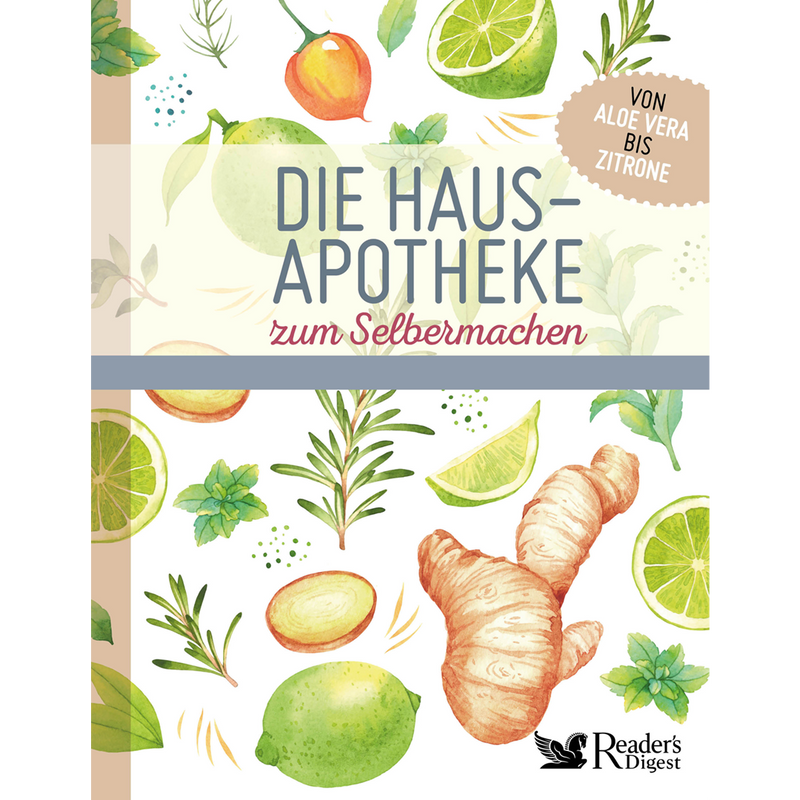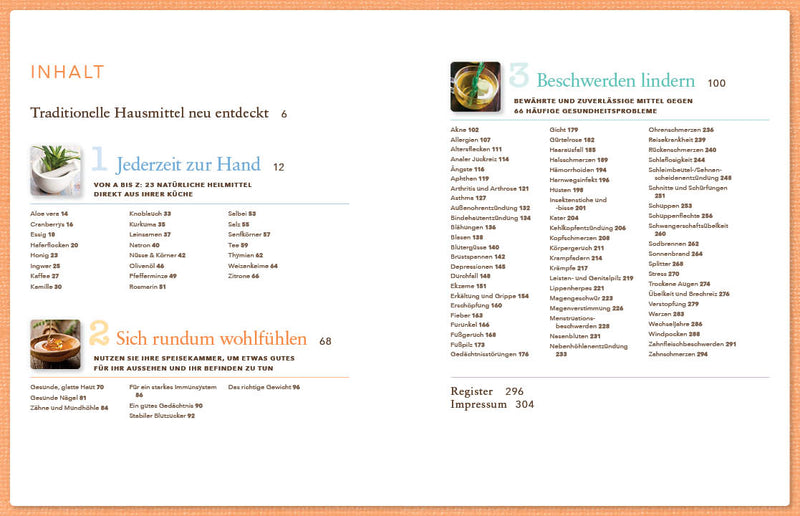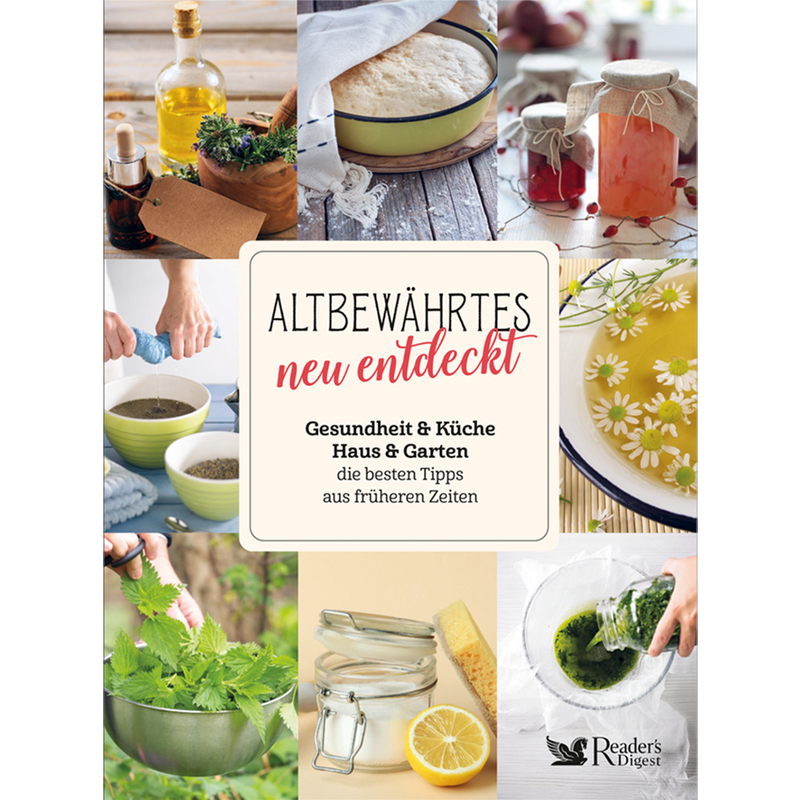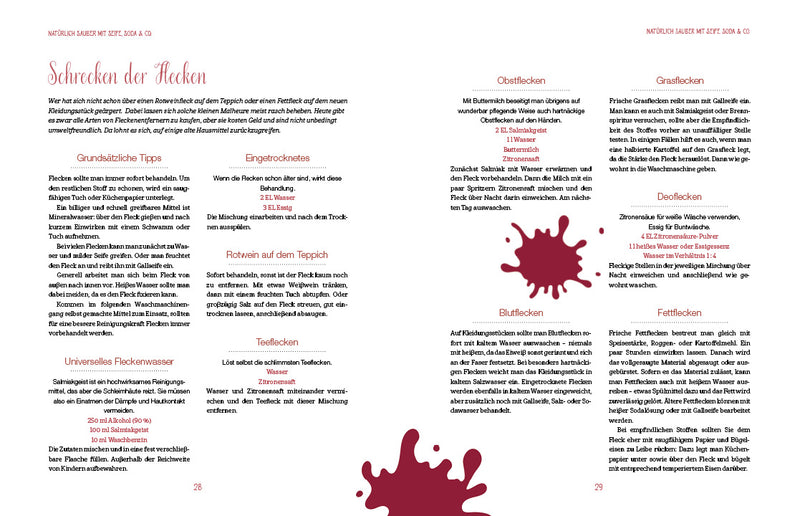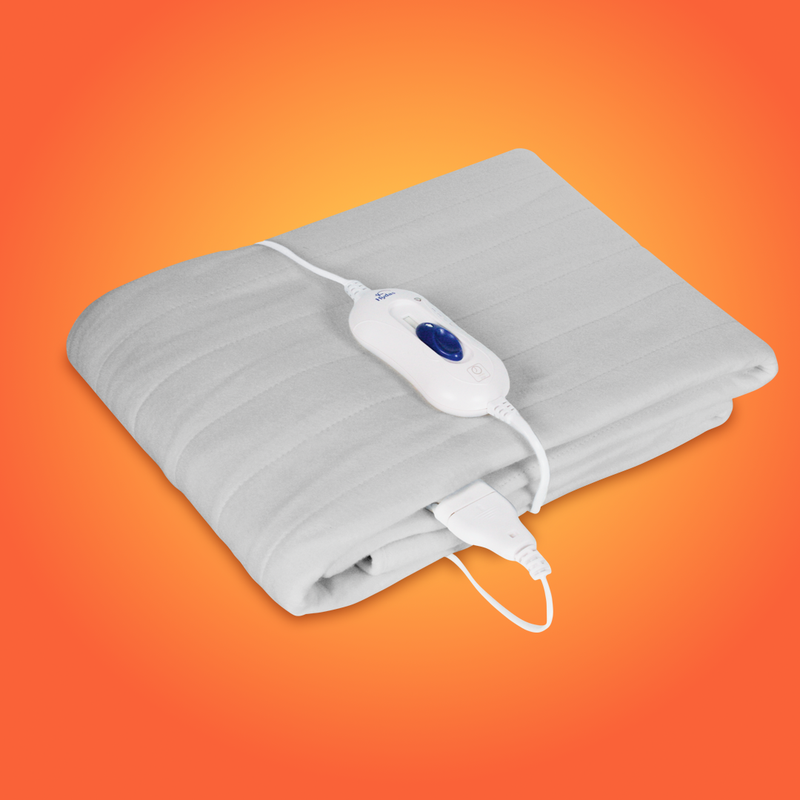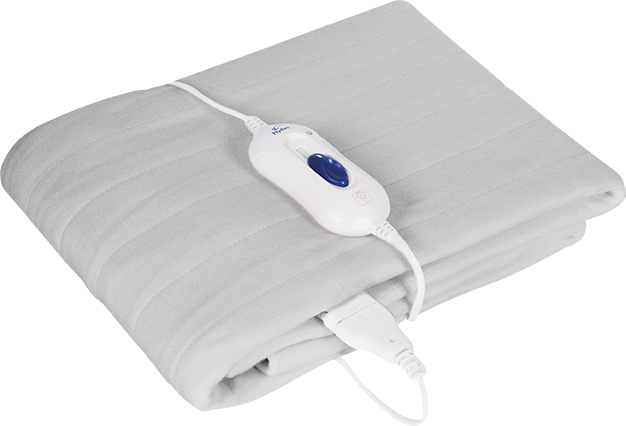Warum Angst keine schlechte Emotion ist
Angst und Sorgen haben zu Unrecht ein schlechtes Image in unserer Gesellschaft. Wir brauchen sie, um Probleme erkennen und lösen zu können. Und manchmal, um zu überleben.

©
Reisen macht mich nervös. An Bahnhöfen und Flughäfen treffe ich ein, lange bevor mein Zug oder Flugzeug startet. Ich vergewissere mich mehrmals, dass ich auch wirklich alle Reisedokumente dabeihabe. Bis ich an meinem Ziel angekommen bin, bleibt mein Kiefer angespannt und ich spüre ein Ziehen im Magen. Immer wieder machen sich Bekannte über meine Ängste lustig. Früher habe ich mich selbst über sie geärgert, hielt sie für irrational und mich für schwach. Das ist mittlerweile anders. Ich habe mich intensiv mit dem Thema befasst und sogar ein Buch darüber geschrieben. Ich habe gelernt, meinen ausgeprägten Hang zur Vorsicht zu akzeptieren.
Neulich brach ich zu einer längeren Fahrt auf, die größtenteils über die Autobahn führen sollte. Ich war noch auf der Landstraße, als mich die Angst überfiel, mir könnte das Benzin ausgehen. Das war Unsinn, denn ich hatte noch jede Menge Treibstoff. Als ich kurz vor der Autobahnauffahrt eine Tankstelle entdeckte, beschloss ich, dennoch zu tanken – nur für alle Fälle. Dabei stellte ich fest, dass der Luftdruck in einem Vorderreifen zu gering war. Hätte ich meine Sorge ums Benzin ignoriert, wäre der Reifen womöglich bei hohem Tempo geplatzt. Auf Nummer sicher zu gehen, hatte sich in diesem Fall als nützlich erwiesen.
Immer mehr Experten sind inzwischen der Meinung, dass Angst und ähnliche Gefühle im Leben eine wichtige Rolle spielen. Tracy Dennis-Tiwary, Professorin für Psychologie und Neurowissenschaften an der der City University in New York, USA, glaubt, dass negative Emotionen in unserer Kultur zu Unrecht verteufelt werden. Sie weiß, wie es ist, von Sorgen heimgesucht zu werden. „Es gab eine Zeit, da hatte ich sehr viel Stress im Job“, erzählt Dennis-Tiwary. Jeden Morgen um vier wachte sie auf, und das Kopfkino begann. „Es war wie eine wabernde Wolke der Angst, die mir den dringend benötigten Schlaf raubte“, erläutert die Professorin. Doch statt Unruhe und Nervosität zu unterdrücken, ließ Dennis-Tiwary sie zu. „Aus der Angst lassen sich auch Erkenntnisse gewinnen“, erklärt sie. „Mir machte sie klar, dass es bei meiner Arbeit irgendwo hakte. Indem ich meine Gedanken um die Angst kreisen ließ, kam ich dem Problem irgendwann auf die Spur. Ich notierte mir zwei, drei Dinge, die ich anpacken wollte.“ Am nächsten Morgen sei sie endlich wieder ruhig gewesen, sagt sie.
Auch Todd Kashdan, Professor für Psychologie an der George Mason University in Virginia, USA, hält nicht viel vom „Glücklichsein um jeden Preis“, wie er es nennt. „Es ist nicht so, dass mit uns etwas nicht stimmt, wenn wir nicht immerzu gut gelaunt und entspannt sind. Für manche Sorgen gibt es gute Gründe“, sagt er. „Haben Sie Höhenangst? Gut, denn dann laufen Sie kaum Gefahr, in die Tiefe zu stürzen, während Sie ein Selfie machen.“ Manche Experten hinterfragen, ob die Erkenntnis, dass Angst eine natürliche und sinnvolle Warnfunktion haben kann, nicht allzu oft ausgeblendet wird. So gab die Weltgesundheitsorganisation im März 2022 bekannt, dass Ängste und Depressionen weltweit um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zugenommen haben. Sie bezeichnete die Statistik als „dringenden Aufruf an alle Länder, ihr Angebot an psychologischen Diensten und Kriseninterventionsmaßnahmen auszubauen“.
Was, wenn Angst uns grundlos lähmt?
Angststörungen können für Betroffene ernsthafte Folgen haben und bedürfen der Behandlung. Doch was, wenn Millionen von Menschen sich zu Recht unsicher, gestresst und ängstlich fühlen? Nach Ansicht von Verhaltenspsychologen können wir situationsbedingt in Angstzustände geraten, die völlig berechtigt sind und nichts mit einer psychischen Erkrankung zu tun haben. Furcht hilft uns dabei, in Situationen mit ungewissem Ausgang zurechtzukommen, indem sie uns in „Alarmbereitschaft“ versetzt, sagt Dennis-Tiwary. „Aus evolutionärer Sicht versetzt Angst uns besser als jede andere Empfindung in die Lage, mit Unbekanntem umzugehen, weil sie uns zwingt, Mutmaßungen anzustellen beziehungsweise verschiedene Szenarien im Kopf durchzuspielen. Das ist ihr Sinn und Zweck.“ Ähnlich sieht dies Wendy Suzuki, Professorin für Neurobiologie an der New York University. Sie warnt davor, Angst als etwas zu sehen, das es um jeden Preis zu vermeiden, loszuwerden oder zu beschwichtigen gilt. „Denn dadurch lösen wir weder das Problem, vor dem sie uns warnt, noch nutzen wir ihre mobilisierende Kraft“, erklärt Suzuki. Wenn wir in einer Sackgasse stecken, kann Angst uns die Energie liefern, die nötig ist, um wieder herauszufinden.
Furcht lässt den Dopaminspiegel im Gehirn ansteigen; dadurch werden Sinne und Muskeln aktiviert. Das ist nützlich, wenn es gilt, einem Säbelzahntiger zu entkommen – oder einen Job aufzugeben, weil der Vorgesetzte uns mobbt. Wenn wir unsere Angst ignorieren, verlieren wir auch ihre Schutzfunktion. Das kann alles noch schlimmer machen. Nehmen Sie mich als Beispiel: Sämtliche Briefe vom Finanzamt verschwanden bei mir ungeöffnet in einer Schublade – selbst, wenn es sich lediglich um harmlose Schreiben handelte. Vorübergehend war daraus eine richtige Phobie geworden. Die klinische Psychologin Alice Boyes ist der Ansicht, die Unterdrückung negativer Empfindungen verstärke nur die eigene Unsicherheit, da man nicht lerne, das Problem zu lösen. „Mit der Zeit fühlt man sich immer weniger dazu in der Lage“, sagt sie.
Die Angst in den Griff bekommen, bevor sie lähmt
Wichtig ist, das Unbehagen in den Griff zu bekommen, bevor es einen überwältigt. Man kann es mit einem Garten vergleichen, der gejätet werden muss, damit das Unkraut darin nicht überhandnimmt. Meditation, Sport, eine gemeinnützige Tätigkeit, Aufenthalte in der Natur sind geeignete Strategien, erklärt Professorin Suzuki. Genau wie das sogenannte Reframing, das es möglich macht, Dinge in einem anderen Licht zu sehen und neu zu bewerten. Sie berichtet von einem Existenzgründer, dem die Angst den Schlaf raubte. Unablässig malte er sich aus, was bei seinem Geschäft, für das er viel riskiert hatte, alles schiefgehen könnte. Psychologen bezeichnen dies als „katastrophisieren“. Ein Therapeut empfahl dem Unternehmer die Reframing-Methode. Damit gelang es ihm, die Was-wäre-wenn-Grübelei zu einer Liste mit konkreten Lösungsansätzen umzuformen: „Wenn X passiert, dann mache ich Y.“
Auch Dennis-Tiwary hält Reframing für ein wirksames Mittel und führt als Beleg eine Harvard-Studie aus dem Jahr 2013 an. Dabei wurden Menschen, die sich selbst als schüchtern einschätzten, aufgefordert, eine Rede vor einer größeren Menschenmenge zu halten. Die Wissenschaftler behaupteten einigen Teilnehmern gegenüber, schweißnasse Hände, ein trockener Mund und zitternde Knie seien gute Zeichen. Sie signalisierten erhöhte Leistungsbereitschaft des Körpers. Die mit diesem „Faktenwissen“ ausgestatteten Redner hatten später niedrigere Blutdruck- und Herzfrequenzwerte. Anders ausgedrückt: Sie ließen sich durch das Lampenfieber nicht aus dem Konzept bringen, sondern fühlten sich durch seine Symptome sogar bestärkt. Dies zeigt, dass wir Ängste zu unserem Vorteil nutzen können.
Meditation, körperliche Betätigung und Natur helfen
Vor einigen Jahren war ich die letzte Rednerin auf einer Konferenz. Der klimatisierte Veranstaltungssaal war eiskalt. Ich saß zitternd und angespannt da und malte mir aus, dass ich in meinem Vortrag stecken bleiben würde. Je länger diese Schleife aus körperlicher Verkrampfung und mentaler Angst andauerte, desto schlimmer wurde es. Am Ende hatte ich so weiche Knie, dass ich befürchtete, von der Bühne zu fallen. Mit meinem heutigen Wissen würde ich im Korridor auf und ab gehen, um mich aufzuwärmen und meine Atmung zu beruhigen, bis ich an der Reihe wäre – wie ein Sportler vor dem Wettkampf. Ich wäre immer noch nervös, aber ich würde etwas Sinnvolles dagegen unternehmen. Wir können unsere Ängste in den Griff bekommen, indem wir uns „konstruktiv sorgen“, wie Suzuki es ausdrückt. Das geht zum Beispiel mit Meditation. Sie beruhigt nachgewiesenermaßen die Amygdala, jene paarig angelegte Struktur im Gehirn, die unter anderem für das Aussenden von Alarmsignalen und die Entstehung von Angst zuständig ist.
Hilfreich ist zudem körperliche Betätigung. In Versuchen mit Studenten stellte Suzuki fest, dass schon ein zehnminütiges Training hilft, Prüfungsangst zu reduzieren. Also: ab ins Fitnessstudio, auf die Tanzfläche oder einen Spaziergang. Ein Aufenthalt im Grünen bei natürlichem Licht kann bereits genügen, um unser psychisches Gleichgewicht wiederherzustellen. Das erstaunt nicht, schließlich waren wir im Laufe unserer Entwicklung jahrtausendelang eng mit der Natur verbunden. Auch Humor hilft. Beim Lachen schüttet unser Körper Hormone aus, die uns glücklich machen. Außerdem stärkt es soziale Bindungen. Kontakte zu anderen Menschen wiederum – zum Beispiel im Rahmen eines ehrenamtlichen oder gesellschaftlichen Engagements –, Berührungen und das In-Relation-Setzen unserer Angst mit der Situation anderer wirken in vielen Fällen beruhigend. All das sind bewährte Maßnahmen, die uns davor bewahren können, in eine Abwärtsspirale zu geraten. Wichtig ist, auf Ängste zu hören und sie für Veränderungen zu nutzen, sagt Dennis-Tiwary. So wie ich dies damals vor meiner Autobahnfahrt getan habe. Die Expertin vergleicht Angst mit einer Welle. Ihr Rat: „Lernen Sie, auf ihr zu surfen.“