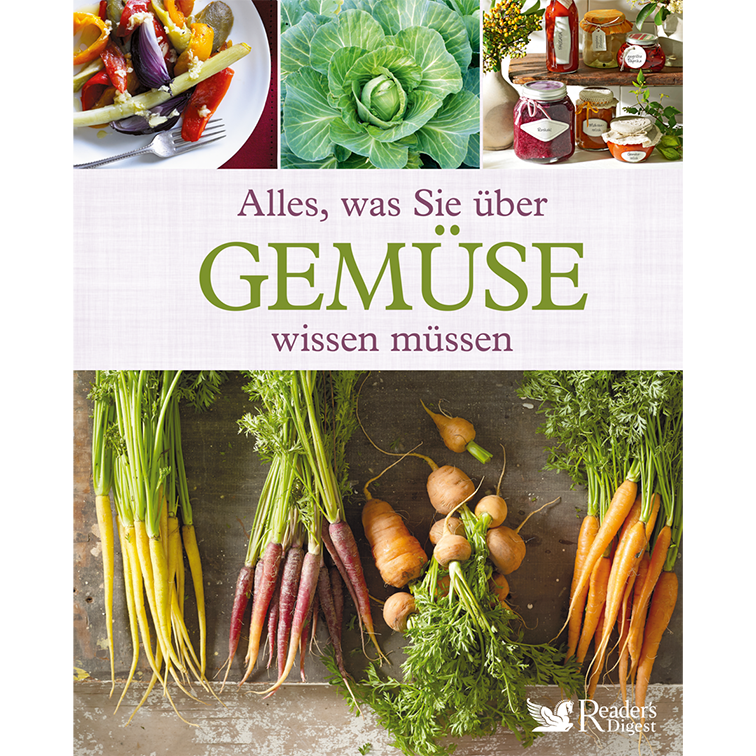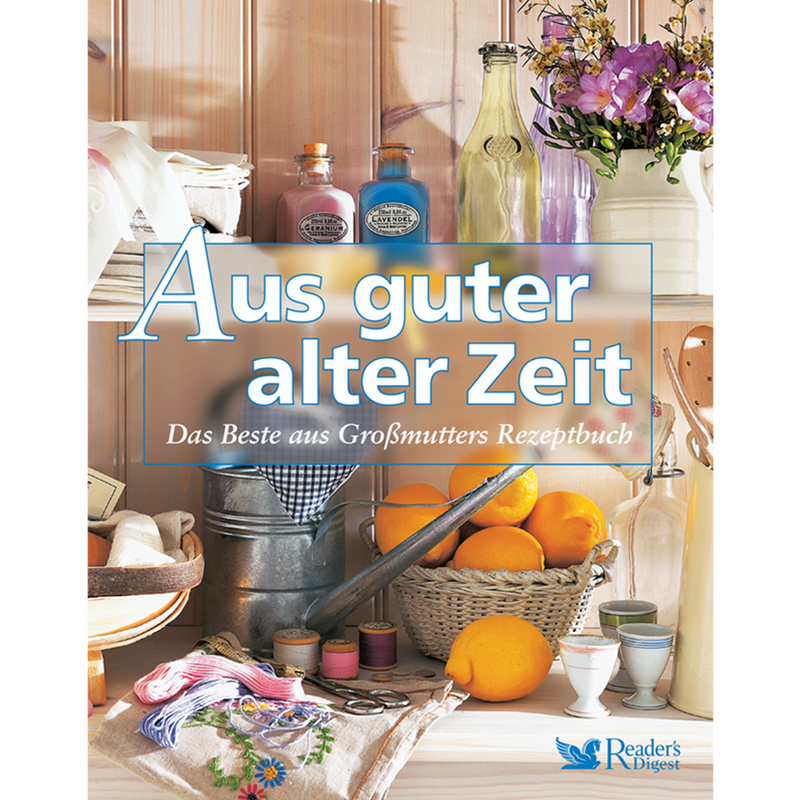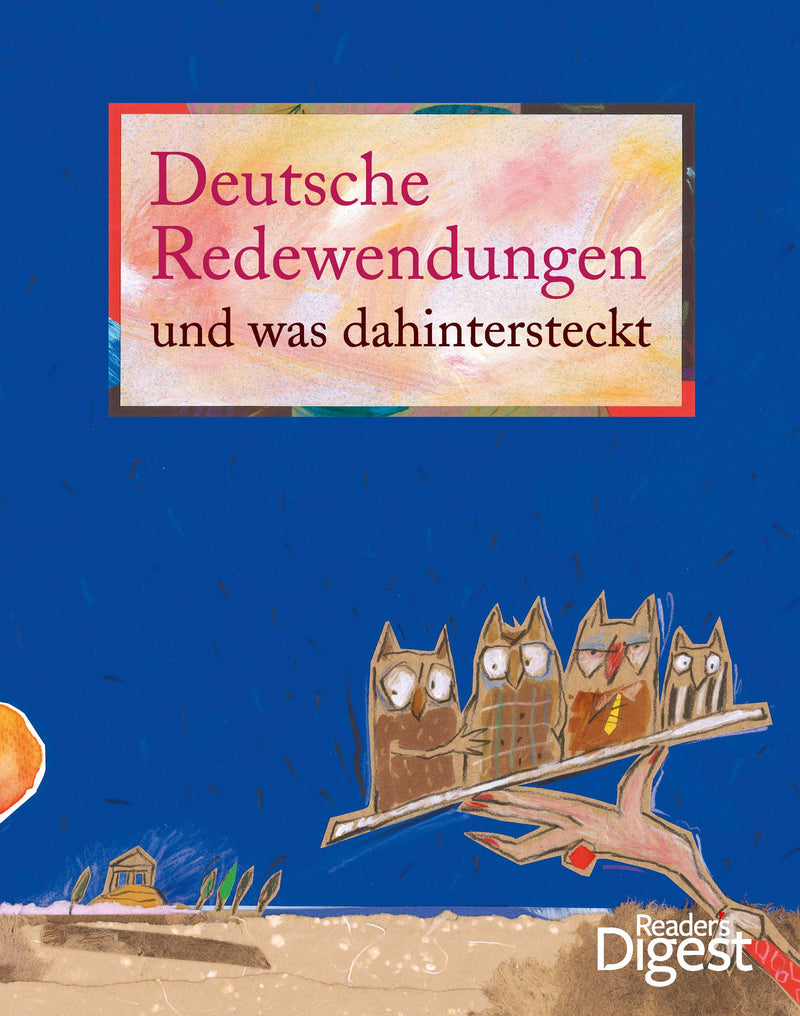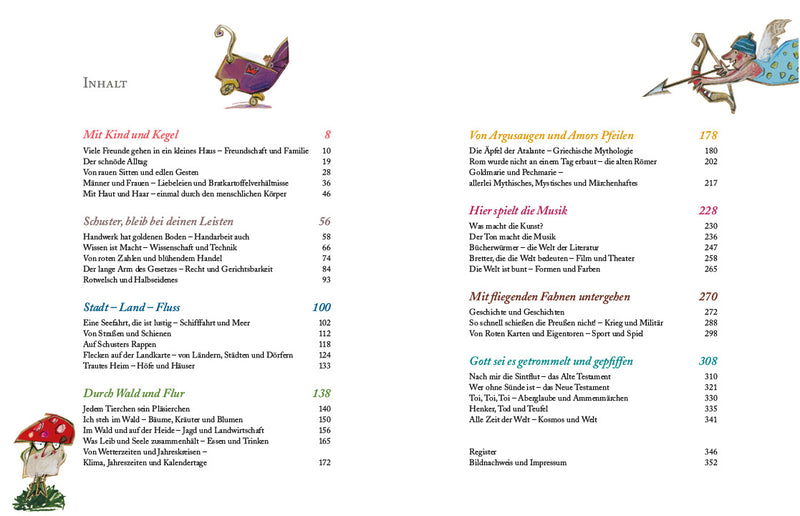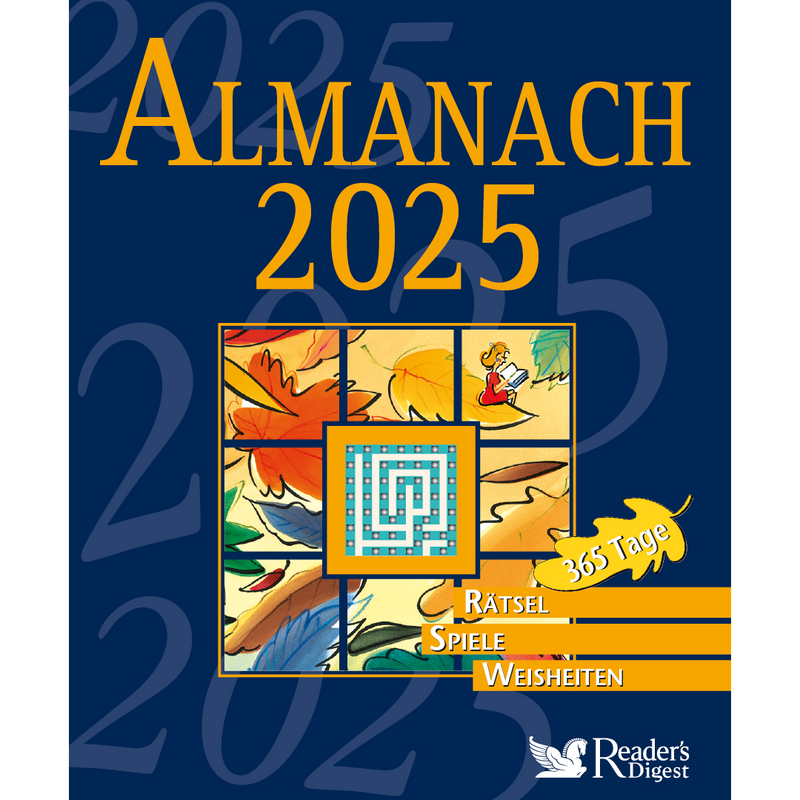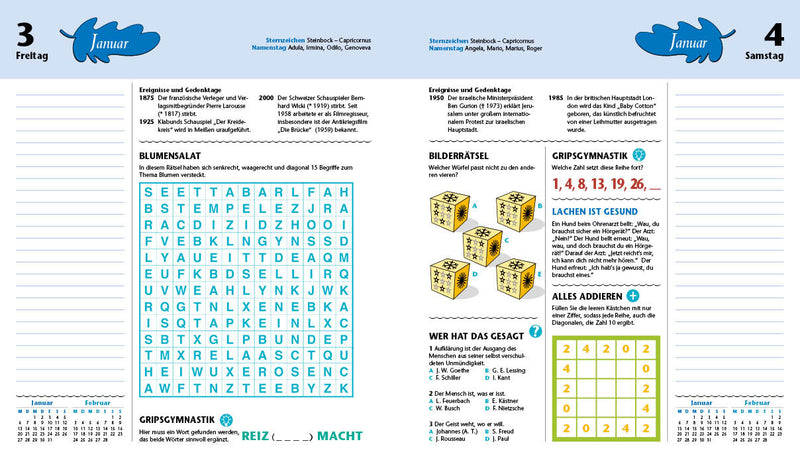Das Spiel ihres Lebens
Wie Frauenfußball die Welt verändern kann. Fünf passionierte Fußballerinnen erzählen ihre Geschichte.

©
„Ich wollte unbedingt mitmachen!“
Khadija „Bunny“ Shaw, 26, jamaikanische Stürmerin
Bunny Shaw sammelt alle ausgedienten Fußballschuhe, die ihre Mannschaftskolleginnen von Manchester City nicht mehr wollen. „Sie nennen mich den ,Stollen-Truck‘“, sagt die Stürmerin und lacht. Sie hat die beste Torbilanz Jamaikas aller Zeiten – im Männer- und im Frauenfußball – und kann sich heute problemlos Sportschuhe leisten, aber als Mädchen musste sie in Straßenschuhen spielen. Shaw weiß, dass viele junge Jamaikanerinnen und Jamaikaner kein Geld für Stollenschuhe haben. Deshalb spendet sie die hochwertigen Secondhand-Schuhe bei Frauenfußball-Turnieren auf der Insel.
Khadija Shaw wurde 1997 in Spanish Town, nahe der jamaikanischen Hauptstadt Kingston geboren. Sie war das jüngste von 13 Kindern. Einer ihrer Brüder gab ihr wegen ihrer Vorliebe für Karotten den Spitznamen Bunny („Häschen“). Begeistert schaute sie ihm auf der Straße beim Fußballspielen zu. „Es kamen immer viele Leute und schauten zu“, erinnert sich Shaw. „Ich wollte unbedingt mitmachen!“ Die Jungs stellten sie schließlich ins Tor. Ihre Eltern waren nicht glücklich darüber. Ihr Vater, Schuhmacher, und ihre Mutter, Geflügelzüchterin, legten großen Wert auf die Bildung ihrer Kinder. Vor allem ihre Mutter hielt Fußball für Zeitverschwendung. In Jamaika gab es kaum Mädchen- oder Frauenteams, „aber ich wollte Fußball spielen“, erzählt Shaw. Sie träumte davon, an der WM teilzunehmen. Also spielte sie, während ihre Mutter auf dem Markt war. Wurde Bunny dabei erwischt, versuchte sie zu verhandeln: „Wenn ich abwasche, darf ich dann spielen?“
So ging das, bis sie sich mit 14 Jahren sogar für die U-15-Auswahlmannschaft qualifizierte. Bunny Shaw war nicht mehr aufzuhalten. 2015 wurde sie in die A-Nationalmannschaft berufen und erhielt ein Stipendium an der University of Tennessee, USA, wo sie einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften machte. Als erste in ihrer Familie erwarb sie einen Universitätsabschluss. Als sich die Reggae Girlz, wie die jamaikanische Nationalmannschaft genannt wird, nach einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Panama für die Frauenfußball-WM 2019 qualifizierten, war Shaws Traum wahr geworden. Zum ersten Mal nahm ein Karibikstaat an der WM teil. Obwohl Jamaika in der Gruppenphase ausschied, war die Qualifikation unvergesslich. „Ich kniete auf dem Spielfeld nieder, und alle anderen rannten wie verrückt herum“, erinnert sie sich. Diesen Sommer wird Shaw mit den Reggae Girlz zu ihrer zweiten Weltmeisterschaft fahren. „Ich bin wirklich stolz auf mich“, sagt Jamaikas unangefochtene Torschützenkönigin. Ihr Rat an alle, die einen scheinbar unerfüllbaren Traum haben? „Bleibt dran, harte Arbeit zahlt sich aus.“
„Diese Mädchen verdienen es, zu spielen.“
Monika Staab, 64, ehemalige Trainerin von Saudi-Arabien
Im August 2021 wurde Monika Staab Trainerin der ersten Frauenfußball-Nationalmannschaft in Saudi-Arabien. Seit Jahren kämpft die ehemalige Mittelfeldspielerin weltweit für die Gleichstellung der Geschlechter im Fußball. Das Königreich in der Wüste ist ihre jüngste Herausforderung.
Staab wuchs in den 1960er-Jahren in der Nähe von Frankfurt am Main auf. Sie war ein Wildfang, spielte schon mit vier mit den Jungen Fußball auf der Straße. Damals gab es keine Mädchenmannschaften, Frauenfußball war in Deutschland bis 1970 sogar verboten. Es klingt unglaublich, aber mit elf Jahren erkämpfte sich Staab einen Platz in einem Frauenteam. „Vor halb zehn kamen wir abends nicht auf den Platz, vor elf war ich nicht zu Hause, und am nächsten Morgen musste ich ab fünf Uhr in der Bäckerei meiner Eltern arbeiten. Um sieben Uhr ging ich dann in die Schule.“
Mit 18 zog Staab nach London, wo sie für die Queens Park Rangers spielte. Um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, putzte sie Hotelzimmer. Damals erhielten Spielerinnen vom Verein nicht nur kein Geld, sondern sie mussten für die Benutzung des Spielfelds sogar zahlen. Nach Stationen beim FC Southampton und bei Paris Saint-Germain kehrte sie 1984 nach Deutschland zurück. Auch hier bekam sie kein Geld. Ihre Mannschaftskameradinnen und sie mussten häufig sexistische Bemerkungen von Spielern ertragen.
Glücklicherweise änderte sich die Einstellung 2003, als Deutschland die Frauenfußball-WM gewann. Staab war damals Trainerin beim 1. FFC Frankfurt. Nachdem sie das Team zu zahlreichen Titeln geführt hatte, widmete sie sich ab 2007 einer neuen Mission: Sie reiste um die Welt, um die Entwicklung des Frauenfußballs zu fördern und das Leben der Frauen zu verbessern. Bis heute hat sie Programme in 86 Ländern initiiert. Im Rahmen eines Schulfußballprojekts in Gambia kehrten Mädchen in die Klassenzimmer zurück, die die Schule abgebrochen hatten, weil sie zu Hause helfen mussten. In Kambodscha trainierte Staab Frauen, die Opfer von Menschenhändlern geworden waren. „Ein oder zwei Stunden lang konnten sie spielen und ihre traumatischen
Erlebnisse vergessen“, erzählt sie. Sie ist fest davon überzeugt, dass Fußball Frauen dazu befähigen kann, die Gesellschaft nachhaltig zu verändern. „Fußball ist mehr als ein Spiel. Er lehrt uns Respekt, Toleranz, Fairness, Kommunikation und Teamgeist.“
Als der saudi-arabische Fußballverband (SAFF) Monika Staab 2020 bat, den ersten Trainerlehrgang für Frauen zu leiten, sagte sie zu. Neun Monate später wurde sie Nationaltrainerin. Staab spürt eine große Begeisterung für den Frauenfußball in Saudi-Arabien, vor allem seit 2019, als der SAFF eine Frauenfußball-Abteilung einrichtete, in der Frauen zum ersten Mal als Profis spielen durften. Sie erlebte, wie Männer und Frauen gemeinsam Fußballspiele live verfolgten und Mädchen das Recht erhielten, in der Schule Sport zu treiben. Inzwischen gibt es zwei saudi-arabische Frauenligen mit 25 Vereinen.
Staab hat die Nationalmannschaft in ihren ersten sieben Länderspielen zu vier Siegen und zwei Unentschieden geführt. Im Februar 2023 wurde sie zur Technischen Leiterin des saudi-arabischen Nationalteams befördert, um die weitere Entwicklung des Frauenfußballs zu betreuen. Neue Trainerin ist die Finnin Rosa Lappi-Seppälä.
Im Frühjahr 2023 wurden die Pläne des saudi-arabischen Tourismus-Ministeriums, die Frauenfußball-WM zu sponsern, von der FIFA fallen gelassen. Amnesty International und Human Rights Watch argumentierten, Saudi-Arabien nutze den Frauenfußball, um das Image des Landes aufzupolieren und von seiner schlechten Menschenrechtsbilanz abzulenken. Monika Staab bleibt auf das Spiel konzentriert: „Ich bin nicht der König. Ich bin für den Frauenfußball hier. Diese Mädchen verdienen es, zu spielen, genauso wie die Männer.“
„Mir wurde klar, dass Fußball Macht hat.“
Nadia Nadim, 35, in Afghanistan geborene Stürmerin für Dänemark
Nadia Nadims Leidenschaft für den Fußball wurde geweckt, als sie 2000 als Kind in einem Flüchtlingslager in Dänemark durch einen Zaun Mädchen beim Trainieren zusah. „Es war das erste Mal, dass ich Mädchen Fußball spielen sah“, erinnert sie sich. „Besonders einem Mädchen sah ich gern zu und wünschte mir, ich wäre wie sie. Sie sah so glücklich und frei aus.“ Freiheit war für Nadims Familie in ihrem Heimatland Afghanistan in unerreichbare Ferne gerückt, nachdem ihr Vater, ein Armeegeneral, von den Taliban ermordet worden war. Nadim war das zweite von fünf Mädchen. Ohne männlichen Begleiter war die Familie ans Haus gefesselt. „Wir konnten nicht zur Schule gehen, also unterrichtete uns unsere Mutter zu Hause“, erzählt Nadim.
Schließlich beschloss ihre Mutter, Menschenschmuggler anzuheuern und aus dem Land zu fliehen. Mit gefälschten Pässen schafften sie es über die Grenze nach Pakistan und stiegen in ein Flugzeug nach Mailand. Dort versteckten sie sich in einem Lastwagen, der zwei Tage lang quer durch Europa fuhr – bis in die dänische Stadt Randers.
Im Flüchtlingslager lernte Nadim morgens Dänisch und spielte von nachmittags bis zum Einbruch der Dunkelheit mit den Jungen und Mädchen im Lager Fußball. Eines Tages fasste sie den Mut, die Mädchen hinter dem Zaun zu fragen, ob sie bei ihnen mitmachen dürfe. Ihr erstes Spiel bestritt Nadim in zu kleinen Fußballschuhen aus einem Secondhandladen, in denen sie Blasen bekam. Nadia Nadims sportliche Fähigkeiten und ihr Talent legten den Grundstein für eine unglaubliche Fußballkarriere. Als erste im Ausland geborene Spielerin trat sie 2009 beim Algarve Cup in Portugal für Dänemark an. Nadim spielte in Profimannschaften in Dänemark und Großbritannien und gehörte dem französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain an, der 2021 den Titel in der französischen Frauenliga gewann. Zurzeit spielt sie für den Racing Louisville FC in den USA.
2006 startete Nadim zusammen mit einem Freund ein Fußballprojekt in einem Problemviertel von Randers, in dem Jugendliche häufig mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das Projekt startete mit sieben Jungen, heute nehmen mehr als 200 Kinder – Jungen und Mädchen – daran teil. Sie erinnert sich an den Tag, an dem sie zwei somalische Mädchen mit Kopf-tüchern Fußball mit Jungen spielen sah. „Bis dahin hatten die Mädchen geglaubt, sie könnten nicht Fußball spielen. Mir wurde klar, dass Fußball Macht hat. Er kann die Einstellung von Menschen verändern.“ Nadim wurde 2019 zum UNESCO-Champion für Mädchen- und Frauenbildung ernannt.
Weil Nadia Nadim ihrem Land etwas zurückgeben wollte, wurde sie Ärztin. Neben ihrer Fußballkarriere absolvierte sie ein Medizinstudium an der Universität Aarhus in Dänemark, das sie 2022 abschloss. „Ich möchte Menschen helfen, wenn ich nicht mehr Fußball spiele“, sagt sie. „Wenn ich durch die Gänge des Krankenhauses gehe, habe ich das Gefühl, dass ich Großes leisten kann.“
„Jeder kann spielen!“
Sandrine Dusang, 39, ehemalige Verteidigerin für Frankreich und Gleichstellungsaktivistin
„Was würde dir denn wirklich Spaß machen?“, fragte Sandrine Dusangs Mutter die Sechsjährige, die jedes Mal weinte, wenn sie zum Tanzunterricht gehen sollte. „Ich will Fußball spielen“, antwortete die Kleine. Schon bald gehörte sie zu den wenigen Mädchen in ihrem Dorfverein in der Nähe von Vichy, Frankreich. Als sie 13 Jahre alt wurde und nicht mehr mit Jungen spielen durfte, fuhr ihre Mutter sie dreimal pro Woche in das eine Autostunde entfernte Moulins. Nach ihrem Abschluss an der französischen Frauenfußball-Akademie CNFE Clairefontaine schloss sich die Verteidigerin 2003 dem französischen Spitzenklub Olympique Lyonnais Feminin an und wurde in die französische Nationalmannschaft berufen. 2005 nahm sie an der Europameisterschaft teil. Da sie nur ein geringes Spielhonorar erhielt, arbeitete sie gleichzeitig als Marketingassistentin für den Verein. „Ich schuftete den ganzen Tag im Büro, schnappte mir einen Happen zu essen und meine Klamotten und rannte zum Training“, erinnert sie sich. Dabei wusste sie nur zu gut, dass dies bei Männern anders war. 2009 erhielten französische Fußballerinnen dann endlich Verträge.
Von 2003 bis 2011 vertrat Dusang Frankreich in 47 Länderspielen. Heute kämpft sie für Chancengleichheit. „Fußball ist eine Schule des Lebens“, erklärt sie. „Man kann überall spielen: im Garten, auf der Straße, auf einem Spielplatz. Beim Fußball entwickelt man sich persönlich weiter. Mädchen brauchen oft mehr Selbstbewusstsein, um erfolgreich zu sein. Fußball kann dabei helfen. Er macht uns stärker.“
Dusangs Engagement ist vielfältig: Vier Jahre lang arbeitete sie als Redakteurin der französischen Website www.footdelles.com, die sich für Frauenfußball und Vielfalt im Sport einsetzt. Sie unterstützt das internationale Projekt Equal Playing Field, das die Entwicklung des Frauensports weltweit fördert. Die Organisation ist in 32 Ländern vertreten, mit Hauptniederlassungen in den USA und in Großbritannien.
Heute, 20 Jahre nach Beginn ihrer Profikarriere, kämpft Dusang um die Anerkennung des ersten reinen Frauenfußballvereins auf Korsika. In der Stadt Bastia auf der Mittelmeerinsel ist sie sowohl Spielerin als auch Co-Präsidentin des Féminine Esprit Club (FEC). Als sie 2019 nach Korsika kam, durften Frauenfußball-Mannschaften dort nur bei regionalen Wettbewerben und nicht gegen Mannschaften vom französischen Festland antreten. Nachdem sie sich bei korsischen Politikern dafür eingesetzt hatte, wurde ihr Verein im Dezember 2022 für den landesweiten Wettbewerb Coupe de France zugelassen. Die Mannschaft gewann einmal und spielte einmal unentschieden. Sandrine Dusang nutzt ihre Position beim FEC Bastia auch, um wichtige Botschaften und Werte zu vermitteln. Die Trikots der Spielerinnen tragen die LGBT-Farben und einen Slogan auf Korsisch für die Gleichstellung der Geschlechter. Übersetzt lautet er: „Jeder kann spielen!“
„Stell dich nie über andere.“
Débora de Oliveira „Debinha“, Mittelfeldspielerin für Brasilien
„Debinha“ heißt auf Portugiesisch „kleine Débora“ – sie ist 1,57 Meter groß –, und die Star-Mittelfeldspielerin hat fest vor, nicht größenwahnsinnig zu werden. Ihre Philosophie lautet: „Stell dich nie über andere.“ Lieber sei sie ein Spiegel für andere und lerne von Teamkolleginnen. „Das habe ich schließlich nicht allein geschafft“, sagt sie. Debinha weiß, sie hat ihrer Familie und anderen Menschen, die ihr ganz nach oben geholfen haben, viel zu verdanken. Sie hat aber auch immer an sich selbst geglaubt, sich aus ihrer Komfortzone herausgewagt und unermüdlich für ihren Sport eingesetzt.
Die 31-Jährige hat es weit gebracht: vom Straßenfußball in ihrer Heimatstadt Brasópolis im Südosten Brasiliens zu einem Star der US-amerikanischen Frauenfußball-Liga und zu einer tragenden Säule der brasilianischen Frauenfußball-Nationalmannschaft. Sie hat mehr als 130-mal für ihr Land gespielt und wurde 2022 als einzige Südamerikanerin für die Auszeichnung zur besten FIFA-Fußballerin nominiert. Im Sommer 2023 wird sie an ihrer zweiten Weltmeisterschaft teilnehmen.
„Ich habe schon immer gern Ball gespielt“, erzählt Debinha, die mit acht Jahren auf dem Platz vor der Süßwarenfabrik, in der ihre Mutter arbeitete, mit dem Fußballspielen begann. Wenn sie nicht auf der Straße spielte, besuchte sie nach der Schule Sportkurse. „Ich war absolut sportbegeistert“, erzählt Debinha. „Ich spielte Volleyball, Handball, fuhr Skateboard. Aber Fußball war meine Stärke, also habe ich immer mit den Jungen und Mädchen Fußball gespielt.“
Die Oliveiras haben immer zusammengehalten. Es gab aber eine Zeit, da warf der starke Alkoholkonsum von Debinhas Vater einen Schatten auf das Familienleben. Debinha spielte damals noch mehr Fußball. Als sich die Möglichkeit ergab, für den Verein Saad im 200 Kilometer entfernten São Paulo zu spielen, ging die 16-Jährige zu ihrer Mutter und bat sie, die Einverständniserklärung zu unterschreiben. Ihre Mutter begann zu weinen. „Es war sehr schwer, sie weinen zu sehen“, erinnert sich Debinha. Obwohl ihre Mutter an Depressionen litt, unterstützte sie ihre Tochter stets. „Heute ist sie immer noch mein größter Fan“, sagt Debinha. Und sie ist stolz auf ihren Vater, weil dieser seine Alkoholsucht überwunden hat.
Der Weggang aus Brasópolis fiel Debinha ebenso schwer wie ihrer Mutter. „Um meinen Traum zu verwirklichen, musste ich meine Freunde, meine Familie und das bequeme Leben aufgeben. Ich war immer glücklich gewesen, ich lebte in der Straße Sete de Setembro und spielte auf dem Platz.“ Aber das Mädchen, das offen zugibt, immer nach Herausforderungen zu suchen, wusste damals, dass sie es tun musste. Und es hat sich gelohnt. Sie spielte in Norwegen und auch in China. Heute ist sie bei Kansas City Current, USA, unter Vertrag. Der größte Triumph ihrer Fußballkarriere bislang war die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in ihrer Heimat Brasilien. „Auf dem Spielfeld zu stehen und zu sehen, wie meine Familie mich anfeuert und dieses Erlebnis mit mir teilt, lässt sich nicht mit Geld aufwiegen.“