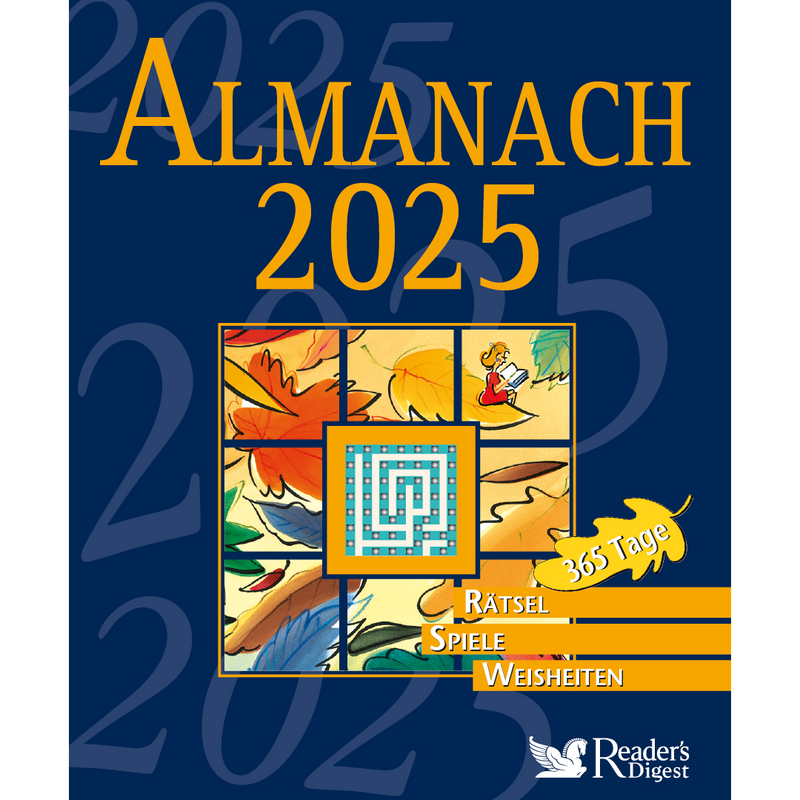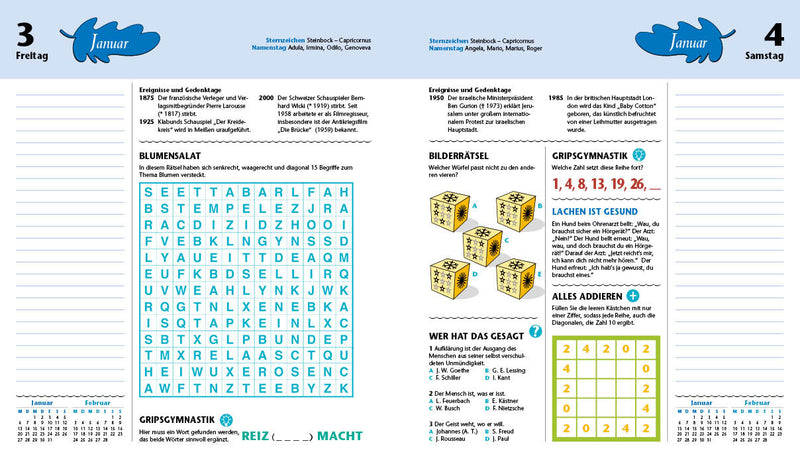Die starken Frauen von Ouagadougou

©
Auf einem klapprigen Fahrrad fährt eine junge Frau durch Ouagadougou, die Reifen rot wie die Erde. Ihre Haare hat sie unter ein grünes Tuch gesteckt. Doch es ist ihr blauer Overall, der ins Auge fällt. Er zeigt, dass sie Ehrgeiz hat, im Leben etwas erreichen will und abfällige Bemerkungen der Männer nicht fürchtet.
Bérénice Zigani ist in ihrem letzten Lehrjahr zur Kfz-Elektrikerin. Ein Beruf, den in Burkina Faso fast nur Männer ausüben. „Viele Leute haben mich deshalb ausgelacht“, sagt die 17-Jährige, „aber man darf sich im Leben nie entmutigen lassen.“ Über den Hof, in den sie einbiegt, schallt der Lärm aus drei Lehrwerkstätten. In den Hallen schweißen, schrauben und hämmern die angehenden Automechanikerinnen.
Schuldirektor Bernhard Zongo trinkt wie jeden Morgen einen Kaffee in der Schulkantine, die nicht viel mehr ist als eine Bretterbude. Ein letzter Schluck, dann stemmt er sich aus dem grünen Plastikstuhl hoch und geht gemächlich in sein Büro. Hinter seinem Schreibtisch, auf dem sich Zettel stapeln, lässt er sich in einen Ledersessel fallen. „Die Idee, Frauen in nichttraditionelle Berufe einzubinden, entstand Mitte der 1990er-Jahre“, sagt er. „Schon damals lagen praktisch alle fortschrittlichen Berufe in den Händen von Männern.“ Eine soziale Ungerechtigkeit, die er nicht länger hinnehmen wollte. Gemeinsam mit Kollegen gründete er die Hilfsorganisation ATTous-Yennenga. Der Name erinnert an eine legendäre Kriegerin, die im 12. Jahrhundert für ihr Königreich, aber auch für ihr Recht auf Selbstbestimmung kämpfte. Mittlerweile betreibt der Verein landesweit vier CFIAM-Einrichtungen (Centre de Formation et d’Insertion des Adolescentes et des Femmes – Ausbildungs- und Eingliederungszentrum für Jugendliche und Frauen), in denen Mädchen und junge Frauen auch in Berufen ausgebildet werden, die bislang Männern vorbehalten waren.
Der Wandel ist nötig. Viele burkinische Mädchen werden trotz gesetzlicher Schulpflicht nicht eingeschult, nur etwa 40 Prozent schließen eine weiterführende Schule ab. Das Resultat: Fast jede dritte junge Frau ist arbeitslos. Frauen, die einen Job haben, werden oft als schlecht bezahlte Hilfskräfte eingestellt. Manchmal reicht der Tageslohn nur für ein Abendessen.
Die Werkstatt als Familie
Die Chancen für angehende Karosseriebauerinnen, Lackiererinnen und Kfz-Elektrikerinnen stehen dagegen gut. Im vergangenen Lehrjahr haben mehr als drei Viertel der Mädchen nach ihrem Abschluss eine Stelle gefunden, sich selbstständig gemacht oder ihre Ausbildung in einem Werkstattbetrieb fortgesetzt.Es könnten noch mehr sein, findet Schuldirektor Zongo. Doch seit dem Beginn des Projekts hat der Verein mit Vorurteilen zu kämpfen. Das am häufigsten genannte: Frauen seien nicht klug genug für den Job.
Auch viele Eltern zweifelten. „Sie waren nicht einmal damit einverstanden, dass ihre Töchter Hosen tragen“, erinnert sich Zongo. Heute seien Ehemänner das größte Hindernis. „Sie wollen nicht, dass ihre Frauen einen Männerberuf ausüben. Also zwingen sie die Frauen, ihre Arbeit zu beenden.“
Aufhören kommt für Bérénice nicht infrage. Gerade lernt sie, wie der Stromkreis eines Autos funktioniert. Hupe, Licht, Lüfter. Der Wagen, an dem sie und ihre Kolleginnen werkeln, ist ein rund 30 Jahre alter Peugeot. Autos, die in Europa längst Oldtimer-Status hätten, sind im Straßenbild der Hauptstadt Ouagadougou die Norm. Die Lernwerkstatt hat sich der Realität der Straße angepasst. Modernes Werkzeug, teure Ersatzteile oder Computer sucht man hier vergeblich. Die Schülerinnen sollen Fahrzeuge mit einfachen Mitteln reparieren. Und sich gegenseitig helfen.
Lachen, rumalbern, sich in den Arm nehmen. Seit fast drei Jahren lernen die jungen Frauen schon zusammen, im Sommer machen sie ihren Abschluss. „Ich habe hier gute Freundinnen gefunden. Sie sind für mich wie eine Familie“, schwärmt Bérénice. Gemeinsam mit einer Kollegin bastelt sie aus bunten Kabeln einen Stromkreis. Die Lüfter laufen schon, dann ertönt die Hupe. „C’est bon“, lobt Prudence Segueda, 28. „So ist es gut.“ Die Mechatronikerin unterrichtet seit einem Jahr im Ausbildungszentrum. „Ich bin wie eine große Schwester für die Mädchen.“ Sie nimmt ihre Schülerinnen in den Arm, tuschelt mit ihnen, lacht.
„Sie können mit ihren Problemen immer zu mir kommen“, sagt Segueda. Oft treiben Geldsorgen die Familien um. Manchmal fehlt sogar das nötige Geld für ein Mittagessen oder den Bus. Dann hilft sie aus, steckt ihnen was zu. Die meisten Eltern müssen sich die jährlichen Schulgebühren von umgerechnet rund 75 Euro wortwörtlich vom Mund absparen. Im Vergleich zu anderen Schulen ist das nicht teuer. Doch für Familien, die wenig haben, ist es viel Geld.
Der Druck auf die Mädchen ist hoch. Wer in Burkina Faso gut verdient, entlastet die Familie und kann sie im besten Fall finanziell unterstützen. Daher stellen viele Absolventinnen ihren Traum von der eigenen Werkstatt oder einer zusätzlichen Ausbildung hintenan und suchen sich rasch einen Job in einer der kleinen Werkstätten am Straßenrand.
Am späten Nachmittag sitzt Bérénice mit ihrer Mutter vor ihrem kleinen Haus hinter einem großen Metalltor. Tauben flattern von Dach zu Dach. Der Hund bellt, sobald sich jemand dem Tor nähert. „Meine Tochter war schon immer eine Kämpferin“, erzählt die Mutter. Viel zu früh sei sie auf die Welt gekommen, zwei Monate haben die Eltern um sie gebangt, ehe sie ihre kleine Tochter aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen konnten. Ein schüchternes Kind sei Bérénice gewesen, habe aber in der Grundschule immer gute Noten geschrieben.
Bildung kostet Geld
Auf einer weiterführenden Schule war Bérénice nie. Dafür reichte das Geld nicht. Der Besuch des Ausbildungszentrums war ein finanzieller Kraftakt für die Eltern. „Aber wir haben den Gürtel enger geschnallt“, sagt die Mutter. Ein Mädchen, das Mechanikerin wird, das sei schon etwas Besonderes. „Das ist eine Premiere in unserer Familie.“ Nun hofft sie, dass Bérénice nach dem Abschluss schnell eine Stelle findet, Geld nach Hause bringt.Burkina Faso zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Die Vereinten Nationen schätzen, dass rund 3,5 Millionen Bewohner keinen sicheren Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Seit Jahren überschwemmt eine Welle der Gewalt das Land. Der Terror im Namen eines radikalen Islams breitet sich wie ein Flächenbrand aus. Fast zwei Millionen Menschen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Rund ein Viertel aller Schulen mussten aufgrund der Terrorgefahr schließen.
Doch die Tore des CFIAM-Ausbildungszentrums in Ouagadougou stehen nach wie vor offen. Zwei Ventilatoren surren und quietschen unter der Decke des Klassenraums. An der Tafel steht das Thema des heutigen Unterrichts: Bremskreise. Ein Mädchen hat den Kopf auf den Tisch gelegt, schläft. Lehrerin Prudence Segueda weckt sie nicht auf. „Gestern kam sie mit rot geränderten Augen in die Klasse“, berichtet sie. „Es sah aus, als hätte sie geweint.“ Darauf angesprochen, brach das Mädchen zusammen. „Da habe ich unsere Psychologin gerufen.“
Schulpsychologin Asseta Konombo sitzt in einem winzigen Raum an ihrem Schreibtisch. Hier fließen oft Tränen. Erst gestern wieder, als das Mädchen aus Bérénices Klasse vor ihr saß. „Sie hatte das Gefühl, dass alle gegen sie sind“, sagt die Psychologin. Zu Hause tue sie alles, um ihrer Mutter zu gefallen. Doch die Anerkennung für das, was sie leistet, fehle. „Der Vater hat sich von der Mutter getrennt. Keine einfache Situation.“ Konombo bat die Mutter, in die Schule zu kommen. Im Gespräch konnte die Tochter ihrer Mutter endlich sagen, wie verzweifelt sie ist. Die Mutter versprach, ihr zu helfen.
Nicht jedes Problem lässt sich schnell lösen. Das weiß die Psychologin. Sie erzählt von einer schwangeren Schülerin, die noch zu Hause wohnte. Nach der Geburt des Kindes drängten die Eltern sie dazu, das Kind dem Vater zu geben. „Sonst hätte sie ihre Ausbildung nicht fortsetzen dürfen.“ Sie willigte ein, weil sie wusste: Ohne abgeschlossene Ausbildung geriete sie in eine Abhängigkeit, aus der viele burkinische Frauen nicht mehr herauskommen.
Der Weg in die Zukunft
Im Durchschnitt bekommen Frauen in Burkina Faso knapp fünf Kinder. Damit Schwangere ihre Ausbildung fortsetzen können, unterstützt die Schule werdende Mütter. So auch die junge Frau, die Asseta Konombo um Hilfe bat. „Ich fuhr auf meinem Motorrad die 15 Kilometer zum Haus der Familie und sprach mit den Eltern.“ Am Ende durfte die Tochter ihre Ausbildung fortsetzen und bekam ihr Kind zurück. Es gibt noch weitere Hilfsangebote der Schule. „Wir haben auch eine Krippe eröffnet“, führt Schuldirektor Zongo aus. „Da können sie ihre Kinder während des Unterrichts unterbringen. Und wir haben einen Mikrokreditfonds für Absolventinnen eingerichtet, mit dem wir Gründung und Entwicklung von Unternehmen finanzieren.“Eine, die es geschafft hat, ist die Automechanikerin und dreifache Mutter Fleur Tapsoba, 47. Über der Durchfahrt in ihren Hof prangt ein weißes Schild. „Garage Féminin“ steht darauf – Frauenwerkstatt. Im blauen Werkskittel begrüßt Fleur ihre Gäste, eine kräftige Frau, die Haare zu Rastazöpfen geflochten, die Hände mit Schwielen und kleinen Narben übersät. Als Jugendliche brach sie die Schule ab und begann die Ausbildung in einem der CFIAM-Zentren. „Mein Vater hat mich immer unterstützt“, erinnert sie sich, „obwohl die anderen Mitglieder meiner Familie dagegen waren.“
Ein Traum wird wahr
Und nicht nur sie. Oft wurde sie auf dem Weg zur Schule beschimpft oder wegen ihres ölverschmierten Overalls ausgelacht – auch von Mädchen. „Das war nicht einfach für mich.“ Doch all die Häme und der Spott konnten sie nicht aufhalten. Fleur Tapsoba gehörte zu den ersten Frauen, die ihre Ausbildung als Zweiradmechanikerin bei CFIAM abgeschlossen haben. „Das war der Grundstein für meinen Erfolg“, betont sie. „Dem Direktor des Zentrums bin ich jeden Tag dankbar dafür.“2017 konnte sie ihren Traum verwirklichen und eine eigene Werkstatt in Ouagadougou eröffnen. „Meine ehemalige Schule gab mir einen Kredit, ohne den hätte ich es nicht geschafft“, erklärt sie. Mittlerweile arbeiten männliche Mechaniker auf selbstständiger Basis in ihrem Betrieb mit. An dem Namen der Werkstatt störe sich niemand. „Damit wollte ich die Neugier der Leute wecken“, verrät Tapsoba lachend, „und es funktioniert.“ Ab und zu machen Auszubildende ein Praktikum in ihrer Werkstatt. „Diesen Mädchen möchte ich als Vorbild dienen“, erklärt Tapsoba. Nur einen Traum konnte sie noch nicht verwirklichen. „Mein großer Wunsch ist es, ein eigenes Ausbildungszentrum zu gründen.“ Ein Grundstück hat sie schon. Aber noch fehlt das Geld für den Bau.
Auch Bérénice träumt von einer Karriere: „Ich möchte die beste Mechanikerin in Burkina Faso werden.“ Drei Monate später hat sie ihr erstes Ziel erreicht. Sie schreibt: „Heute halte ich mein Abschlusszeugnis in Händen.“