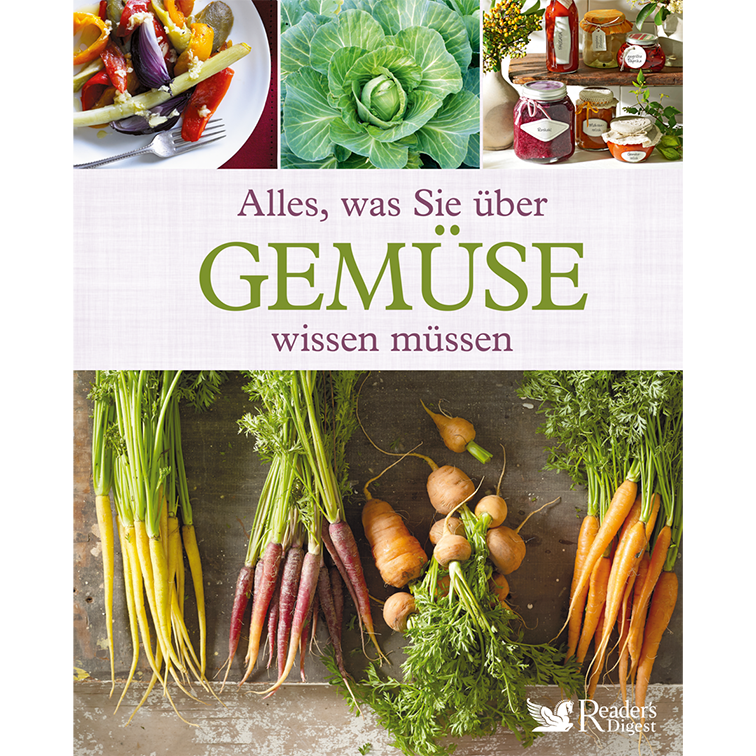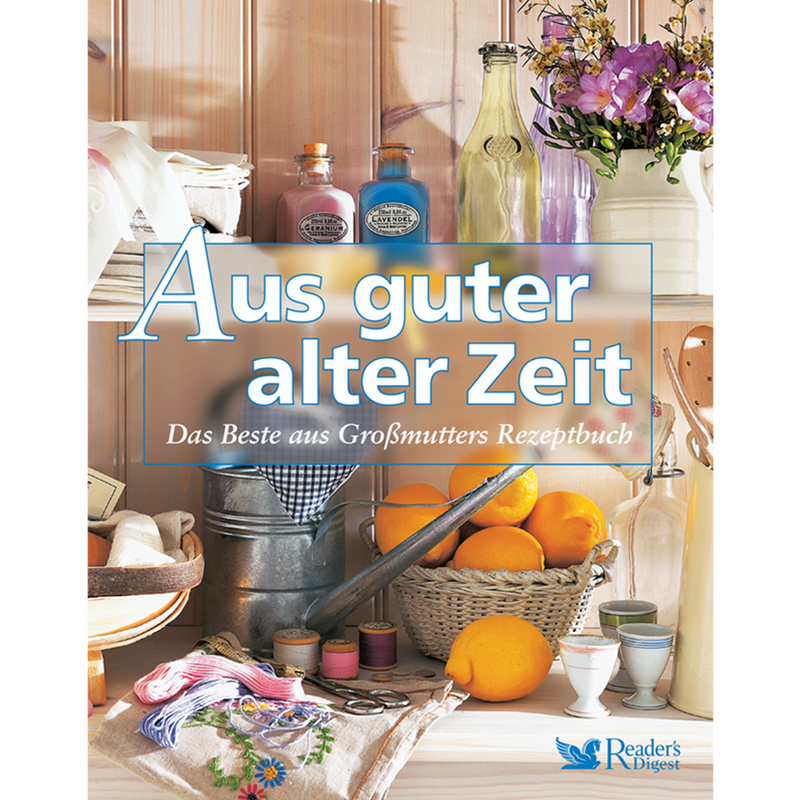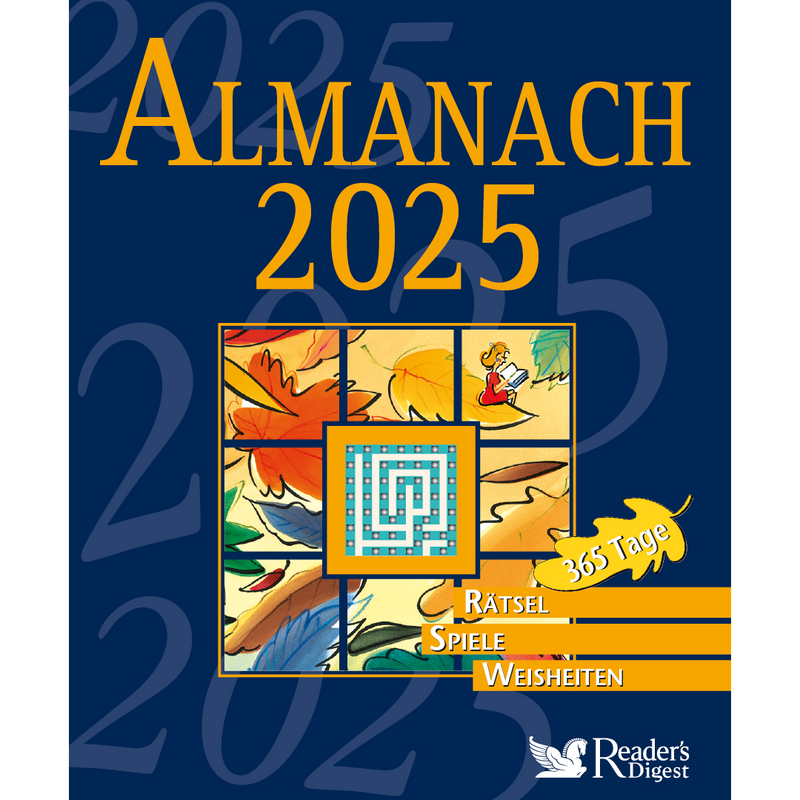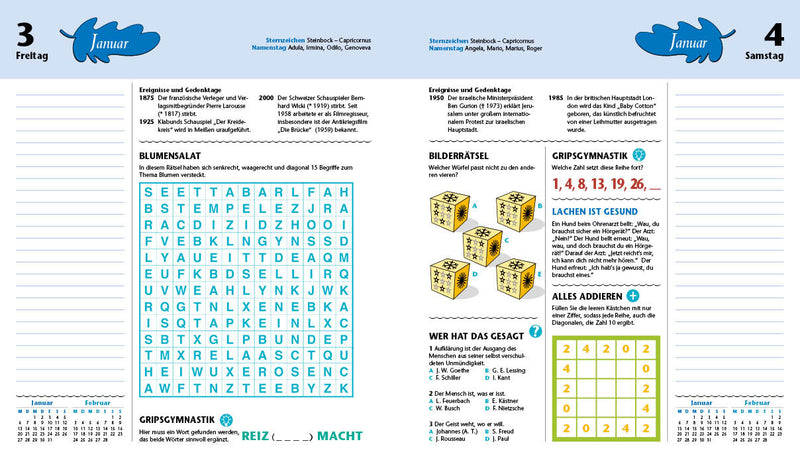Ein neuer Start
Im Erwachsenenalter noch einmal zur Uni oder Schule gehen? Lernen Sie fünf Menschen kennen, die dies gewagt und dadurch eine neue Sicht aufs Leben gewonnen haben.

©
Diesen Artikel gibt es auch als Audio-Datei
Sie glauben, dass nur junge Menschen Unterricht haben, Aufsätze schreiben und Prüfungen ablegen, dann irren Sie sich gewaltig! Laut einer Statistik der Europäischen Union absolvierte 2022 fast die Hälfte der 25- bis 64-Jährigen eine Aus- oder Weiterbildung – mehr als ein Drittel davon war 55 Jahre alt oder älter. Schweden hatte in Europa den höchsten Anteil an erwachsenen Lernenden: Dort lag die Quote bei mehr als 70 Prozent.
Das Interesse an lebenslangem Lernen ist groß. Die Gründe dafür sind vielfältig: Manche wollen Qualifikationen nachholen, die sie in jüngeren Jahren verpasst haben, andere streben eine berufliche Veränderung an. Wieder andere wollen sich einfach selbst beweisen, dass sie es können. Lernen Sie fünf Frauen und Männer kennen, die im fortgeschrittenen Alter neue Wege eingeschlagen und dabei fürs Leben gelernt haben.
Die beste Medizin
Lisa Österlund erschrak. Eigentlich war sie fit, doch im Hallenbad hatte sie plötzlich Schwierigkeiten, eine ganze Bahn zu schwimmen. „Ich kam einfach nicht vorwärts“, erinnert sich die heute 56-jährige Schwedin aus Stockholm. „Ich hatte keine Kraft in Armen und Beinen.“ Als sie beim Spinning-Kurs kaum noch die Pedale bewegen konnte, bekam sie Angst. Österlunds Arzt diagnostizierte die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow, eine Überfunktion der Schilddrüse. Mit den richtigen Medikamenten hätte es ihr innerhalb von zwei Monaten wieder gut gehen sollen, doch sie reagierte allergisch darauf. Ihre Augen schwollen an und sie sah alles doppelt.
„Ich dachte, ich würde blind“, erzählt sie. Es folgte eine zermürbende Behandlung, wie sie bei Krebspatienten üblich ist. Vor allem die Chemotherapie machte ihr zu schaffen: Monatelang litt sie unter Übelkeit und Erschöpfung.
Die Krankheit hätte sie zu keinem schlechteren Zeitpunkt treffen können: Erst vor Kurzem hatte sie ihren Traumjob begonnen – als Musikbibliothekarin bei Schwedens öffentlich-rechtlicher Hörfunkanstalt. Doch sie konnte sich einfach nicht auf ihre Arbeit konzentrieren. Die Steroide, die sie gegen ihre Sehstörung nehmen musste, machten sie hyperaktiv, während sie sich gleichzeitig erschöpft fühlte. „Ich brauchte einen Energieschub“, erklärt sie. „Also begann ich ein Studium.“
Die Schwedin hatte bereits einen Bachelor in Journalismus und einen Master in Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Außerdem war sie sprachbegabt und liebte Französisch. Als junge Frau hatte sie in Paris Musik studiert. Nun wollte sie in dieser Sprache einen offiziellen Abschluss machen. Also schrieb sie sich 2018 für einen vierjährigen Bachelorstudiengang in Französisch an der Universität Stockholm ein, während sie in Teilzeit weiterhin beim Hörfunk tätig war.
„Niemand an der Uni sah in mir eine kranke Frau, niemand fragte, wie alt ich war oder was ich vorher gemacht hatte“, schwärmt sie. Tatsächlich gab es viele ältere Studierende an der Universität. „Mein Studium faszinierte mich so sehr, dass ich meine Krankheit vergaß.“ Ihr Sehvermögen verbesserte sich, und zum Erstaunen ihres Arztes stabilisierte sich ihr Zustand. Die Rückkehr an die Uni war „die Therapie, die ich wirklich gebraucht hatte“, betont sie.
Sie wusste, dass die Krankheit jederzeit wieder aufflammen konnte. Daher griff sie sofort zu, als sich ihr die Möglichkeit bot, parallel zu ihrem Französischstudium einen zweiten Bachelor als Übersetzerin an der Universität Lund zu machen. So würde sie als freiberufliche Übersetzerin arbeiten und sich die notwendige Flexibilität sichern können, falls es ihr gesundheitlich schlechter ginge. Da die Schwedin ihren Anspruch auf Studienkredite ausgeschöpft hatte, nahmen sie und ihr Mann Jon 2021 eine Hypothek auf ihr Haus auf, um ihr zweijähriges Übersetzerstudium zu finanzieren. Mit 52 ließ sie sich von ihrer Arbeit freistellen und zog 600 Kilometer südwestlich von Stockholm in ein Wohnheim in Lund – zusammen mit Studierenden, die so alt waren wie ihre drei Kinder. Als sie in der Küche einen Zettel mit dem Spruch „Deine Mutter arbeitet hier nicht“ las – ein Hinweis an die Bewohner, Ordnung zu halten –, lachte sie und dachte: „Dabei bin ich eine Mutter und arbeite hier wirklich!“
Heute ist Österlund gesund und hat zwei Abschlüsse in Französisch. Sie übersetzt französische Bücher ins Schwedische und arbeitet weiterhin beim Hörfunk. Für die meisten wäre das genug – doch Österlund möchte weiterlernen. 2022 führte die schwedische Regierung ein Programm ein, das es Erwachsenen ermöglicht, zwei Jahre lang mit 80 Prozent ihres Gehalts Bildungsurlaub zu nehmen. 2023 schrieb sich Österlund in einen Masterstudiengang in französischer Literatur an der Universität Stockholm ein.
Ich denke, also studiere ich ...
Nick Axten aus Somerset, Großbritannien hatte noch einiges im Leben vor. Als junger Mann hatte er einen Bachelor in Soziologie und Psychologie an der Leeds University gemacht. Es waren die „wilden 1960er“, und Axten war ein rebellischer Student mit langen Haaren, der in der lebhaften Musikszene der Universitätsstadt zu Hause war.
„Es war eine tolle Zeit“, erinnert sich der heute 78-Jährige. „Ich habe viel gefeiert und nächtelang über Gott und die Welt diskutiert.“ Er war ein kluger, aber unkonventioneller Denker. 1970 wurden ihm zwei renommierte US-amerikanische Stipendien angeboten: Er erhielt die Chance, an der University of Pittsburgh in Pennsylvania in einem interdisziplinären Forschungsgebiet über Mathematik in den Sozialwissenschaften zu promovieren.
„Das Angebot konnte ich unmöglich ablehnen“, erklärt Axten. Doch auf der anderen Seite des Atlantiks lief es nicht wie erwartet: Seine Ehe ging in die Brüche, er hatte Heimweh und seine Forschungen machten ihm keinen Spaß. „Ich bedaure, dass ich die Promotion damals nicht abgeschlossen habe“, sagt er. „Ich bekam so viel Geld und hatte das Gefühl, alle enttäuscht zu haben.“
Zurück in Großbritannien übernahm Axten verschiedene Jobs – von der Herstellung von Bilderrahmen über Bauarbeiten bis hin zu einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Koordinator an einer Grundschule. Das inspirierte ihn dazu, ein 35-bändiges wissenschaftliches Lehrbuch für Lehrkräfte zu schreiben. Es fand auf der ganzen Welt Verwendung. Bevor er 2014 in den Ruhestand ging, arbeitete er als Gebäudemanager an einer großen Grundschule und gab Nachhilfe in Mathematik und Naturwissenschaften. Axten mochte seine Arbeit. Doch die philosophischen Fragen, die ihn seit seinem Studium in Pittsburgh beschäftigt hatten, ließen ihn nicht los: Warum verhalten sich Menschen, wie sie sich verhalten? Und was ist ihnen wichtig?
Auch andere Gedanken nagten an ihm. Er hatte Angst, „vom Tod überrascht zu werden“. So war es seinem Vater, einem Hobbyhistoriker, ergangen: Er starb, bevor er sein heiß geliebtes Forschungsprojekt über die Ge-schichte einer alten Gemeinde und ihrer Kirche fertigstellen konnte. Und so schrieb sich Axten 2016 im Alter von fast 70 Jahren für einen Masterstudiengang in Philosophie an der nahe gelegenen University of Bristol ein. Im darauffolgenden Jahr begann er eine neue Doktorarbeit – fast 50 Jahre nach seiner ersten.
Am meisten genoss er jedoch die angeregten Diskussionen mit den anderen, viel jüngeren Doktoranden in einem Pub in der Nähe der Universität – es war genau wie vor 50 Jahren: „Wir saßen zusammen und redeten und redeten. Einfach genial!“ Axtens Abschlussfeier 2023 war ein bewegender Moment. Seine damalige Frau Claire und seine elfjährige Stiefenkelin schauten zu, wie er die Bühne betrat und die Vizekanzlerin ihm den Doktortitel verlieh.
Dr. Axten, wie er sich nun nennen darf, freut sich darüber, wie viel ihm sein spätes Studium gebracht hat. „Ich habe so viel gelernt. Das hat mein Leben immens bereichert.“
Eine neue Karriere mit 64
Als Martine Aeschlimann mit 60 beschloss, ein Studium aufzunehmen, fragte sie ihren Sohn Cédric, was er davon halte. Der damals 21-Jährige studierte an der Universität Genf in der Schweiz – genau dort, wo sich seine Mutter 2016 für ein Bachelorstudium in Psychologie einschreiben wollte. „Hättest du etwas dagegen?“, fragte sie. „Nein, überhaupt nicht“, antwortete Cédric – unter einer Bedingung: „Wenn du mich an der Uni mit meinen Freunden siehst, kennst du mich nicht!“ Doch nachdem Aeschlimann ihr Studium begonnen hatte, berichtete Cédric ihr, wie beeindruckt seine Freunde von ihr waren. „Du hast es ihnen also doch erzählt?“, fragte sie, amüsiert über seinen Sinneswandel. „Klar“, sagte er. Cédric erwies sich als große Stütze: Er sprach seiner Mutter vor den Prüfungen Mut zu und las ihre Seminararbeiten Korrektur. Nachdem sie ihren Bachelorabschluss mit Bravour bestanden hatte, machte sie direkt mit dem Master weiter.
Aeschlimann verstand sich gut mit den anderen Studierenden, obwohl sie die Älteste in ihren Kursen war. Sie staunte, als ein Dozent, den sie bisher nur in einem vollen Hörsaal gesehen hatte, sie in einem Zug grüßte. Später fragte sie ihre Kommilitonen, wie der Professor sie wohl erkannt habe. Sie lachten und zeigten auf ihr weißes Haar.
Der Gedanke, zu studieren, kam der damals 58-Jährigen zum ersten Mal nach der Trennung von ihrem Mann. „Ich musste mir beweisen, dass ich noch etwas drauf habe. Ich hatte 18 Jahre lang nicht gearbeitet“, erklärt sie. Dabei war Aeschlimann nicht untätig gewesen. Sie hatte als Krankenschwester und später als Sozialarbeiterin gearbeitet. Als Cédric zur Welt kam, widmete sie sich ganz der Erziehung ihres Kindes.
Ihr Interesse an Psychologie wurde erstmals 1994 geweckt. Damals gründete sie mit ihrer Mutter eine Stiftung, um Kindern mit Lernschwierigkeiten zu helfen. Während ihres Masterstudiums, 25 Jahre später, stieß sie auf Neurofeedback – eine Therapie, die verschiedene Strategien zur Veränderung negativer Denkmuster einsetzt. Dies führte Aeschlimann in eine Richtung, mit der sie früher nie gerechnet hätte: Sie wurde diplomierte Neurofeedback-Therapeutin. Nach Abschluss ihres Masterstudiums 2021 eröffnete die damals 64-Jährige ihre eigene Praxis. Nun hilft sie jungen Leuten, ihre Lernfähigkeit zu steigern – und Menschen jeden Alters, Stress und Ängste zu bewältigen.
Zu sehen, wie gut ihre Patientinnen und Patienten darauf ansprechen, erfüllt sie mit großer Zufriedenheit. Eine Schülerin erzählte Aeschlimann, dass sich ihre Noten rasant verbessert hätten, seitdem sie sich besser konzentrieren könne. „Ich hatte schon immer den Wunsch, anderen zu helfen“, sagt Aeschlimann. „Wenn ich die Ergebnisse der Sitzungen sehe, erfüllt mich das mit Freude.“
Unser tägliches Brot
„Ich bin unglaublich wissbegierig“, erzählt der 39-jährige Bäckermeister Guillaume Casaux. „Ich entdecke gern Neues. Dabei reicht es mir nicht, nur an der Oberfläche zu kratzen. Ich möchte eine Sache wirklich beherrschen.“ Casaux’ angeborene Neugier hat ihm gute Dienste geleistet. Als junger Mann studierte er an einer renommierten französischen Hochschule für Textilingenieure. Danach arbeitete er mehr als zehn Jahre lang für einen großen Sportartikelhersteller. Es faszinierte ihn, zu erforschen, wie verschiedene Materialien eingesetzt werden können.
Umso mehr wunderte sich seine Familie, als er mit 35 seine sichere Stelle aufgab, um Bäcker zu werden. „Sie hielten es für einen Rückschritt“, sagt Casaux, der mit seiner Frau Chrystelle und zwei Töchtern im Südwesten Frankreichs lebt. Doch für ihn war es völlig logisch. Er war in einer ländlichen Region in einer Familie aufgewachsen, die sich weitgehend selbst versorgte. „Ein großer Teil des Lebens besteht aus Essen und Trinken“, erklärt er. „Das ist etwas, das mir von klein auf vermittelt wurde. Also wollte ich in der Lebensmittelproduktion arbeiten.“
Der Wendepunkt kam im Lockdown der Coronapandemie, als Casaux und zwei Freunde mit Sauerteig experimentierten. Er beschloss zu kündigen und sich als Bäcker selbstständig zu machen. Allerdings ist das in Frankreich nicht so einfach, wie es klingt. „Um Brot herstellen zu dürfen, braucht man ein Diplom“, erklärt Casaux. Er meldete sich zu einem Berufsqualifikationskurs an, der in der Regel von 17-Jährigen besucht wird, die einen handwerklichen Weg einschlagen. Während er zu Hause die Theorie des Brotbackens büffelte, entwickelte er gleichzeitig Rezepte und Pläne für sein neues Unternehmen.
Im Sommer 2023 legte Casaux eine siebenstündige Prüfung ab, bei der er nicht nur drei Aufsätze schreiben, sondern auch diverse Brotsorten und Gebäckstücke herstellen musste. Er hatte hart daran gearbeitet, seine Backkünste zu perfektionieren. „Die Prüfung ist nicht schwer, aber wenn man eine gute Note haben will, muss man schon üben“, meint Casaux.
Nach dem bestandenen Examen betreibt er nun seine eigene Bäckerei: Pro Woche backt er drei Chargen hochwertiges Brot. An einem Tag bereitet er den Teig vor, am nächsten backt er ab fünf Uhr morgens. Die fertigen Laibe liefert er an Lebensmittelgeschäfte in der Region. Nebenbei arbeitet er als selbstständiger Textilingenieur.
„Ich bin jetzt da, wo ich hinwollte“, sagt Casaux. „Ich bin öfter müde, aber viel zufriedener.“
Vom Automechaniker zum Arzt
Von Andy Simmons
Carl Allamby hatte ein Problem: seine Autowerkstatt. Er hatte sie im Alter von 19 Jahren gegründet. Im Laufe der Zeit wurden daraus zwei Werkstätten mit elf Mitarbeitern. Allamby spürte jedoch, dass er sich nach etwas anderem sehnte. Zunächst dachte er, sein Geschäft sei zu klein und er müsse es weiter ausbauen. Daher beschloss der inzwischen 34-Jährige aus Cleveland im US-Bundesstaat Ohio, Betriebswirtschaft zu studieren. Nach fünf Jahren Teilzeitstudium erfuhr er, dass er für seinen Abschluss noch einen Biologiekurs absolvieren musste. „Wozu brauche ich denn bitte Biologie?“, fragte er sich verwundert. Im Nachhinein war es das Beste, was ihm passieren konnte. Die Biologievorlesungen ließen seinen Kindheitstraum wieder aufleben: „Gleich am ersten Tag erinnerte ich mich, dass ich Doktor werden wollte, als ich klein war“, erzählt Allamby. „In meinem späteren Leben ging dieser Traum verloren.“
Allamby wuchs in einem armen afroamerikanischen Viertel auf. In seiner Schule gab es keine naturwissenschaftlichen Fächer, die ihn auf ein Medizinstudium vorbereiten konnten. Daher gab er den Wunsch auf, Arzt zu werden, und wählte einen naheliegenderen Beruf: Automechaniker. Doch mit 39 betrat ein ganz anderer Carl Allamby den Hörsaal. Jetzt wollte er seinen Traum leben. Mit Unterstützung seiner Frau gab er schon bald das Wirtschaftsstudium auf und belegte stattdessen die naturwissenschaftlichen Fächer, die er für eine Tätigkeit im Gesundheitswesen brauchte.
In seinem Alter Arzt zu werden, war unrealistisch, glaubte Allamby. Deshalb dachte er darüber nach, Krankenpfleger, Arzthelfer oder Physiotherapeut zu werden. Doch eines Tages sprach ihn sein Chemieprofessor nach der Vorlesung an: „Carl, Sie sind der älteste Student hier. Was haben Sie nach dem Studium vor?“ Allamby antwortete, am liebsten würde er Arzt werden, doch wäre es wohl vernünftiger, die Latte etwas niedriger zu legen. „Arzt, warum denn nicht?“, fragte der Professor. „Sie haben das richtige Gespür für diesen Beruf. Sie werden es weit bringen.“ Der Professor hatte recht. „Es brauchte einen Außenstehenden, um mir das zu zeigen. Ich selbst war nicht in der Lage, diese Fähigkeit in mir zu sehen“, gibt Allamby zu. 2015 verkaufte er seine Werkstätten und begann ein Medizinstudium in Ohio.
2019 war es dann so weit: Aus Carl Allamby wurde Dr. Carl Allamby. Er war 47 Jahre alt. Er schloss noch eine dreijährige Facharztausbildung in der Notfallmedizin an und arbeitet heute als Notarzt in einer Klinik in seiner Heimatstadt Cleveland. Gleichzeitig ist er Leiter eines Rettungsdienstes bei der Feuerwehr.
„Meine Kinder schauen zu mir auf, mein Umfeld bewundert mich. Ich passe in so viele demografische Kategorien, laut denen ich niemals hätte Arzt werden können. Ob wegen meines Alters, meiner Herkunft, meiner Erziehung – alles gute Gründe, warum ich nicht hier stehen sollte. Und dennoch habe ich es geschafft.“