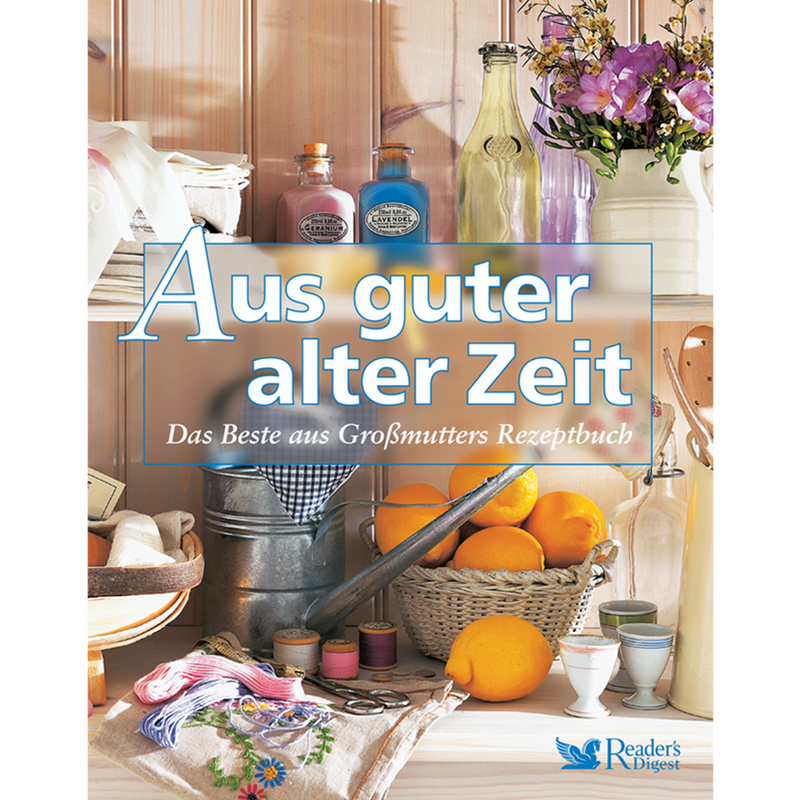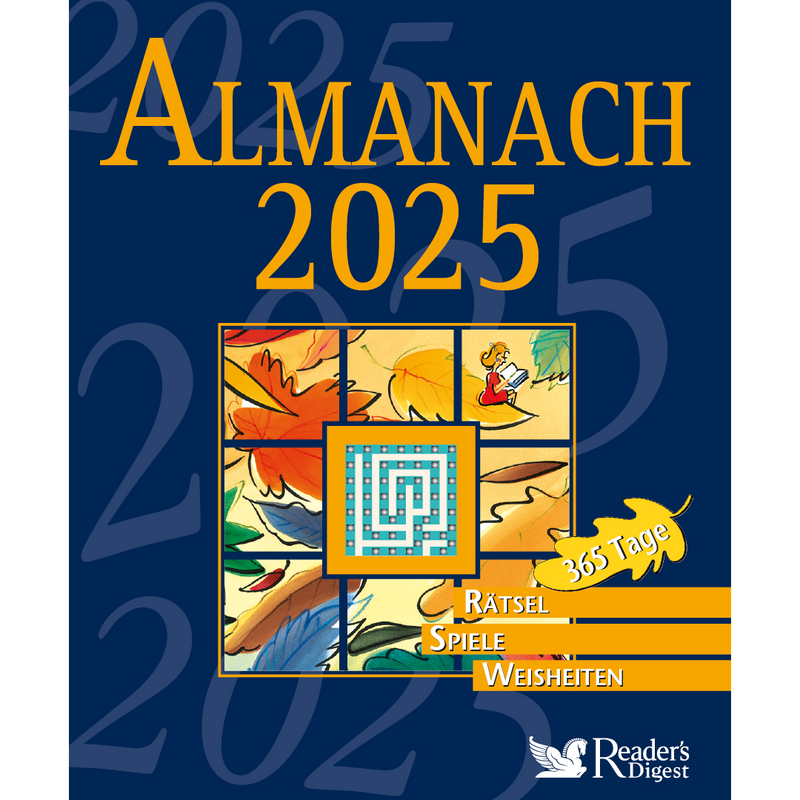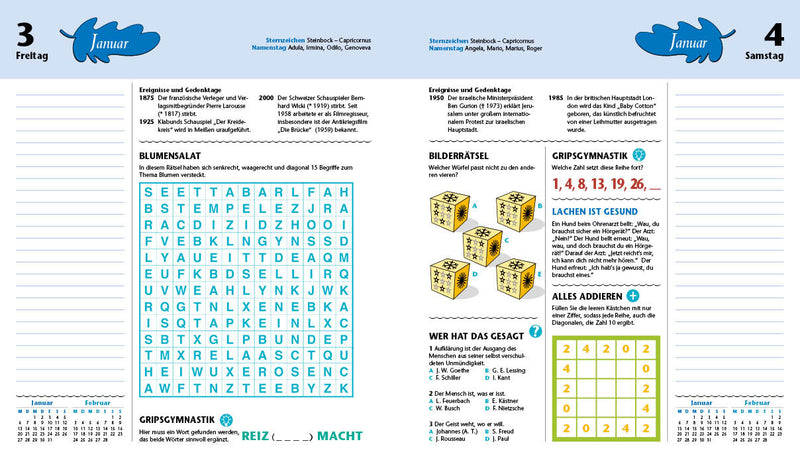Musik gegen das Vergessen
Ein Holocaust-Überlebender kämpft mit seinem Schlagzeug gegen den Antisemitismus – Note für Note.

©
Diesen Artikel gibt es auch als Audio-Datei
Dezember 2015: Saul Dreier wartet auf den Aufritt mit seiner Holocaust Survivor Band (die Holocaust-Überlebende-Band). Der kleine, drahtige Rentner steht in den Kulissen der Millennium-Bühne des Kennedy Centers in Washington, USA. Ein prestigeträchtiger Ort für eine Musikgruppe, die bis zu diesem Zeitpunkt erst seit etwas mehr als einem Jahr existiert. Dreier ist aufgeregt, aber nicht nervös. Er hat in seinem Leben schon zu viel gesehen, um sich von einer Vorführung wie dieser verunsichern zu lassen. Als Dreier (90), und Reuwen „Ruby“ Sosnowicz (88), beide Holocaust-Überlebende, schließlich angekündigt werden und die Bühne betreten, begrüßt sie das Publikum enthusiastisch. Sosnowicz, der Zurückhaltendere der beiden, geht zu seinem Keyboard und würdigt das Publikum kaum eines Blickes, Dreier winkt und deutet einen Kuss an, bevor er hinter seinem Schlagzeug Platz nimmt. Zu ihnen gesellen sich jüngere Musiker, darunter Sosnowicz’ Tochter Chana Rose, die singt und Tamburin spielt. Ein Geiger, ein Gitarrist, ein Bläser, eine Backgroundsängerin und ein weiterer Keyboarder – teils ebenfalls Kinder von Überlebenden – vervollständigen die Gruppe.
Ein gleichmäßiger Beat, gefolgt vom Schlagen einer kleinen Trommel, leitet die erste Melodie ein, das alte jiddische Lied Shalom Aleichem (Friede sei mit dir). Während manche den Song wie ein Schlaflied singen, spielen Dreier & Co. es schnell und schwungvoll. Sie sind eine Klezmer-Band, die traditionelle jüdische Volkslieder und die ungestüme Tanzmusik Osteuropas mit einer kräftigen Dosis Improvisation kombiniert. Das Publikum nickt mit. Viele singen oder summen mit. Im krassen Gegensatz zu der beschwingten Melodie blitzen auf einer großen Leinwand eindringliche Schwarz-Weiß-Bilder vom Holocaust auf: Häftlinge, die in die Lager geführt werden, übereinander gestapelte Leichen, Familien, die auf ihr unausweichliches Schicksal warten.
Die Band leitet über zu Hava Nagila, dem Hochzeitslied. Dreier springt auf und ruft den Leuten zu: „Klatscht alle in die Hände!“ Sie tun es. Ergriffen bleibt Dreier aufrecht stehen, während er weiter Schlagzeug spielt. Die Fotos werden von einer Illustration mit tanzenden Silhouetten abgelöst, darunter steht Enjoy Yourself (Viel Vergnügen).
Dann ist Sosnowicz an der Reihe, er verlangsamt das Tempo mit der herzzerreißenden Ballade Where Can I Go?. Sie handelt von der Notlage des umherirrenden Juden: „Sag mir, wohin kann ich gehen? Es gibt keinen Ort, den ich sehen kann. Wohin soll ich gehen, wohin soll ich gehen? Jede Tür ist für mich geschlossen.“ Die Songliste umfasst jiddische Melodien, mit denen Dreier und Sosnowicz aufgewachsen sind, wie Bei mir bistu shein, sowie US-amerikanische Standards wie Those Were the Days.
Das Publikum genießt jede Sekunde. Die Band genießt jede Sekunde. Aber niemandem im Saal gefällt es mehr als Saul Dreier. Trotz der üblen Schicksalsschläge, die das Leben ihm beschert hat, ist Dreier mit einem ansteckenden Lächeln und einer Lebensfreude gesegnet, die sich in jedem flinken Schlagzeugschlag und in der Art und Weise zeigt, wie seine Augen das bewundernde Publikum ansprechen. Die Menschen sind gekommen, um die Band zu sehen, die Dreier zu Ehren der Holocaustopfer zusammengestellt hat. In einer Zeit, in der die Erinnerungen verblassen und der Holocaust gar geleugnet wird, sieht er es als seine Pflicht an, dafür zu sorgen, dass niemand vergisst. Sein Ziel, sagt er, ist es, „den Antisemitismus zu besiegen“.
Eine dramatische Lebensgeschichte
Polen war 1925, in dem Jahr, als Saul Dreier geboren wurde, ein ganz anderes Land als das, was es später werden würde. In Krakau, umgeben von Freunden, einer liebevollen Familie und dem ständigen Summen der Musik, war das Leben „idyllisch“, erzählt er. Die Idylle endete im Herbst 1939, als deutsche Truppen in seine Heimatstadt einmarschierten. Sie verhafteten seinen Vater, Musiker und Offizier in der polnischen Armee. Seine Mutter wurde mit anderen in Güterwaggons gepfercht und ins Konzentrationslager gebracht. Saul und seine Schwester zogen bei ihrer behinderten Großmutter ein. Unter der Nazi-Besatzung war die Schule für Juden keine Option mehr. Stattdessen musste Dreier Kleidung und Schmuck sortieren, welche die Nazis jüdischen Familien abgenommen hatten.
1941 geriet Dreiers Welt erneut aus den Fugen, als er mit ansehen musste, wie Soldaten seine Großmutter auf den Marktplatz zerrten und erschossen. Wochen später trennten Soldaten die Geschwister und brachten den damals 16-jährigen Dreier zusammen mit anderen Arbeitern in das Arbeitslager Plaszow, wo er eine neue Identität erhielt: 86540 – die Nummer, die ihm die Nazis auf den Unterarm tätowierten. Lagerkommandant war Amon Göth. Nach dem Krieg sollte er wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit hingerichtet werden. Zu diesen Verbrechen gehörte, dass er betrunken auf seinem weißen Pferd durch das Lager ritt und zum Spaß Gefangene erschoss.
Im Lager hungerte Dreier, wurde gedemütigt und ausgepeitscht. Der Tod war ständig präsent. Was ihn am Leben hielt, war die Musik. In den kostbaren Momenten, in denen er keine Zwölf-Stunden-Schichten Zwangsarbeit leistete, war er in einer Einraumbaracke mit etwa 50 anderen Männern zusammengepfercht.
Um seelisch nicht zu zerbrechen, sangen die Männer traditionelle jüdische Lieder. Einmal bemerkte Dreier, dass sie nicht mehr synchron waren. Er fand zwei Metalllöffel und hielt den Takt, indem er sie zusammenklatschte. Das wurde seine Aufgabe: den Takt zu halten. Und er genoss es. „Das Singen hat mir geholfen zu überleben“, beteuert er. „Wenn man nichts zu essen hat, aber hart arbeitet und singt, vergisst man, dass man nichts zu essen hat.“
In den nächsten Jahren wurde der junge und körperlich leistungsstarke Dreier von Lager zu Lager versetzt, wo immer Arbeiter gebraucht wurden. Eine Station war die Fabrik von Oskar Schindler, wo er Heizkörper für deutsche Kampfflugzeuge reparierte. Eine andere das Konzentrationslager Mauthausen in Österreich, wo mehr als 95 000 Juden ermordet wurden.
Bei einem Bombenangriff der Alliierten auf ein österreichisches Lager in Linz wurden Dreiers Hände, Rücken und Schädel von Granatsplittern durchdrungen. Verwundet und arbeitsunfähig war er alarmiert. Er hatte gehört, dass die Nazis Juden in den Konzentrationslagern vergasten und verbrannten, und nun befürchtete er das Schlimmste. „Wir werden hier sterben wie alle anderen auch,“ sagte er zu einem ebenfalls verwundeten Freund.
Einige Tage später, Anfang Mai 1945, als die Deutschen wussten, dass sich der Krieg dem Ende näherte, wurden die Gefangenen mit vorgehaltener Waffe zu einer Höhle geführt und aufgefordert, hineinzugehen. Manche gehorchten. Andere wehrten sich und versuchten zu fliehen. Die Soldaten eröffneten das Feuer. In dem Durcheinander sah Dreier, der sich am Ende der Reihe befand, eine Chance zur Flucht und ergriff sie: Er rannte. Bald darauf hörte er eine Explosion. Dynamit hatte die mit Gefangenen gefüllte Höhle gesprengt. Er lief weiter, bis er auf weitere Soldaten stieß. Diese waren US-Amerikaner. Nach seinem Entkommen brachte man Dreier in das Camp Santa Maria di Bagni in Italien, eine Bleibe für Geflüchtete, bis sie nach Hause zurückkehren oder eine andere Unterkunft finden konnten.
Wieder einmal gab ihm die Musik Halt. Eines Tages brachte ein Lastwagen ein Klavier und ein Schlagzeug. Während andere sich zum Klavier hingezogen fühlten, visierte Dreier das Schlagzeug an. Da er den Rhythmus mit Löffeln gut beherrschte, dachte er sich: Wie schwer kann das schon sein? Er saß zum ersten Mal an einem richtigen Schlagzeug. An den Wochenenden begleitete er in der Stadthalle das Klavier, wenn Einheimische und ehemalige Häftlinge zur Musik tanzten.
„So habe ich Schlagzeug spielen gelernt“, erklärt der Musiker.
Santa Maria di Bagni gab ihm Hoffnung, aber es war auch der Ort seiner größten Verzweiflung. Er erfuhr, dass seine Eltern in den Lagern gestorben waren, ebenso seine Schwester und zwei Dutzend weitere Familienangehörige. Dreier hatte alles verloren, er würde nicht nach Hause zurückkehren. Er gehörte zu denen, die einen anderen Ort zum Leben finden mussten.
Auswanderung und Neuanfang 1949
Im Jahr 1949 wagte Saul Dreier einen Neuanfang. Er wanderte nach New York, USA, aus und fand eine Arbeit als Schweißer in einer Fabrik. Er lernte Clara Brill, eine polnische Holocaust-Überlebende, kennen und heiratete sie. Das Paar bekam vier Kinder, 1980 zog die Familie nach Florida. Zu diesem Zeitpunkt hatte Dreier bereits aufgehört, Schlagzeug zu spielen. Seine Arbeit – er hatte eine eigene Baufirma gegründet – und seine Familie, zu der später acht Enkel und drei Urenkel gehören würden, hielten ihn auf Trab. 2014 stieß er auf einen Artikel über eine bemerkenswerte Holocaust-Überlebende namens Alice Herz-Sommer, die im selben Jahr mit 110 Jahren gestorben war. Wenn, wie es heißt, die beste Rache eines Überlebenden an Hitler darin besteht, ein langes, fruchtbares Leben zu führen, dann hatte sie das ihre getan. Die Geschichte berührte Dreier.
Während der Lagerhaft hatte Herz-Sommer, die vor dem Krieg Konzertpianistin war, Kraft aus dem Musizieren geschöpft. Dreier dachte an die Löffel und sein erstes Schlagzeug zurück. Der Artikel bewegte ihn dazu, Herz-Sommer und alle jüdischen Opfer der Nazis ehren zu wollen: durch die Liebe zur Musik.
„Musik ist für mich Leben“, sagt Dreier. „Wenn ich spiele, bin ich lebendig.“ Das Aufführen traditioneller jüdischer Lieder vor einem Publikum, so seine Überlegung, wäre ein Weg, um die Opfer und das Judentum selbst am Leben zu erhalten. Zu diesem Zweck musste er eine Band gründen, zusammen mit anderen Überlebenden.
Saul Dreier war zu diesem Zeitpunkt 89 Jahre alt, seit 15 Jahren im Ruhestand und hatte Magenkrebs hinter sich. Seine Frau und sein Rabbiner erklärten ihn für verrückt. Doch jemand, der Lagerkommandant Amon Göth überlebt hat, lässt sich nicht so leicht beirren. Wenige Tage später kehrte Dreier aus einem Musikgeschäft mit einem fünfteiligen Schlagzeug und dem Entschluss zurück, die Holocaust Survivor Band zu gründen. Sein erster Rekrut war ein versierter Keyboarder und Akkordeonlehrer, Ruby Sosnowicz. Dessen Familie war kurz nach dem Einmarsch der Nazis aus Polen geflohen und überlebte im Gegensatz zu der von Dreier. Zu den beiden Männern gesellten sich bald vier jüngere Musiker und ein israelischer Sänger. Um Clara den Klang seiner eingerosteten Schlagzeugkünste zu ersparen, mietete Dreier einen Proberaum. Als Nächstes brauchte es einen Veranstaltungsort. Dreier bot einer nahe gelegenen Synagoge an, ein kostenloses Konzert zu geben, denn wenn sie Geld verlangten, würde niemand kommen. „Aber wenn ich umsonst spiele“, dachte er, „kommen alle.“ 400 taten es.
Die Band, deren Zusammensetzung sich änderte, trat in den USA und in der ganzen Welt auf: in Israel, Deutschland, Brasilien und Polen, in Bibliotheken, Schulen und Einkaufszentren. Vergangenes Jahr traf Dreier sogar US-Präsident Joe Biden, als er die Marine Corps Band bei einer Chanukka-Feier im Weißen Haus begleitete.
Wo immer die Band auftritt, wird sie begeistert und herzlich empfangen. „Die Leute sind so interessiert, weil Saul die Geschichte seiner Holocaust-Erfahrung mitbringt“, sagt Mel Olman, der in der Band Klavier spielt. Und sie wollen etwas von einem Mann hören, der durch die Hölle gegangen ist und überlebt hat. „Der Tod hat mich mehrmals in meinem Leben angerufen“, erklärt Dreier auf seiner Website. „Aber ich habe Nein gesagt! Ich habe gesagt, dass ich, solange ich am Leben bin, dieses voll auskosten werde. Ich werde andere Menschen dazu inspirieren, Frieden in die Welt zu tragen.“
Dreier gründete eine gemeinnützige Stiftung, die Saul’s Generation Foundation, die unter anderem die Aufklärung über den Holocaust fördert. Er besucht Schulen und Universitäten, um seine Erfahrungen weiterzugeben. Er hofft, dass seine Geschichte der Resilienz „als Inspiration für die Jugend der Welt“ diene, insbesondere für diejenigen, die traumatische Ereignisse erlebt haben.
Dreiers Frau Clara verstarb 2016, und Sosnowicz hat sich aus der Band zurückgezogen. Doch Saul Dreier spielt weiter. Jetzt, im Alter von 99 Jahren, schätzt er, dass die Holocaust Survivor Band in verschiedenen Konstellationen fast 100-mal auf der Bühne stand. Jeder Auftritt war von Bedeutung. Einer, der ihm aber besonders in Erinnerung geblieben ist, war der im Jahr 2016, als er und Sosnowicz zum ersten Mal seit dem Krieg in ihre Heimat Polen zurückkehrten. Sie waren die Headliner eines Konzerts in Warschau – im ehemaligen Ghetto, in dem die Nazis mehr als 400 000 Juden eingesperrt und aus dem sie fast 300 000 in Vernichtungslager geschickt hatten.
Das Konzert in Warschau
Rund 3700 Menschen – jung und alt, Juden und Nichtjuden – versammelten sich auf der Straße. Der Dokumentarfilm Saul and Ruby’s Holocaust Survivor Band zeigt, wie ein Ehepaar mit Dreier spricht. Die Familie der Frau hatte unter großer Gefahr für sich selbst Juden vor den Nazis versteckt. Nach dem Gespräch über den Frieden und die Schrecken des Krieges umarmen sie sich die drei. ^Der Moderator wendet sich an das Publikum: „Wie oft werden wir noch die Gelegenheit haben, eine Band von Holocaust-Überlebenden zu hören? Wir alle müssen es auf uns nehmen, ihre Botschaft von Frieden und Liebe in die ganze Welt zu tragen.“
Dann steigen Dreier und Sosnowicz die Treppe zur Bühne hinauf, in mintgrünen Hemden, schwarzen Westen und schwarzen Hosen. Dreier nimmt hinter seinem Schlagzeug Platz, Sosnowicz schnallt sich sein Akkordeon um, es geht los. Die Älteren klatschen, die Teenager tanzen, alle schunkeln.
Es ist noch Tag, als sie beginnen, und Nacht, als sie sich zum Schluss verbeugen. Über den ekstatischen Applaus ruft Dreier mit unerschütterlicher Stimme hinweg: „Niemals vergessen! Nie wieder!“ Jeden Satz unterstreicht er durch einen Schlag mit seinen Trommelstöcken.