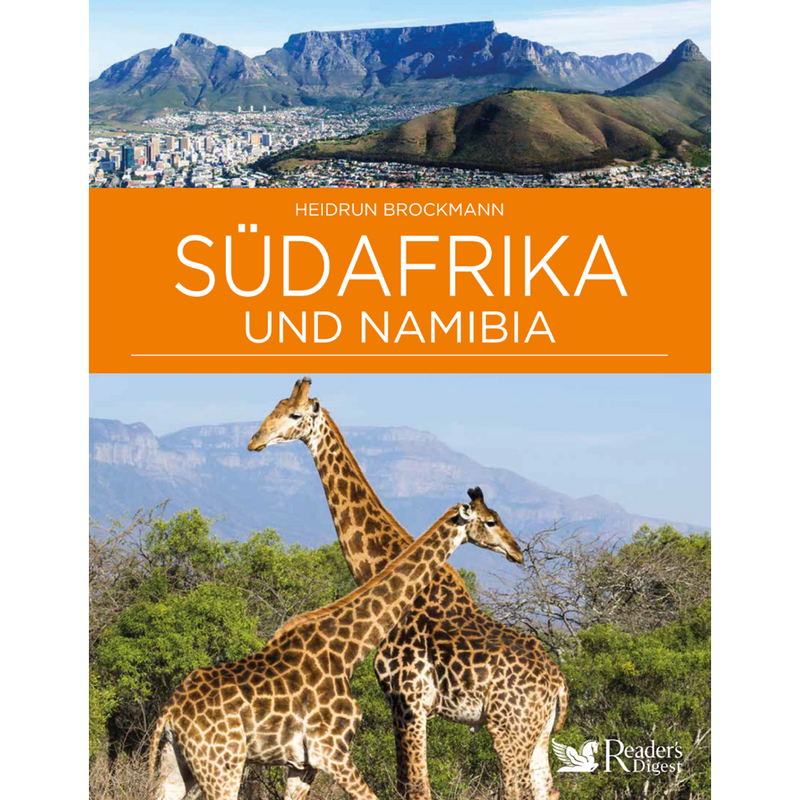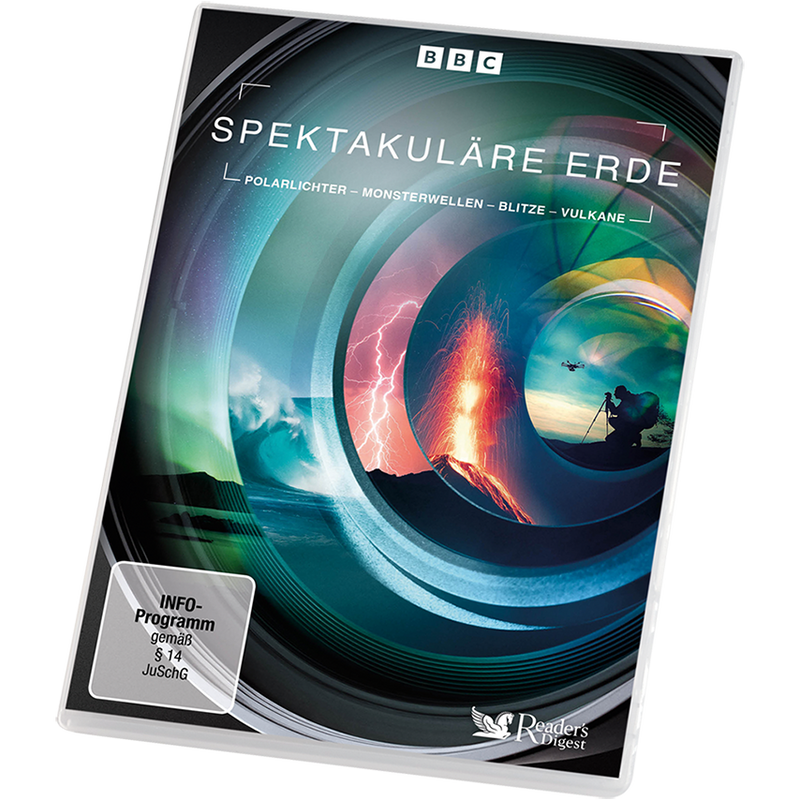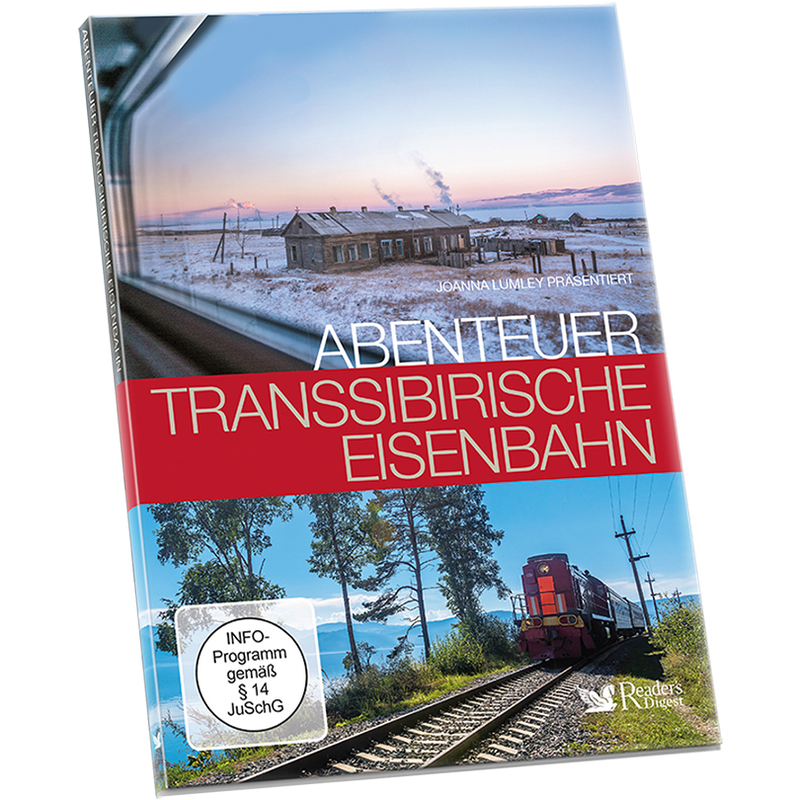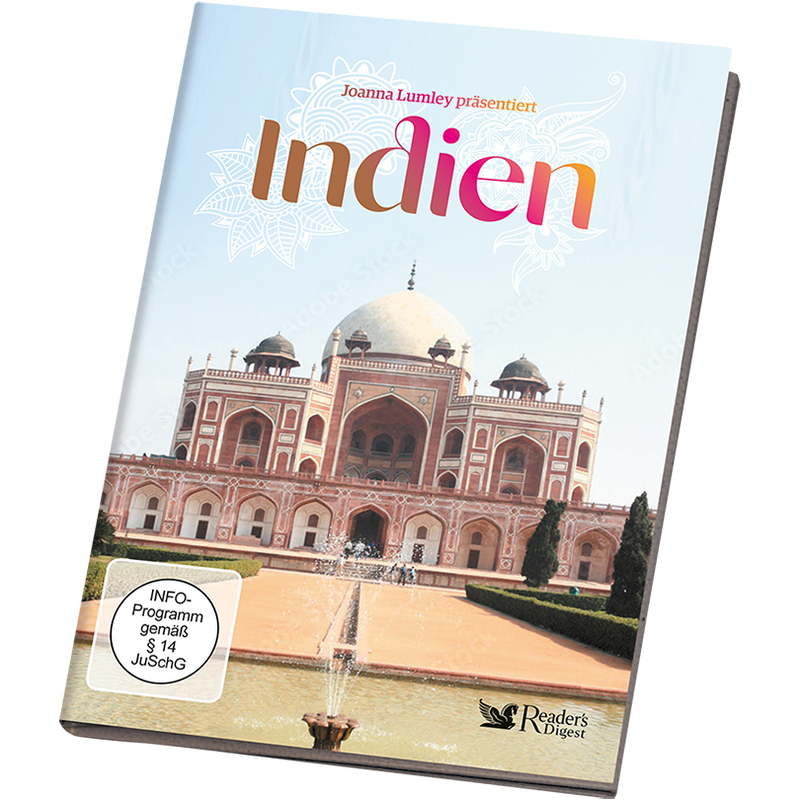Die Schlösser und Parks von Potsdam und Berlin

©
Am grünen Ufer der Havel, wo Berlin aufhört, beginnt Italien. Prinz Carl von Preußen hat es so gewollt. Von einer Reise ins Land, wo die Zitronen blühen, kehrte er 1822 derart verzaubert zurück, dass er sein Landgut Glienicke zum mediterranen Palazzo umgestalten ließ. Heller Putz, Pilaster und Balkon zierten fortan die Fassade. Im Garten wuchsen Laubengänge und am Ufer ein „Casino“, was auf Italienisch „Häuschen“ heißt. Die vergoldete Löwenfontäne entwarf Baumeister Karl Friedrich Schinkel nach einem Vorbild aus der römischen Villa Medici.
Wo unterschiedliche Stile sich harmonisch verbinden
In Glienicke lebte Prinz Carl seinen Traum vom „Dolce Vita“. Dennoch wollte er sehen, was außerhalb der Mauern passierte. Also entstand in einer Ecke des Gartens die „Große Neugierde“, ein offener Rundpavillon aus 16 Säulen, gekrönt von einer goldfarbenen Schale. Er gewährt Blicke auf die Straße von Berlin nach Potsdam, die schon zu Carls Zeiten gepflastert war, außerdem auf die Havel und die weltberühmte Glienicker Brücke. Während des kalten Kriegs markierte sie die innerdeutsche Grenze und war Schauplatz mehrerer Agentenaustausche. Ab 1989 wurde die Brücke, die Potsdam und Berlin verbindet, zum Symbol überwundener Teilung. Mit dem Verschwinden der Zäune, Wachtürme und Sperranlagen konnte auch das zuvor zerschnittene Ensemble preußischer Schlösser und Gartenanlagen auferstehen.
Über Generationen hatten Carl sowie weitere Fürsten und Könige des Hohenzollern-Geschlechts sie geschaffen und mithilfe spektakulärer Sichtachsen zueinander in Beziehung gesetzt.Mit der Einheit wuchs also auch entlang der Havel wieder zusammen, was zusammengehört. Die Unesco wusste dies zu würdigen: Noch im Jahr der Widervereinigung, 1990, erklärte sie die Potsdam-Berliner Schlösser und Gärten zur Welterbestätte. Die Jury lobte die „Verbindung vermeintlich unvereinbarer Stile zu einem harmonischen Ganzen“ und nannte die Kulturlandschaft ein „außergewöhnliches Beispiel für die Entwicklung von Architektur und Landschaftsgärtnerei in Zusammenhang mit königlicher Macht in Europa“.
Das Gesamtkunstwerk lässt sich seither grenzenlos erschließen, per Rad, auf einer Wanderung oder mit dem Ausflugsschiff. Und auch die Schlösser, zu denen einst nur der Adel und hochrangige Offiziere Zutritt hatten, dürfen heute alle besuchen und bestaunen.
Landschaftsgärten, die wie Natur aussehen sollen
Maike Schulz lädt gerne zum Wandeln durch Schloss Glienicke ein. Die Schlossführerin startet ihre Touren im Innenhof, dessen Wände Prinz Carls Sammlung antiker Ruinenbruchstücke ziert. „Sie stammen unter anderem aus Karthago, Troja und aus den Tempeln von Paestum“, sagt Schulz. Dann geleitet sie die Besucher ins farbenfrohe Schlossinnere, in den Grünen Salon, das türkise Schlafzimmer, die tiefblaue Bibliothek, den Roten Saal samt 14-armigem Kronleuchter und riesigem Reiterbildnis von Carls Vater Friedrich Wilhelm III.
Das Hofgärtnermuseum im Schloss würdigt die wahren Schöpfer der heutigen Welterbestätte, allen voran Peter Joseph Lenné. Der geniale Landschaftsarchitekt wollte Gärten gestalten, die wie natürliche Landschaften wirkten, mit weichen Linien, plätscherndem Wasser, geschwungenen statt schnurgeraden Wegen und sanften Hügeln, die malerische Ausblicke ermöglichten. Alle paar Schritte sollten Besucher im weiten Grün auf neue Entdeckungen stoßen, ein Baumgrüppchen, ein Schlösslein in der Ferne. All diese Ideen finden sich an der Havel verwirklicht. Lenné schuf gleich mehrere der Schlossparks und setzte sie optisch zueinander in Beziehung. „Seine Karriere startete 1816 in Glienicke“, sagt Maike Schulz.
Dank der von den Hofgärtnern ersonnenen Sichtachsen und Blickbeziehungen liegt das nächste Ausflugsziel oft in Sichtweite. Von Glienicke beispielsweise zeigen sich auf einer Bucht im Norden die Sacrower Heilandskirche mit freistehendem Turm, im Süden der Landschaftspark Babelsberg mit geschmückten Gartenterrassen und neogotischem Schloss.
Am Westufer liegt Schloss Sanssouci
Während viele der Welterbe-Bauwerke an den Ufern aufragen, liegt das meistbesuchte, Schloss Sanssouci, am westlichen, flussabgewandten Rand der Potsdamer Innenstadt. Wasser spielt dort trotzdem eine große Rolle. So schießt unterhalb des terrassierten Weinbergs eine majestätische Fontäne auf, im Park plätschern Bassins und Wasserspiele – und natürlich sind auch die betörenden Blütenmeere und Obstquartiere ausgiebig zu bewässern. Manche der Schlösser dienten als Rückzugsorte, andere sollten Preußens Macht und Stärke demonstrieren. Sanssouci erfüllte beide Zwecke: Während Friedrich der Große das nur zwölf Räume zählende Weinbergschloss als privaten Sommersitz und zum Musizieren nutzte, baute er im Westen des Parks das pompöse Neue Palais, das er seine „Fanfaronade“, Prahlerei, nannte.
Wer nach dem Sanssouci-Abstecher wieder Richtung Havel spaziert oder radelt, kann auf dem Rückweg durch Potsdams Zentrum weitere Orte besuchen, die ebenfalls Teil des Welterbes sind: den Jüdischen Friedhof etwa oder die Kolonie Alexandrowka von 1826, ein russisches Kulissendorf, mit dem Friedrich Wilhelm III. an seinen verstorbenen Freund Zar Alexander erinnern wollte. In einem der 13 Holzhäuser findet sich heute ein Museum, in einem weiteren ein Restaurant, das köstlichen Samowartee serviert. Wie die Hohenzollern in ihren Schlössern zu speisen pflegten, verrät das Potsdamer Marmorpalais, das aktuell eine festlich gedeckte Mittagstafel ausstellt.
Pfauen, Wasserbüffel und eine Insel wie aus Träumen
Die vielleicht schönste aller Sichtachsen erlebt man jedoch im Neuen Garten, dem Park ums Schloss: Übers Wasser und durch ein Tor von Bäumen reicht der Blick vier Kilometer weit bis zum eierschalenweißen Märchenschloss auf der Pfaueninsel. Zu dem Lustschloss ließen sich König Friedrich Wilhelm II. und seine Geliebte Wilhelmine Encke im 18. Jahrhundert hinüberrudern. Vor dem Beginn der Renovierungsarbeiten 2017 sei die Fassade „stark verschmutzt“ gewesen, erzählt die Projektrestauratorin Ute Joksch. Pilze und Insekten setzten dem Fachwerkbau zu. Jetzt strahlt das Schloss wieder aus dem Inselgrün hervor. In die Ölfarbe rührten die Maler Sand, damit „das Schloss wie versteinert wirkt“, sagt sie. Die Fassade rekonstruierte man in Anlehnung an ihren ursprünglichen Zustand.
Die Räume hingegen werden vorwiegend konserviert, erklärt Joksch, der Ist-Zustand zukunftsfest gemacht. Die Papiertapeten, der mit Edelhölzern gestaltete Festsaal und das als tahitianische Bambushütte ausgemalte Turmzimmer: Die fast gänzlich erhaltene Inneneinrichtung vermittelt ein authentisches Bild höfischer Wohnkultur. Um den Bau herum unterstreichen ein Rosengarten, urige Eichen und ein verschlungenes Wegenetz die Verträumtheit der Insel. Auf den Wiesen stolzieren Pfauen, im Sommer halten Wasserbüffel das Gras der Insel kurz. So helfen neben Hunderten engagierter Menschen auch Tiere mit, das Potsdam-Berliner Welterbe zu bewahren.
Der besondere Tipp
Für einen Überblick über die Kulturlandschaft bietet sich die „Weltkulturerbefahrt“ der Schifffahrtflotte „Stern und Kreis“ an. Die Tour startet und endet am Berliner Wannsee, in drei Stunden führt sie an Schlössern und Gärten entlang, ein Audioguide liefert Wissenswertes. Unterwegs bestehen mehrere Zu- und Ausstiegsmöglichkeiten.
sternundkreis.de
Welterbe: Potsdam und Berlin
An der Havel in Berlin und Potsdam schufen Preußens Regenten sowie ihre Baumeister und Hofgärtner in mehreren Generationen eine zusammenhängende Landschaft der Schlösser und Parks. Die einzigartige historische und künstlerische Einheit wurde mit dem Mauerfall wiederhergestellt und zählt seit 1990 zum Unesco-Welterbe. Mit rund 2000 Hektar gehört sie zu Deutschlands weitläufigsten Welterbestätten. Die meisten der elf Areale mit den Gärten, Schlössern und Baudenkmälern finden sich in Potsdam, zu Berlin gehören Glienicke und die Pfaueninsel. Die Anlagen lassen sich regulär und in thematischen Sonderführungen besuchen.
spsg.de/schloesser-gaerten/unesco-welterbe