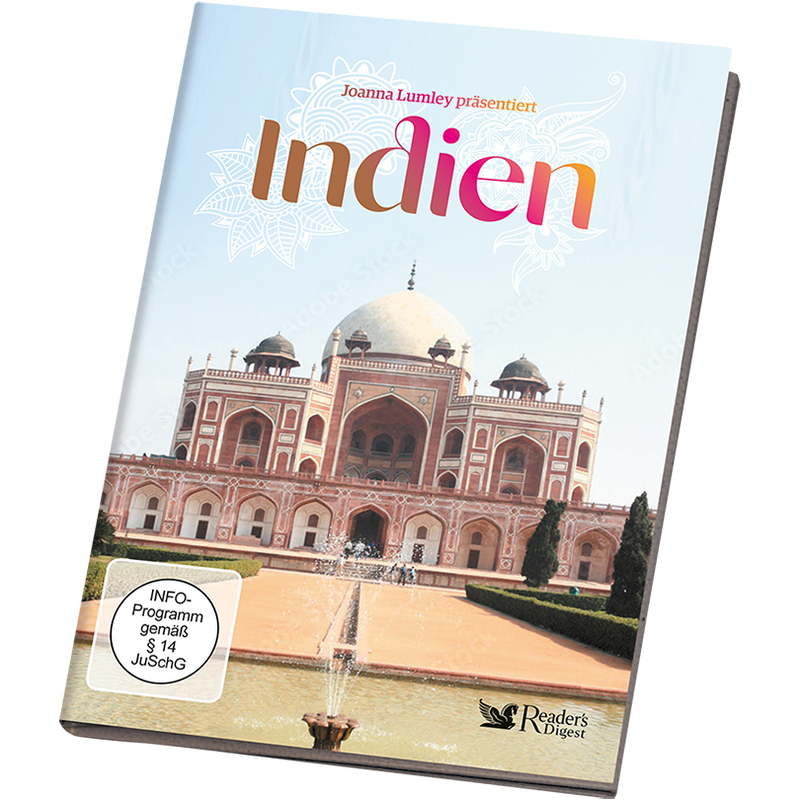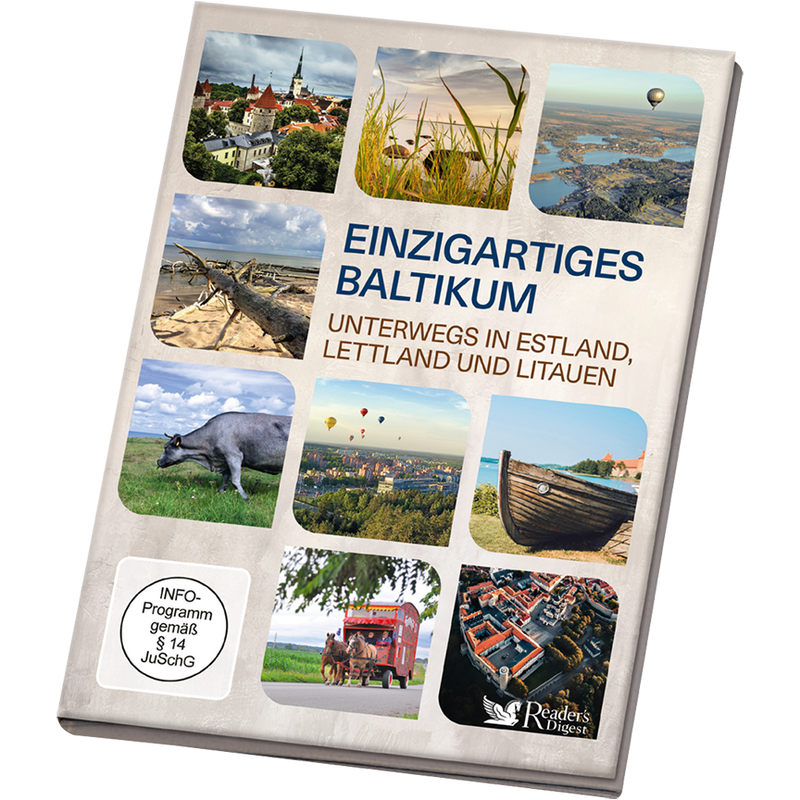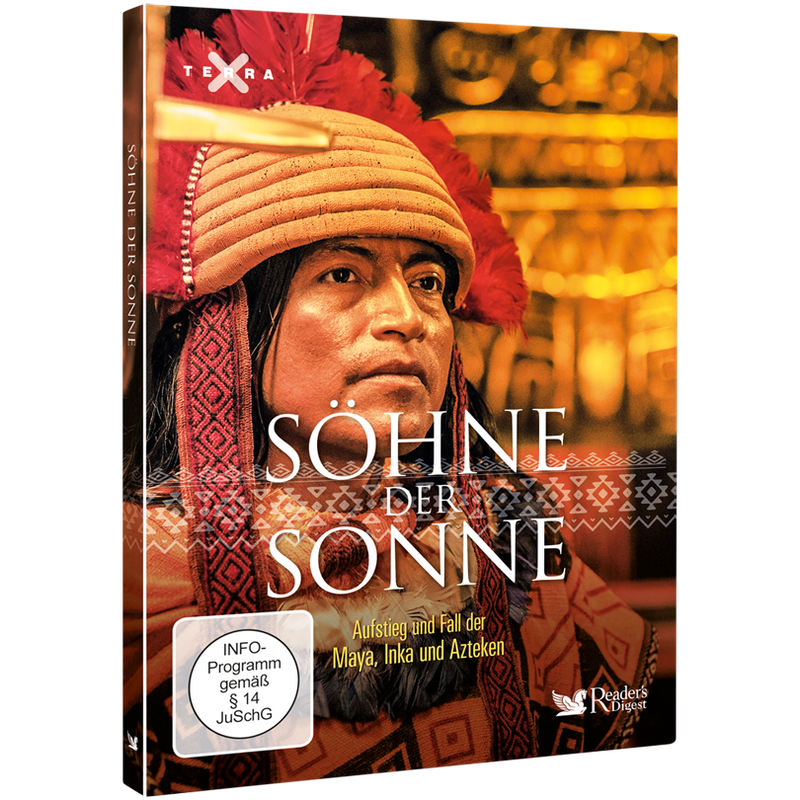Haithabu: Eintauchen ins Leben der Wikinger

©
Kunstvoll geschmiedeter Schmuck, bunt gefärbtes Garn, schimmernde Glasperlen, feine Holzarbeiten: Es ist beeindruckend, was alljährlich beim Sommermarkt und bei der Herbstmesse im Wikinger Museum Haithabu gezeigt wird. „Wie filigran damals schon gearbeitet wurde, das hätte ich nicht gedacht“, sagt ein Besucher, der mit seinen beiden Enkeln das Angebot der Kunsthandwerker bestaunt, die mit Techniken und Materialien wie vor 1000 Jahren arbeiten. Alles ganz schön, scheint der Blick von Felix und Luca, sechs und acht Jahre alt, zu sagen. Doch eine Frage brennt den beiden unter den Nägeln: Wann sehen wir die Männer mit Hörnerhelmen, die grölend ihre Äxte und Schwerter schwingen?
Die Wikinger sind ein Paradebeispiel dafür, wie hartnäckig sich Klischees halten können. „Dieses Bild ist in vielen Köpfen fest verankert“, so Matthias Toplak. Einerseits kann der Museumsleiter das verstehen: „Das Ausleben von Freiheit und Abenteuer, diese urtümliche, unbezähmbare Wildheit, danach sehnen wir uns in der heutigen Zeit wahrscheinlich alle ein bisschen.“ Andererseits wird die Vorstellung, dass es sich bei den Wikingern um halbwilde Barbaren handelte, den Tatsachen nicht gerecht.
In Haithabu lebte die Oberschicht der Wikinger
Der Hörnerhelm auf dem Wikingerkopf ist eine Erfindung von Richard Wagner, der die nordischen Helden in seinem Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ damit ausstattete, um sie besonders kriegerisch wirken zu lassen. Zwar bezeichnet das Wort Wikinger die Tätigkeit, auf Raubzug zu gehen. Die allermeisten waren aber Bauern, Fischer, Handwerker oder Händler. Wie sie damals wohnten, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienten und in welchen internationalen Handelsbeziehungen sie standen – das weiß man wohl nirgendwo so gut wie in Haithabu bei Schleswig im nördlichen Schleswig-Holstein. Erste Belege einer Ansiedlung an dieser Stelle reichen bis ins 8. Jahrhundert zurück. Hier lebte die Oberschicht der Wikingerzeit. Um 1900 begann man hier mit Ausgrabungen. Im Jahr 2018 bekam das Gebiet zusammen mit dem Grenzwall Danewerk als einzigartiges Zeugnis den Welterbe-Status der Unesco verliehen.
Die Lage war strategisch exzellent: an der zentralen Nord-Süd-Verbindung, dem Heerweg, gelegen und zugleich an der damaligen Südgrenze des dänischen Reichs. Gen Westen war Haithabu über Flüsse mit der Nordsee verbunden und über den Ostseearm Schlei an die baltischen Handelsräume angeschlossen. Der kurze Landweg bis zu den Wasserstraßen im Westen wurde durch das Danewerk geschützt. Diese über Jahrhunderte ausgebaute dänische Grenzbefestigung ist heute das größte archäologische Bodendenkmal Nordeuropas. „Haithabu saß wie eine Spinne im Handelsnetzwerk der Wikinger“, erklärt Matthias Toplak. „Der Warenverkehr zwischen Nordeuropa und dem Rest der Welt lief damals fast komplett über diesen Ort. Seide aus China, Quecksilber aus Zentralasien, Speckstein aus Norwegen: Hier kam alles zusammen.“
Ein riesiger Handelsplatz erzählt von der Bedeutung
Ein kundiger Begleiter mit Begeisterung für die Wikinger sowie ein gutes Vorstellungsvermögen schaden nicht, wenn man sich in Haithabu auf Spurensuche begibt. Das Museum zeigt Originalfunde vom Schiffswrack bis zum Goldschmuck. Doch so richtig nähert man sich der Wikingerzeit erst beim Spaziergang durch die sich anschließende, vermeintlich unberührte Natur. Im Sommer schwirren dort Insekten über den Wiesen, auf dem Binnensee Haddebyer Noor, der mit der Schlei verbunden ist, dümpeln Gänse, Fasane suchen Deckung in den für Schleswig-Holstein so typischen Wallhecken, den Knicks. „All das ist Haithabu“, schwärmt Matthias Toplak und zeigt vom neun Meter hohen Halbkreiswall, der den Handelsplatz mit seinen 600 Metern Durchmesser umgab, auf eine bebaute Fläche mit sieben rekonstruierten Häusern und einem Anlegesteg.
Doch 95 Prozent dessen, was man inzwischen per Bodenradar und Geomagnetik identifiziert hat, liegen noch unter der Erde. „Hier lebten bis zu 3000 Menschen. Es gab einen Prachtboulevard, an dem die Kaufleute ihre Häuser hatten, und etliche Werkstätten (...)
Hier das daheim-Abo bestellen und den gesamten Artikel lesen: