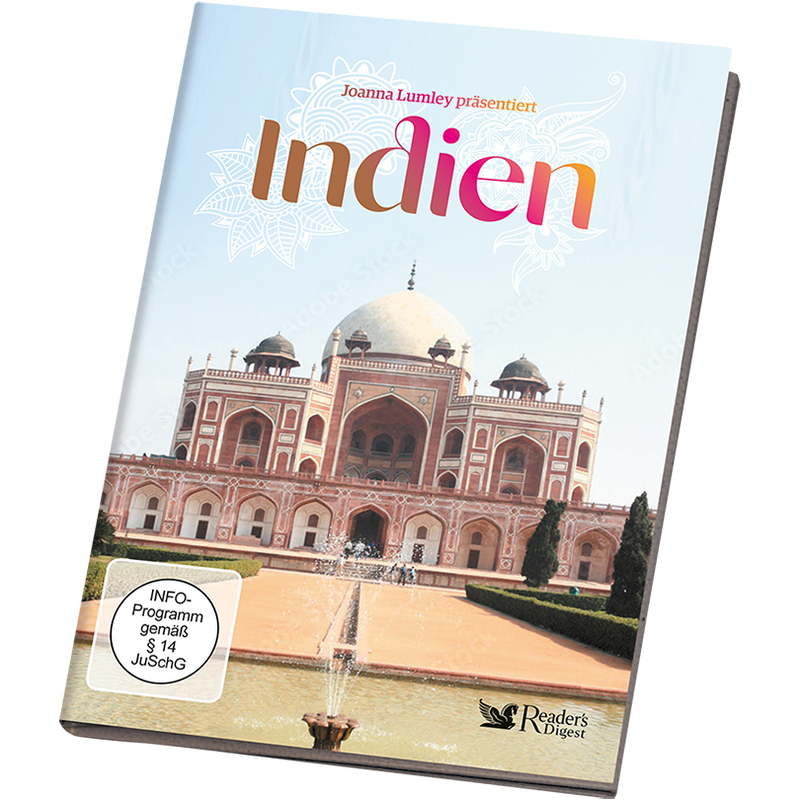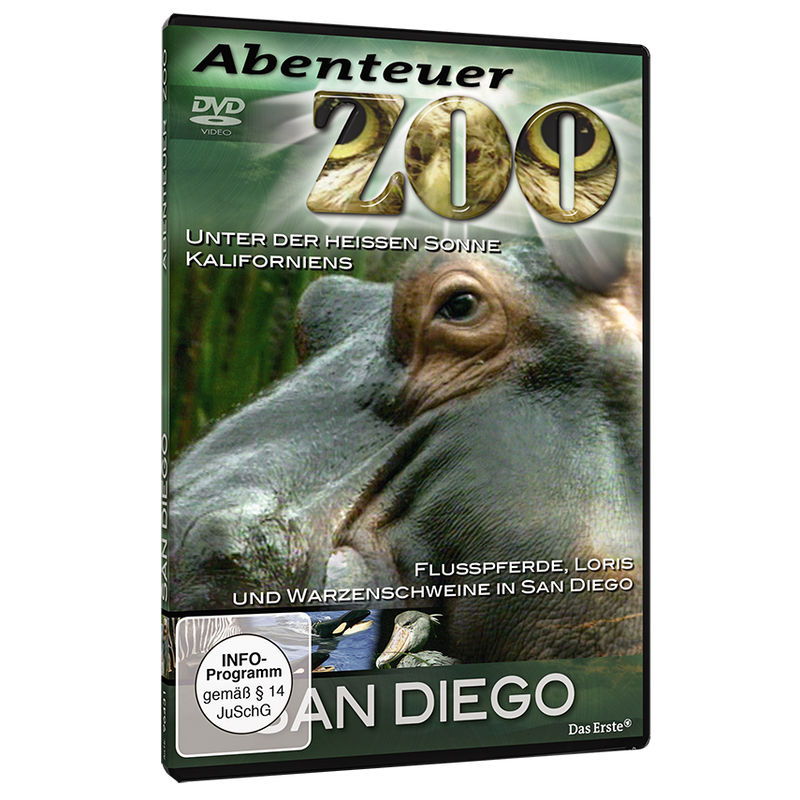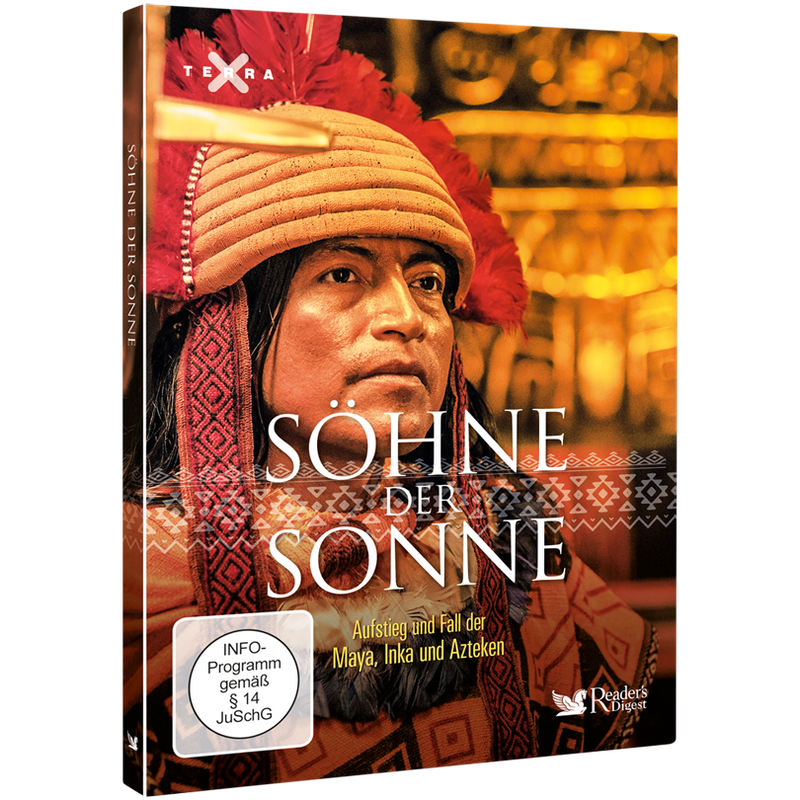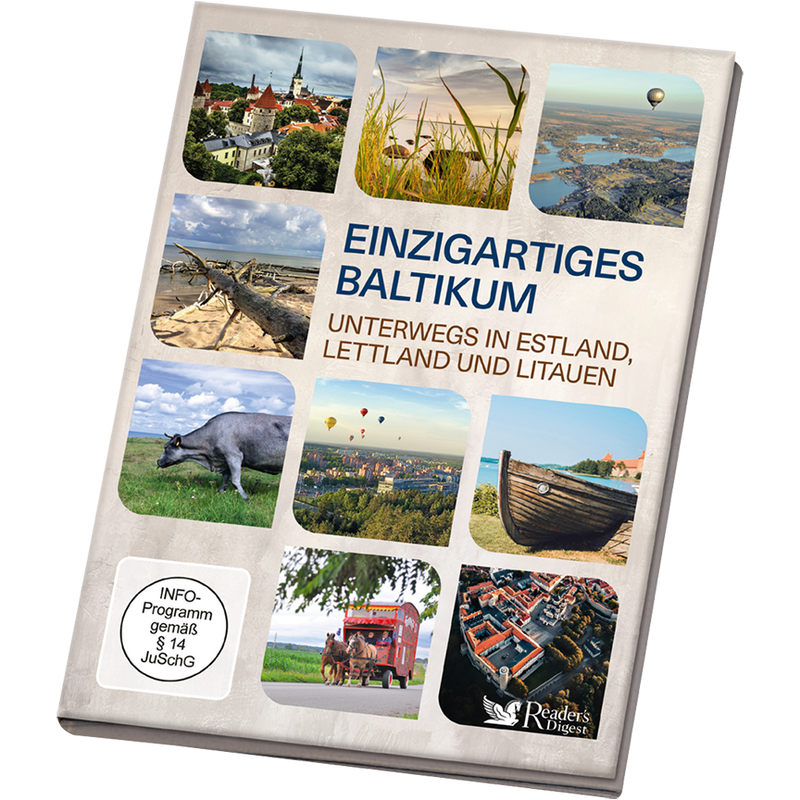Heidelberg, eine Stadt zum Verlieben
Nicht nur Studenten verlieren hier ihr Herz. Sie halten die Altstadt von Heidelberg jung. Man begegnet ihnen auf Schritt und Tritt. Ein buntes Völkchen, das Tag und Nacht unterwegs ist.

©
Der Klavierspieler greift in die Tasten und stimmt „Wütend wälzt sich einst im Bette Kurfürst Friedrich von der Pfalz“ an. Ein uraltes Studentenlied, gespielt in einem der traditionsreichsten Lokale Heidelbergs, dem Roten Ochsen. Hier trafen sich früher die Verbindungen, tranken Bier, sinnierten über die Welt, ritzten ihre Botschaften in die Tische. Dreimal in der Woche lässt Wirt Philipp Spengel diese Zeiten wieder aufleben. Zwischen alten Trinkhörnern, Fechthelmen und historischen Fotografien bekommen die Gäste von heute Studentenlieder aus der Vergangenheit serviert. Seit 185 Jahren betreibt Familie Spengel das Gasthaus. Großeltern und Urgroßeltern haben die bewegten Zeiten der Burschenschaften noch miterlebt. „Ein kostbares Erbe“, sagt Philipp Spengel und schlägt eines der Gästebücher auf, in denen sich die Studenten kunstvoll verewigt haben. Heidelberg ist die älteste Studentenstadt Deutschlands. Vor mehr als 600 Jahren wurde die Universität vom pfälzischen Kurfürsten Ruprecht I. gegründet. 1803 gab ihr der badische Markgraf Karl Friedrich eine neue Organisationsstruktur, weshalb sie den Namen beider Landesherrn trägt: RuprechtKarls-Universität.
Ein Fünftel der Studenten kommt aus dem Ausland
30 .000 junge Männer und Frauen studieren heute dort, ein Fünftel von ihnen kommt aus dem Ausland. Tian zum Beispiel aus China. Genussvoll isst er sein Schnitzel in der Mensa im historischen Marstall. Der schmucke Gewölbebau aus dem Spätmittelalter beherbergt auch das Studierendenwerk. Teile der Verwaltung, die Juristen und die Geisteswissenschaftler sind in der Altstadt geblieben. Tian studiert Geschichte, im fünften Semester, wie er in fast akzentfreiem Deutsch anmerkt. Die Studenten halten die Altstadt von Heidelberg jung. Man begegnet ihnen auf Schritt und Tritt. Ein buntes Völkchen, das Tag und Nacht unterwegs ist. In der Unteren Straße haben sie ihre Kneipen: die Destille, den Grünen Engel, die Sonderbar, die ihren Gästen „betreutes Trinken“ verspricht. Da kann es auch mal hoch hergehen.
Strafe mit Spaßfaktor im Studentenkarzer
Schon in der Vergangenheit hatten die wilden Gesellen unter den Studenten ihren Ruf weg. Die besseren Bürger fürchteten um ihre Töchter, weshalb diese das Haus nur in Begleitung einer Gouvernante verlassen durften. Der Konditormeister Fridolin Knösel witterte dabei ein Geschäft und verpackte eine Nougatpraline so luftig, dass darin Platz für geheime Liebesbotschaften war. Sein Caféhaus wurde zu einer Kontaktbörse für junge Leute, und der Studentenkuss in Schokoladenform zu einem der Markenzeichen Heidelbergs. Man bekommt ihn noch heute in der Originalverpackung, die zwei Personen zeigt, die sich vorsichtig näher kommen.
Bis 1899 durften ausschließlich Männer studieren. 1900 schrieben sich dann die ersten vier jungen Damen an der Hochschule ein – eine Sensation. Sie waren noch sehr zurückhaltend und kamen auch nicht in den Studentenkarzer, das Universitätsgefängnis. Um die Wende zum 20. Jahrhundert gehörte es fast schon zum guten Ton, dort ein paar Tage abzusitzen. Aus einer gefürchteten Haftanstalt war ein Gaudiort geworden mit solch laxen Regeln, dass selbst Touristen die Verurteilten besuchen durften. Den Karzer kann man besichtigen. Er ist Teil des Universitätsmuseums und ein Ort mit hohem Unterhaltungswert. Vor allem die Wandmalereien und Sprüche haben es in sich, großformatige Kunstwerke, in denen sich die Herren Studenten genüsslich über den Grund ihrer Inhaftierung ausließen. „Wir sitzen hier unschuldig als Märtyrer der Ehrlichkeit“, klagten im Juni 1901 fünf Spitzbuben der Burschenschaft Alemannia. Um dann in aller Ausführlichkeit darzustellen, wie sie als grundanständige Bürger der Polizei zufällig gefundene Pflastersteine überantworteten – indem sie diese durchs Fenster der örtlichen Wache warfen. Zwischenfälle dieser Art passieren inzwischen nicht mehr so häufig, auch wenn es hinter den Türen mancher Burschenschaft noch immer recht rau zugeht. 30 schlagende und nichtschlagende Studentenverbindungen gibt es in Heidelberg. Sie sind über die gesamte Altstadt verteilt und tragen Namen wie Zaringia, Rupertia und Frankonia. An ihren schmucken Häusern wehen Flaggen.
Heute hat Heidelberg 150. 000 Einwohner. Da fallen 30 .000 Studenten ordentlich ins Gewicht. Einige der schönsten Gebäude der Stadt dienen ihrer Ausbildung. Die Universitätsbibliothek (UB) aus dem Jahr 1906 etwa, ein Bauwerk des Späthistorismus mit Elementen des Jugendstils und der französischen Renaissance. 3,2 Millionen Medien lagern dort, von Büchern zu sprechen, trifft heute nicht mehr die Realität. Zu den größten Schätzen der UB gehört der Codex Manesse, die umfangreichste Sammlung mittelalterlicher Lieder und Verse aus dem deutschsprachigen Raum. Das Werk entstand um 1300 und kam über Umwege nach Heidelberg. „Das Original liegt im Tresor, das können Sie nicht anschauen“, sagt die Frau am Informationsschalter und verweist auf ein Faksimile, eine originalgetreue Nachbildung, die man nach Voranmeldung einsehen darf.
Flanieren und flirten auf dem Philosophenweg
Dorothea und Susanne können damit nichts anfangen. Gerade haben sie fünf Stunden in der Bibliothek verbracht, um die nächste Klausur vorzubereiten. Zahnmedizin ist ihr Studienfach. Lokalanästhesie statt Liebeslyrik. In der Uni-Bibliothek sind sie gerne. „Ein guter Ort zum Lernen, zu Hause wird man ja doch nur abgelenkt.“ Der stete Wunsch nach Zerstreuung, ihn gibt es heute wie damals. Als die Studenten im 19. Jahrhundert auf der anderen Seite des Neckars flanierten und die Aussicht aufs Schloss genossen, kamen sie den Einheimischen wie altkluge Philosophen vor. Irgendwann hieß der aussichtsreiche Pfad Philosophenweg. Der Schriftsteller Joseph Eichendorff spazierte hier entlang, ebenso der Dichter Friedrich Hölderlin. An beide erinnern Gedenksteine. Dank günstiger Fallwinde und dem Kälteblocker Neckar herrscht am Philosophenhang ein fast mediterranes Klima. Zwischen Palmen, Jasmin und Lorbeer lässt es sich dort gut aushalten. Ein idealer Ort für einen Studentenkuss, mit oder ohne Schokolade.