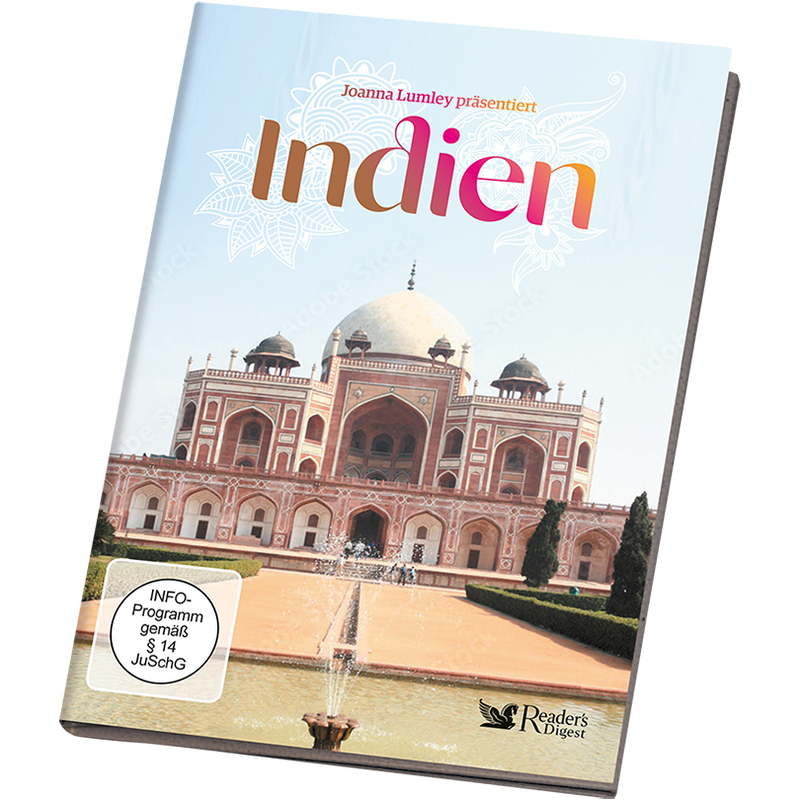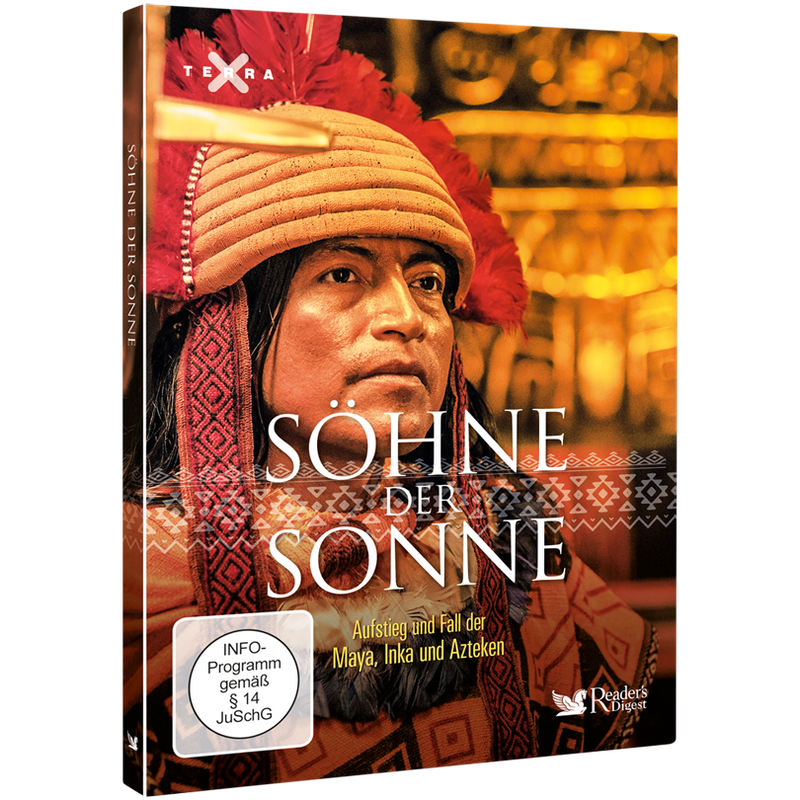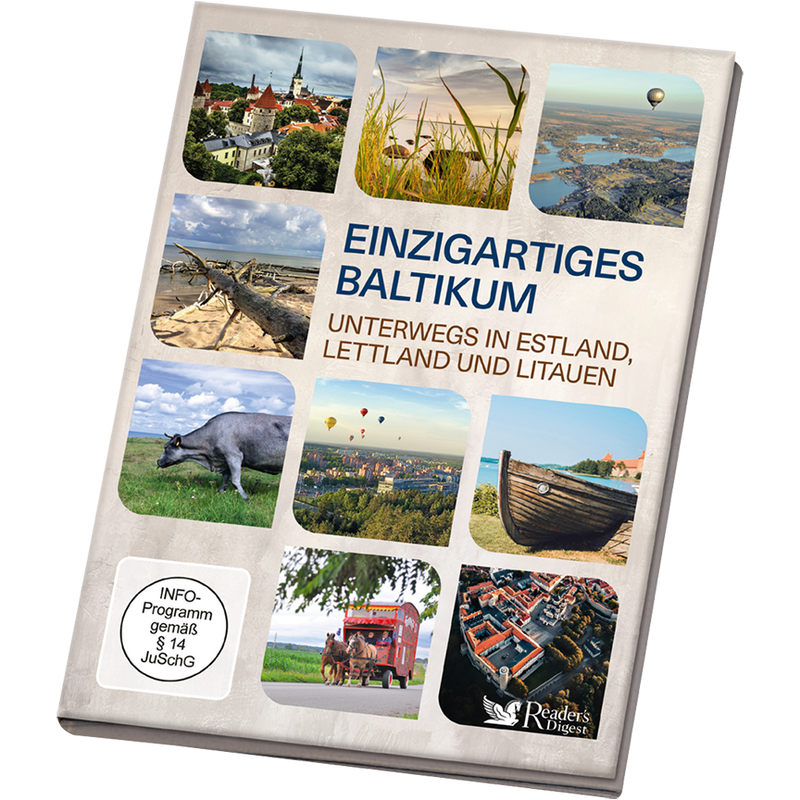Per Eisenbahn quer durch Württemberg
Die einzige besungene Zugstrecke Deutschlands führt von Stuttgart nach Friedrichshafen einmal quer durch Baden-Württemberg.

©
Württemberg 1816: Ochsenkarren und Pferdekutschen rumpelten durch das bäuerlich geprägte Königreich im Südwesten Deutschlands. Vom wirtschaftsstarken Land der cleveren Erfinder war es noch meilenweit entfernt. Doch dann kam Wilhelm I. an die Macht, und der König trieb einiges voran, auch den Bau der Eisenbahn. Im Juli 1850 konnte die erste durchgehende württembergische Strecke von Heilbronn nach Friedrichshafen eröffnet werden. Sie führte von Nord nach Süd einmal quer durchs Ländle. Was diese Route so besonders macht: Sie besitzt eine eigene Hymne, die nicht nur die Linie besingt, sondern auf liebevoll spöttische Weise auch die Seele der Schwaben beleuchtet.
Auf de Schwäbsche Eisebahne
gibt’s gar viele Haltstatione
Stuagert, Ulm und Biberach,
Meckebeura, Durlesbach.
Lange wurde das Lied nur mündlich überliefert und hat somit keinen Verfasser. Im Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg befinden sich 100 verschiedene Versionen. Die wohl bekannteste handelt von dem Bäuerlein, das seinen Geißbock an den hinteren Wagen bindet – mit unangenehmen Folgen für das Tier. Beim nächsten Halt findet der Mann nur noch den Kopf am Seil vor. 30 Kilometer pro Stunde sind selbst für eine sportliche Ziege zu rasant. Und so entlädt sich in den Strophen reichlich Schadenfreude über die ländliche Rückständigkeit und Sparsamkeit der sturen Schwaben. Denn:
Auf de Schwäbsche Eisebahne
dürfet Küh und Ochse fahre
Büble, Mädle, Weib und Ma
Älles was no zahle ka.
Die besungene Linie gibt es heute noch. Als RE5 fährt sie in einem Zug von Stuttgart über Ulm, Biberach – Achtung! – Durlesbach und Meckenbeuren nach Friedrichshafen. Tatsächlich verdreht das Lied die Reihenfolge zweier Bahnhöfe. Denn Durlesbach reimt sich einfach so viel besser auf Biberach.
Los geht’s in Stuttgart, in dessen Talkessellage Sommernächte mit 25 Grad Celsius keine Seltenheit sind. Tagsüber rasten die Menschen dann auf den Grünflächen des schönen Schlossplatzes, umgeben von Renaissanceschloss, Barockresidenz, Gründerzeitbauten und dem modernen gläsernen Kunstmuseum, flüchten sich in die Mineralbäder oder in die Jugendstil-Markthalle, in der es nach Märkten des Südens duftet. Typisch für die Stadt sind die Weinberge an ihren Hängen. Zu allen Seiten geht es dort bergauf, doch bald, bald – also irgendwann – am Bahnhof auch ganz tief nach unten. Die gefühlt 100-jährige Großbaustelle macht es Reisenden nicht gerade leicht. Denn vom Bahnhofsgebäude zu den Gleisen müssen sie einen „innerstädtischen Fernwanderweg“ bewältigen.
Wie kommt der Zug auf die Alb hinauf?
Der Regionalexpress fährt hinaus in die Metropolregion: Cannstatt, Esslingen, Geislingen. Durch den Eisenbahnbau erlebte sie ihren ersten industriellen Aufschwung mit Firmen wie Bosch, Daimler und WMF. Kurz vor Geislingen tauchen die Höhenzüge der Schwäbischen Alb auf. Dort standen die Lokomotiven vor einem Riesenproblem: Sie schafften den Aufstieg nicht. Das Lied von der Schwäbischen Eisenbahn haben so einige Postkartenmaler verarbeitet. In einer dieser humorvollen Wimmelkarten müssen an der Geislinger Steige alle aussteigen, schieben und ziehen – auch der Ochse, der im Gegensatz zum Geißbock als zahlender Passagier mitfährt. Lange halfen spezielle Bergloks den Zügen auf die Albhochfläche, und noch heute bekommen Güterzüge Schiebehilfe.
Vater und Tochter, im Zug unterwegs nach Ravensburg, wissen, dass sie sich auf der Strecke der Schwäbischen Eisenbahn befinden. „Wir nehmen oft die E-Bikes mit und radeln dann über die wunderschöne Alb“, erzählt der Mann. Das raue Mittelgebirge mit seiner steilen Felskante, dem Albtrauf, ist eine Schatzkiste der Natur und Kultur. Vulkane, Höhlen, tiefblaue Quelltöpfe, Versteinerungen aus dem Jurameer sowie 40.000 Jahre alte Eiszeitkunst, ein Unesco-Welterbe, lassen sich dort entdecken. Auf einem Bergkegel thront die Burg Hohenzollern, das schwäbische Neuschwanstein. Und mehr als 90 Prädikatswanderwege führen über Streuobstwiesen und Wacholderheiden, durch Trockentäler und immer wieder zu traumhaften Aussichten.
Der Zug kriecht die Geislinger Steige hinauf und fährt kurz danach in Ulm ein. Die Donaustadt ist ein Ort der Superlative – zumindest, was das Münster angeht. Sein Turm ist der höchste der Welt. Es gibt aber noch mehr Gründe auszusteigen: Das Rathaus setzt sich mit seinem opulent bemalten Kleid aus der Frührenaissance in Szene. Und in der Kunsthalle Weishaupt hat vorübergehend ein kleiner Gigant Zuflucht gefunden. Aufrecht und würdevoll begegnet die 31 Zentimeter große Figur eines Löwenmenschen aus der Eiszeit den staunenden Blicken der Besucher.
Krumm und buckelig kommt hingegen das malerische Fischerviertel am Flüsschen Blau daher mit engen Gässchen, uraltem Fachwerk und dem schiefen Haus – ein rechter Pfusch am Bau, dessen historische Schräglage nun stabil konserviert ist. Auf der Stadtmauer treffen sich die Flaneure mit Blick auf die Donauwiesen. Diese werden zu Logenplätzen, wenn am 22. Juli wieder das traditionelle „Nabada“ stattfindet, ein bunter Festzug auf dem Fluss mit Themenbooten – schwäbischer Karneval im Sommer.
Weiter geht's nach Oberschwaben
Südlich von Ulm beginnt Oberschwaben, das Himmelreich des Barock mit seinen Klöstern, Kirchen und Schlössern. Mittendrin: Biberach. Mittwochs und samstags findet in der Stadt mit ihren prächtigen Bürgerhäusern ein wuseliger Wochenmarkt statt. „Probieren Sie eine oberschwäbische Seele“, sagt die Frau am Bäckerstand. Man kann sich diese direkt einverleiben. Außen kross, innen weich – ein mit Salz und Kümmel bestreutes Gebäck und ein leckerer Seelentröster (siehe Seite 26), wenn es mit der Bahn mal wieder nicht so läuft, wie es soll. Auf die wird ja viel geschimpft, doch wer meint, früher sei alles besser gewesen, der müsste bei dem Lied von der Schwäbischen Eisenbahn und den Bildpostkarten nachdenklich werden. Auf einer dieser Karten zeigt die Tafel am Bahnsteig sage und schreibe 24 Stunden Verspätung an! Und die Fahrgäste ärgerten sich schon in den Anfängen der Eisenbahn wie der wütende Bauer:
Do kriegt er en große Zorne,
nimmt de Kopf mitsamt dem Horne,
schmeißt en, was er schmeiße ka,
dem Konduktör an Schädel na.
Mal ist es Durlesbach, mal Meckenbeuren, mal Friedrichshafen, wo der Bauer das traurige Ende seines Ziegenbocks bemerkt. Der kleine Bahnhof Durlesbach im schönen Schussental bei Bad Waldsee, einst auch Halt für die Ordensschwestern des Klosters Reute, wird schon lange nicht mehr angefahren. Doch eine Skulpturengruppe mit Bauer, Ziegenbock und Schaffner erinnert weiterhin an das Lied von der Schwäbischen Eisenbahn. Sie ist vom Zug aus zu sehen.
Die Meckenbeurer feiern jedes Jahr im August ein Bahnhofsfest, bei dem eine Familie mit Geißbock im Zug einfährt und alle gemeinsam das Lied „Auf de Schwäbsche Eisebahne“ anstimmen.
In Friedrichshafen ist Endstation und das schwäbische Fitzelchen Bodensee, der witzigerweise Schwäbisches Meer genannt wird, erreicht. Zwischen Aulendorf und der Zeppelinstadt fährt übrigens ein blauer Zug mit Ziegenkopf als Logo. Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn – hervorgegangen aus einem Aufstand sturer Schwaben – wird liebevoll Geißbockbahn genannt.