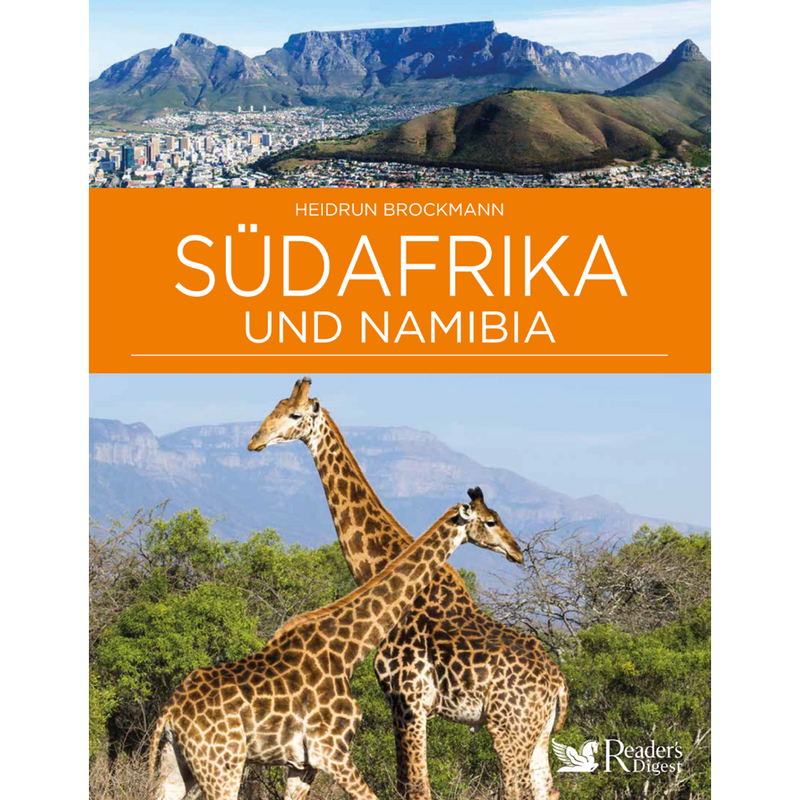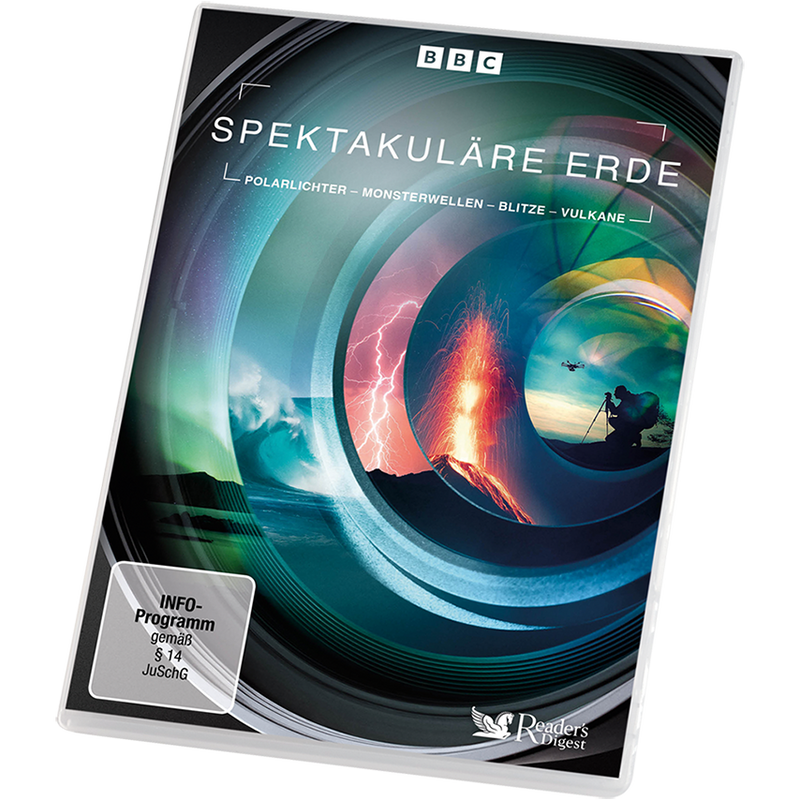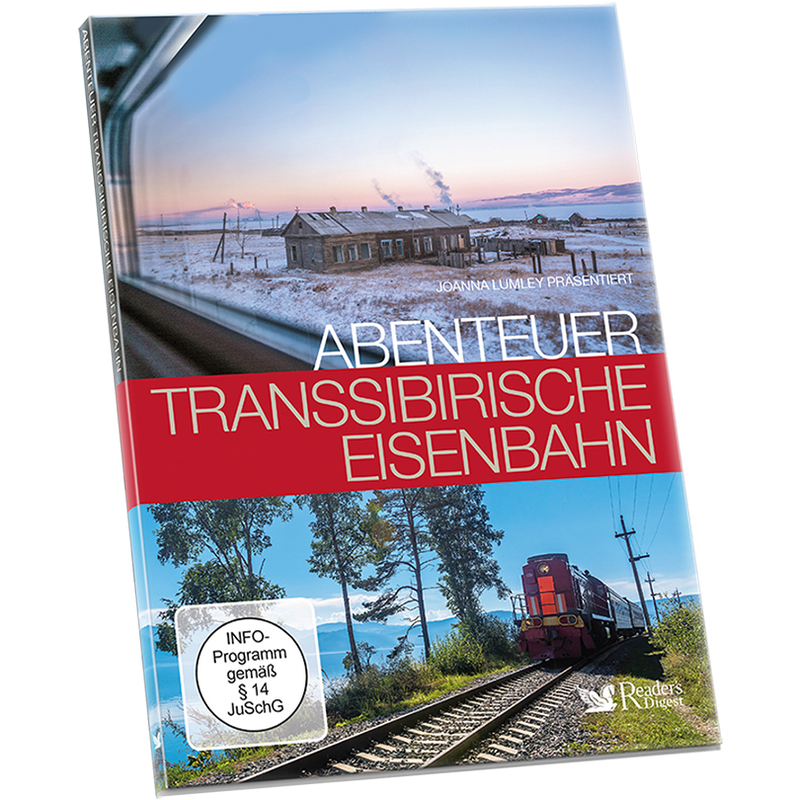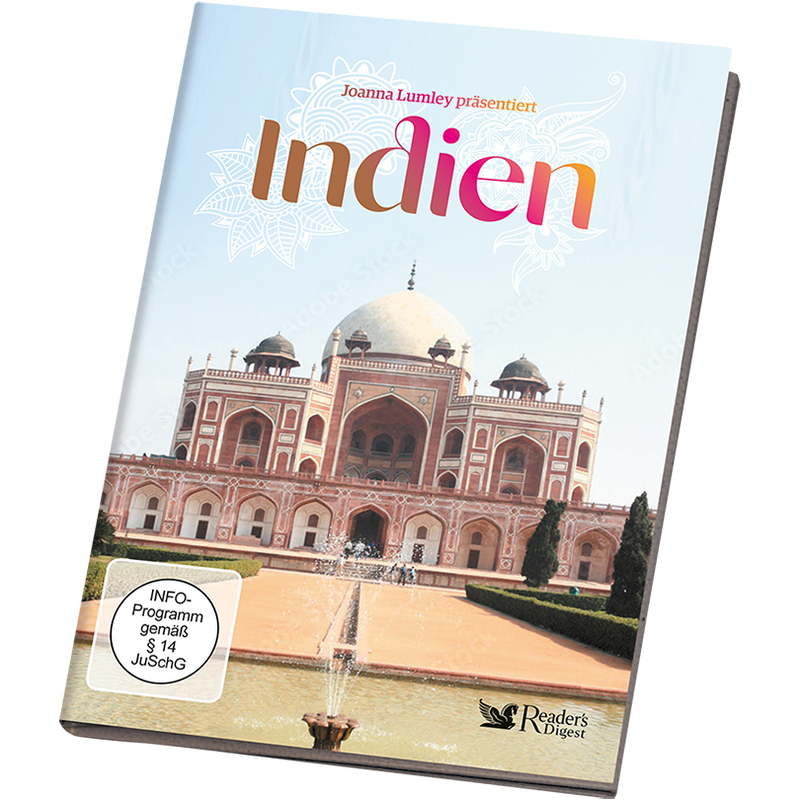Wo die junge Donau plötzlich versickert

©
Goldgelb leuchtet das Kloster Beuron in der grünen Wiesenlandschaft. Eine einsame Abtei im Oberen Donautal, die fast so abgeschieden liegt wie vor 250 Jahren. Auf beiden Seiten ragen schroffe Felsen empor, rahmen die Szenerie ein, als ob ein Künstler der Romantik sie geformt hätte. Der Wandel der Zeiten – um Beuron scheint er irgendwie einen Bogen gemacht zu haben. Das Kloster befindet sich am Donaudurchbruch im Süden Baden-Württembergs zwischen Tuttlingen und Sigmaringen, der Schwäbischen Alb und dem Bodensee (nicht zu verwechseln mit der Weltenburger Enge, auch Donaudurchbruch Weltenburg genannt). Hier bahnt sich die junge Donau ihren Weg durch Kalksteinfelsen und hinterlässt ein urwüchsiges Tal, in dem der Fluss in seinem alten Bett mäandern darf. Ein faszinierendes Landschaftsbild, das sich am Aussichtspunkt Knopfmacherfelsen in seiner ganzen Pracht entfaltet.
Der Abschnitt um Beuron ist auch deswegen so schön, weil ab hier die Straße nicht mehr am Fluss entlangführt. Das zehn Kilometer lange Stück zwischen Fridingen und dem Kloster blieb von der modernen Zivilisation verschont. Hier brüten Uhu und Kolkrabe, bauen Biber ihre Dämme und streifen Luchse durchs Unterholz. Bereits 1980 wurde der Naturpark Oberes Donautal gegründet. Ein ländliches Gebiet mehr als halb so groß wie das Saarland, mit 1500 Quadratkilometern Fläche, aber nur 120.000 Einwohnern – kaum ein Drittel des bundesrepublikanischen Durchschnitts.
Mönche, Radfahrer, Kanuten: Sie suchen die Stille der Natur
Es war auch diese Landschaft, die Pater Albert einst bewog, ins Kloster Beuron einzutreten. Der 76-Jährige ist einer von 32 Benediktinermönchen, die es hier noch gibt. 1967 kam er ins Obere Donautal, ein Stadtkind aus Freiburg, das sich jedoch bald heimisch fühlte. „Die Stille, die Natur, die Gottesdienste, alles hat für mich gepasst“, sagt er rückblickend mit einem Lächeln. Er trägt ein schwarzes Habit, wie das Benediktinergewand auch heißt, und schreitet andächtig durch die weiten Flure. Zu Spitzenzeiten gab es hier 350 Mönche. Als Pater Albert eintrat, waren es immer noch 120. Nun werden es jährlich weniger, doch Beuron gehört nach wie vor zu den größten Abteien in Deutschland. „Von hier aus“, sagt Pater Albert, „wurden viele Klöster neu gegründet.“ Maria Laach in der Eifel etwa oder erst jüngst die benediktinische Cella auf der Bodenseeinsel Reichenau.
Pater Albert hat viele Aufgaben im Kloster Beuron: Er gibt eine Zeitschrift für Benediktiner heraus, leitet Einkehrkurse und steht den jüngeren Mönchen mit Rat und Tat zur Seite. Ein wichtiger Teil seines Lebens sind die Gottesdienste und Gebete, Besucher dürfen sie in der großen Kirche miterleben. Es herrscht dort eine ganz besondere Atmosphäre. Gerne geht Pater Albert auch spazieren: „Nicht nur im Tal, auch die Hochfläche ist sehr schön.“ Der Mönch liebt sie wegen der Aussicht, die im Süden des Naturparks bis zu den Alpen und dem Bodensee reicht. Den weiten Horizont wussten die Benediktiner trotz aller Abgeschiedenheit seit jeher zu schätzen.
Rund 40 Aussichtspunkte zählt der Naturpark. Zu den spektakulärsten gehört der Eichfelsen bei Irndorf. Einer von vielen zertifizierten Wegen führt dort hin – die Berge rund ums Donautal sind eine beliebte Wandergegend. Das Tal wiederum ist bei Kanufahrern und Radlern heiß begehrt: Der Donauradweg zählt zu den populärsten deutschen Fahrradrouten, an schönen Wochenendtagen sind hier Tausende unterwegs.
Der Sommer lässt einen ganzen Fluss verschwinden
Dann kann es auch rund um Beuron sehr trubelig werden, fast wie bei einer Wallfahrt, nur dass die Radler eher eine Einkehr für den Leib als für die Seele suchen. Auf ihrem sommerlichen Weg entlang der Donau stutzen sie zuweilen. Das Wasser – es ist plötzlich verschwunden! Der Fluss, in dem man gerade noch die müden Beine gekühlt hat, staubt plötzlich wie eine Wüstenlandschaft. Donauversickerung oder mitunter auch Donauversinkung nennt man dieses Phänomen. Zwischen den Tuttlinger Ortsteilen Immendingen und Möhringen verschwindet der Fluss einfach unter der Oberfläche. Sein Wasser gurgelt davon, als ob jemand den Stöpsel gezogen hätte. An rund 200 Tagen im Jahr fällt die Donau auf fünf Kilometern Strecke komplett trocken, vorzugsweise im Sommer natürlich.
Annemarie Atzrodt (72) ist am Flussufer in Immendingen aufgewachsen. Als kleines Kind spielte sie im trockenen Donaubett, sammelte Fossilien und sah zu, wie ihr Fluss jedes Jahr regelmäßig leerlief. Heute bietet die ehemalige Bankangestellte Führungen an der Donauversickerung an. „Man darf nicht denken, dass das alles an einer anderen Stelle der Donau wieder hochkommt“, sagt sie, „es ist komplizierter.“ In Immendingen versickert das Donauwasser und taucht an der 14 Kilometer südlich gelegenen Aachquelle wieder auf. Versuche mit gefärbtem Wasser haben ergeben, dass das Wasser rund zwei Tage unterwegs ist.
Diese Aach jedoch fließt nicht zurück in die Donau, sondern in Richtung Rhein und Bodensee. Ein unterirdisches Gefälle macht das möglich sowie ein Untergrund, der löchrig ist wie ein Schweizer Käse. „Es ist weltweit einmalig, dass ein Fluss in zwei verschiedene Meere mündet“, sagt Annemarie Atzrodt nicht ohne Stolz.
Burgen und Schlösser thronen über einsamen Bauerndörfern
Die unterirdische Donau macht sich über den Rhein auf in die Nordsee, die überirdische, die an den übrigen rund 160 wassereichen Tagen das Flussbett feucht hält, fließt ins Schwarze Meer. „Im Grunde“, sagt Annemarie Atzrodt, „entspringt in der Trockenzeit die Donau erst in Tuttlingen.“ Gespeist von den Zuflüssen Elta und Krähenbach wird von Mai bis Oktober dort ein ganz eigener Fluss geformt. Da staunen die Gäste nicht schlecht. Viele von ihnen kommen aus den Donaustädten Wien und Linz, um sich dieses geologische Phänomen erklären zu lassen. Die Natur hält sich eben nicht an menschliche Zuordnungen von Flusssystemen.
In den heißen Monaten ist das Donaubergland eine schöne Sommerfrische. Um die 900 Meter liegen die Hänge jenseits des Flussufers hoch. Das Gebiet im Nordwesten des Naturparks wird auch als Region der „Zehn Tausender“ beworben. Zehn Gipfel erreichen nämlich mehr als 1000 Höhenmeter, darunter der 1015,7 Meter hohe Lemberg, die höchste Erhebung der Schwäbischen Alb. Von seinem Aussichtsturm hat man einen Panoramablick ins weite Umland.
Die erhabene Lage auf den Felsen des Flusstals lockte im Mittelalter auch die Ritter und Burggrafen an. Viele ihrer Pracht- und Wehrbauten thronen heute noch dort: Schloss Werenwag etwa oder Burg Wildenstein, in der eine Jugendherberge untergebracht ist. Majestätisch ist auch die Lage von Schloss Sigmaringen, das sich noch im Eigentum der Hohenzollern befindet.
Sigmaringen mit 16.000 und Tuttlingen mit 35.000 Einwohnern sind die mit Abstand größten Städte im Naturpark Oberes Donautal – einer ländlichen Gegend mit Streuobstwiesen, einsamen Bauerndörfern, Kuhweiden und Schafherden, die über die Wacholderheiden ziehen. Auf denen blühen im Sommer Silberdistel, Küchenschelle, Thymian und Enzian, umschwärmt von Bienenvölkern, die köstlichen Honig liefern.
Bis vor Kurzem hatte auch das Kloster Beuron noch eine eigene Imkerei, liebevoll betrieben von Bruder Siegfried, der vor zwei Jahren starb. Pater Albert besucht ab und an sein Grab und die Gräber seiner Mitbrüder auf dem Friedhof der Abtei. Dann hält er inne. Der Kreislauf des Lebens, eingebettet in eine großartige Natur, lässt aber nicht nur Mönche ehrfürchtig werden.