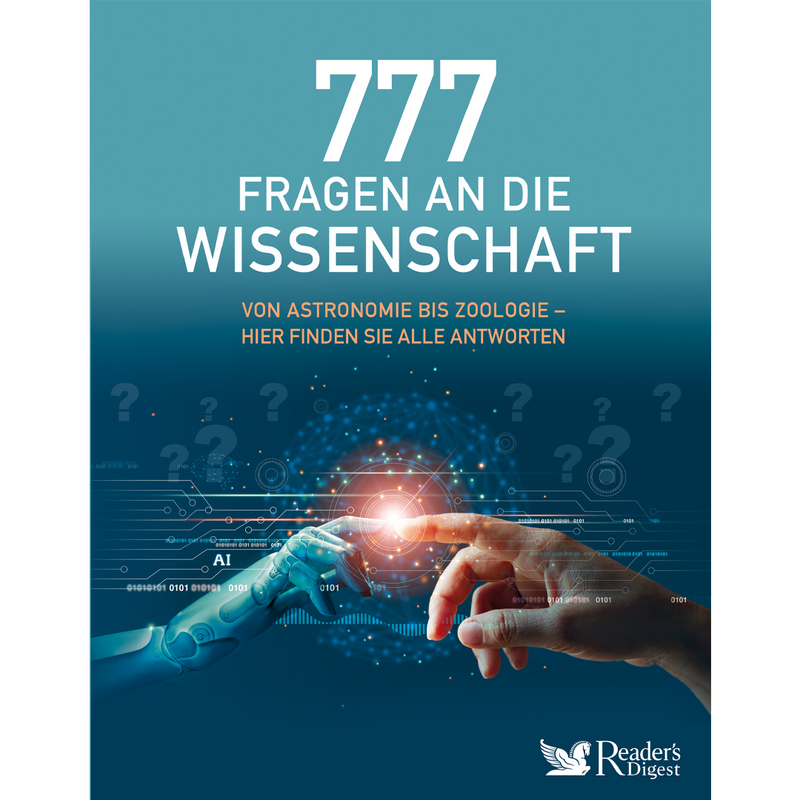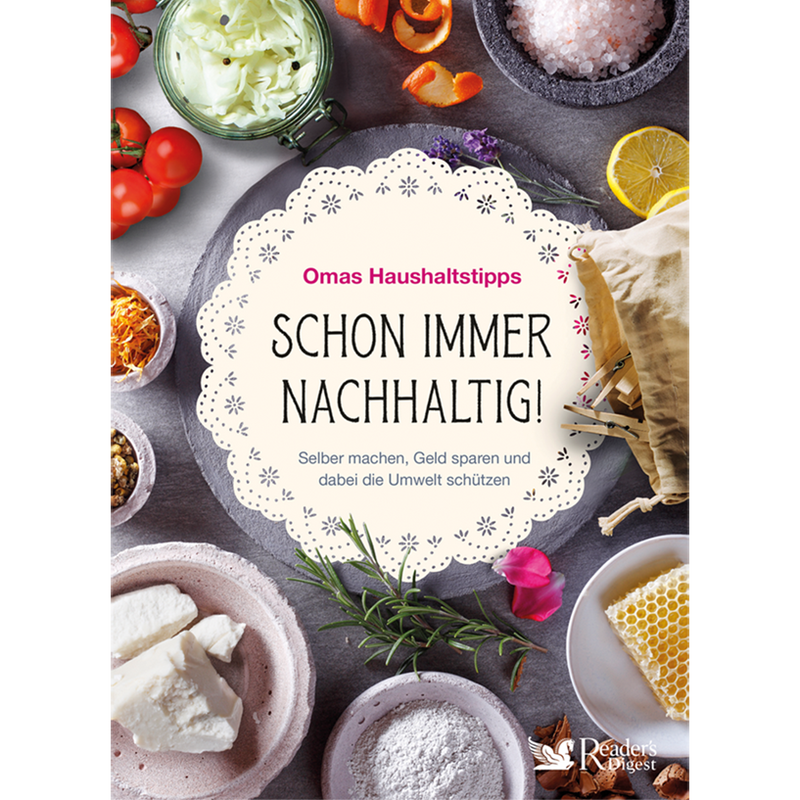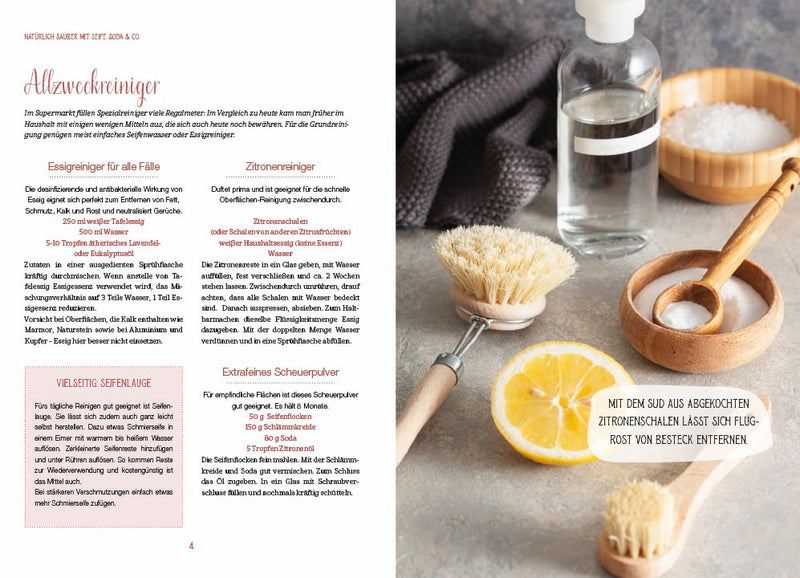Das steckt hinter diesen deutschen Wörtern
Wetten, dass Sie viel mehr Fremdwörter kennen, als Sie denken? Unterhaltsames und Wissenswertes über diese (Fremd-)Wörter der deutschen Sprache.

©
Sie beherrschen keine Fremdsprache? Auch wenn Sie nicht Englisch, Französisch oder Spanisch sprechen, kennen Sie doch jede Menge Wörter dieser – und anderer – Sprachen. Denn etwa 8 bis 9 Prozent des deutschen Wortschatzes besteht aus Fremdwörtern. Viele davon erkennen wir gar nicht mehr als solche. Aber jedes erzählt eine Geschichte.
Chirurgie
Auch wenn die Chirurgie als die Königsdisziplin in der Medizin gilt, erinnert das Wort daran, dass selbst sie streng genommen ein Handwerk ist. Der Begriff geht nämlich aufs Griechische cheirourgia zurück, was ursprünglich „Tätigkeit mit der Hand, Handarbeit“ bedeutete. Von wegen Halbgott in Weiß!
Humor
Lachen bis die Tränen kommen? Dieses Wort für Heiterkeit stammt vom lateinischen (h)umor, das „Flüssigkeit“, aber auch „Körpersaft“ bedeutet. Gemeint sind aber nicht die Lachtränen, sondern die Körpersäfte, die nach alter Lehre den Mensch entscheidend beeinflussten. Er war nur dann heiteren Gemüts, wenn die vier Körpersäfte – gelbe sowie schwarze Galle, Blut und Schleim – im Gleichgewicht waren.
Karat
Das Gewichtsmaß für Edelsteine und Gold hat seinen Ursprung in der Natur. Karat stammt vom Griechischen keration, was eigentlich „Hörnchen“ bedeutet. Keration bezeichnet aber auch die Schote des Johannisbrotbaums, deren getrocknete Samen früher als Gewichte beim Wiegen von Gold und Edelsteinen verwendet wurden.
Karosserie
Das Wort für den Aufbau auf dem Fahrgestell hingegen, der Personen und Güter aufnimmt, geht aufs Französische carrosse zurück, das von carrus, dem lateinischen Wort für Wagen, abgeleitet ist. Carrosse steht für „prächtige, vierrädrige Kutsche“.
Knickerbocker
Die weiten, unter den Knien mit einem Bund abschließenden Hosen sind ein wenig aus der Mode gekommen. Aber wer Luis Trenker noch kennt, weiß, was Knickerbocker sind. Benannt sind die Hosen nach Diedrich Knickerbocker, dem fiktiven Autor des Buchs Humoristische Geschichte der Stadt New York. Schriftsteller Washington Irving nahm darin die niederländischen Einwanderer in New York auf die Schippe. Knickerbocker bürgerte sich zunächst als Spitzname für sie ein. Später ging der Begriff auf die Hosen über, die Teil ihrer Tracht waren.
Krawall
Heute möchte niemand Krawall vor seinem Haus erleben. Schließlich sind damit gewalttätige Unruhen gemeint. Das war früher anders. Das mittelfranzösische charivalli, auf das das Wort einer Erklärung zufolge zurückgeht, bezeichnete nämlich etwas viel Harmloseres: Den Lärm, den Hochzeitsgäste veranstalteten, wenn das Brautpaar sich zurückzog, um allein zu sein.
Minister
Den einen oder die andere mag es tief treffen: Dem Wortsinn nach ist der Minister mitnichten einer der Mächtigen, sondern „der Geringste“. Darin steckt das lateinische Wort minus (eine Komparativform von parvus „klein, gering“), also „kleiner, geringer“. Leichter erkennbar ist diese ursprüngliche Bedeutung im Wort Ministrant, dem katholischen Messdiener.
Motor
Was sorgt dafür, dass ein Auto fährt? Richtig, der „Beweger“ – das bedeutet das lateinische motor.
Parlament
Das britische Parlament ist eine der ältesten ununterbrochen bestehenden repräsentativen Versammlungen der Welt – und die Briten sind stolz darauf. Zu Recht: Schließlich haben andere Länder nicht nur die Institution, sondern viele auch den Begriff dafür übernommen. Nachdem der Normanne Wilhelm der Eroberer 1066 die Macht in England übernommen hatte, flossen unzählige altfranzösische Wörter ins Englische ein. Darunter parlement, was „Gespräch, Unterredung, Erörterung“ bedeutet.
Polizei
In diesem Wort steckt, ebenso wie im Wort Politik, das griechische pólis, also „Stadt, Staat“. Bis ins 18. Jahrhundert bezeichnete das Wort Polizei übrigens nicht wie heute die Hüter der staatlichen Ordnung, sondern die Staatsverwaltung.
Telegramm
Die Technik, die es ermöglichte, Telegramme zu senden, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Die Herkunft des Wortes reicht aber weiter zurück. Im Griechischen bedeutet tele „fern“, gramma „Schrift, Schriftzeichen“. Ein Fernschreiben also.
Uniform
Nicht nur Polizisten tragen sie im Dienst. Was alle Uniformen eint, ist die Tatsache, dass ihre Träger gleichförmig gekleidet sind. Diesen Umstand benennt denn auch das Wort, das aufs lateinische unus, also „einer“ und forma, also „Gestalt, Äußeres“ zurückgeht.
Vanille
Als Gewürz verfeinert Vanille Süßspeisen. Ihren Namen verdankt sie der Form, in der die Natur sie uns schenkt. Vainilla ist die Verkleinerungsform des spanischen Wortes vaina, was „Degen- und Messerscheide“, aber auch „Hülse“ und „Schote“ bedeutet.