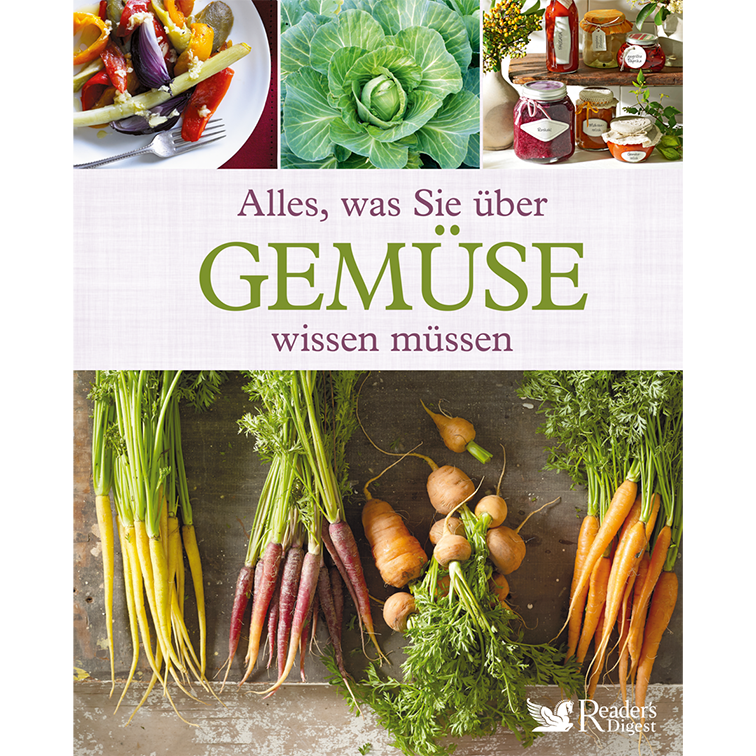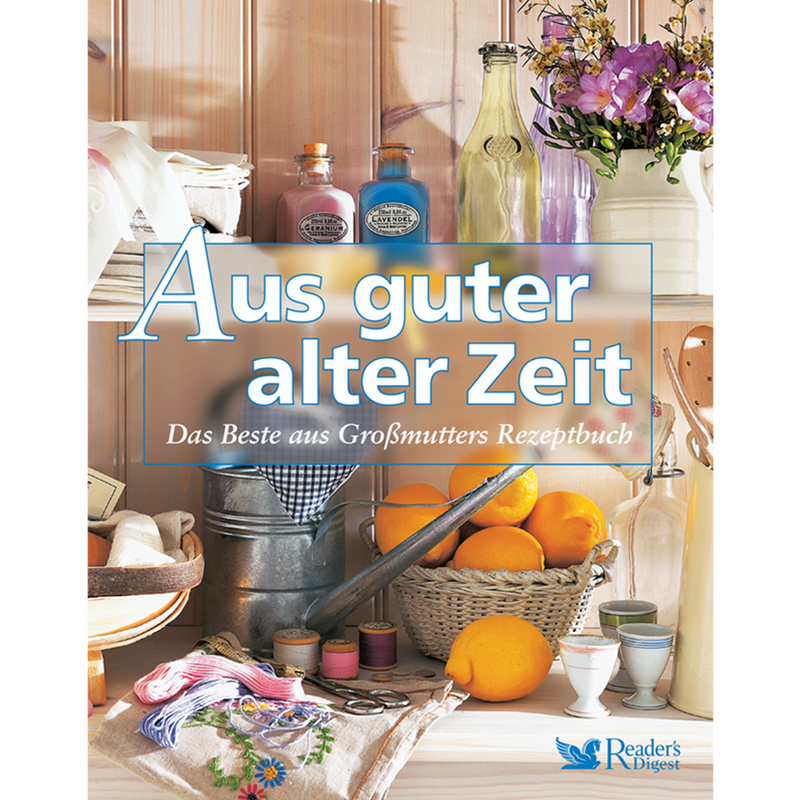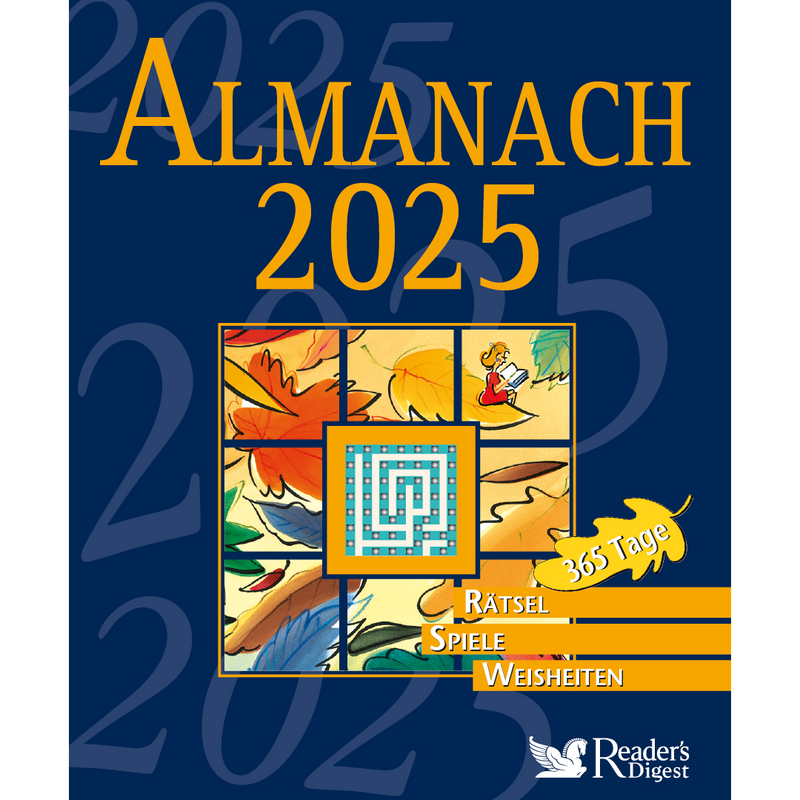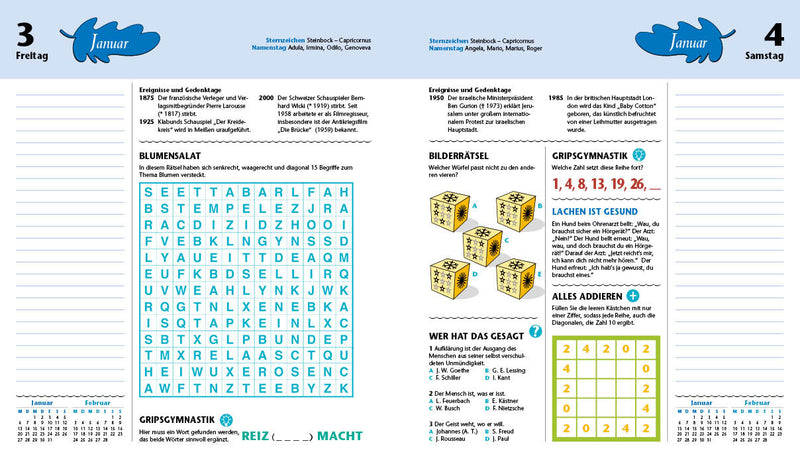Fremdwörter, die aus dem Deutschen stammen
Viele Wörter sind aus anderen Sprachen ins Deutsche eingewandert. Zugleich ist es selbst zur Quelle von Wortanleihen für Sprachen in aller Welt geworden. Wir stellen einige dieser Wörter vor.

©
Besserwisser
Ob die Mehrheit der Besserwisser einen Bezug zu Deutschland hat, darf zumindest bezweifelt werden. Das finnische Wort für die unangenehmen Zeitgenossen aber kommt aus dem Deutschen.
Butterbrot
Wer einem Russisch sprechenden Gast ein Butterbrot anbietet, sollte wissen, dass das Wort in dieser Sprache ein belegtes Brot ist. Darauf gehören reichlich Käse, Wurst oder Kaviar, nicht aber Butter!
Dübel
Für so manche Sache, die es zu biblischen Zeiten nicht gab, hat das Ivrit, also das Neuhebräische, Wörter aus anderen Sprachen übernommen. Dies gilt zum Beispiel für den Dübel. Gesprochen allerdings wird er in Israel wie „Diebel“, da Ivrit kein „ü“ kennt.
Gulaschbaron
Gelegentlich bilden andere Sprachen auch deutsche Wörter, die es in dieser Form ursprünglich gar nicht gibt. Der gulaschbaron im Schwedischen zum Beispiel bezeichnet, was im Deutschen „Kriegsgewinnler“ genannt wird.
Kindergarten
Viele Kanadier, Briten und US-Amerikaner schicken ihren noch nicht schulpflichtigen Nachwuchs in den kindergarten. Die öffentliche frühkindliche Erziehung wurde in Deutschland im 19. Jahrhundert populär. Sie ist jedoch keine deutsche Erfindung, sondern entwickelte sich etwa zur gleichen Zeit in mehreren europäischen Ländern.
Kirsch
Grappa, Limoncello, Sambuca – dem Land, in dem die Zitronen blühen, mangelt es nicht an einheimischen hochprozentigen Getränken. Einwanderer sind dennoch willkommen: Von nördlich des Brenners stammt il kirsch, wie das Kirschwasser in Italien heißt
Kitsch
Meist süßlich-sentimentale, dem Geschmack der breiten Masse angepasste, der Wirklichkeit nicht entsprechende Scheinkunst. So definiert eines der Standard-Nachschlagewerke zur deutschen Sprache den Begriff Kitsch. Dieselbe Bedeutung hat er als Lehnwort im Griechischen.
Kohlrabi
Vielen englischen Muttersprachlern sind kohlrabi, bratwurst und schnitzel ein Begriff, selbst wenn ihre Sprache neben diesen Lehnwörtern eigene Begriffe dafür hat: turnip cabbage, fried sausage und cutlet.
Leitmotiv
In ihrer Begeisterung für klassische Musik deutschsprachiger Komponisten von Beethoven bis Mozart haben die Spanier den Begriff des Leitmotivs in ihre Sprache übernommen. Dort bezeichnet es wie im Deutschen eine oft wiederholte, mit einer bestimmten Stimmung, Gestalt oder Ähnlichem verbundene Tonfolge in einem musikalischen Werk.
Müsli
Die Schweiz hat der Welt dieses Gericht aus rohen, in Milch eingeweichten Haferflocken, kombiniert mit Obst und Nüssen geschenkt – und den Begriff dafür gleich dazu. Müsli hat Liebhaber auf allen Erdteilen. In seinem Heimatland wird es übrigens Müesli geschrieben.
Poltergeist
Die eher harmlose vermeintliche Spukerscheinung, die mit rasselnden, klopfenden oder heulenden Geräuschen einhergeht, scheint es auch in Brasilien zu geben. Poltergeist zählt jedenfalls zum Wortschatz des brasilianischen Portugiesisch.
Schadenfreude
Boshafte Freude über das Missgeschick eines anderen zu empfinden, mag menschlich sein. Allerdings betrachtet sie wohl niemand als feinen Zug. Vielleicht bedient sich das Englische des deutschen Wortes, um dieses Gefühl als dem eigenen Wesen fremd zu kennzeichnen?
Schule
Die tansanische Landessprache Kiswahili kennt zahlreiche Lehnwörter. Viele davon stammen aus dem Englischen. Einige aber auch aus dem Deutschen, so wie das Kiswahili-Wort für Schule.
Strudel
Auch der Strudel ist ins Neuhebräische eingewandert. Wer in einem Restaurant in Israel danach fragt, wird allerdings eher auf Unverständnis stoßen. Denn strudel ist dort eines der Wörter für das @-Zeichen, im Deutschen auch Klammeraffe genannt.
Szuflada
Im Polnischen hat sich die Schublade in Schreibung und Aussprache den Gepflogenheiten dieser slawischen Sprache ein wenig angepasst. Dennoch stammt szuflada unverkennbar aus dem Deutschen.
Vorspiel
Bei diesem Wort denken die Norweger, die es in ihre Sprache integriert haben, an etwas ganz anderes als Deutsche. Im Norwegen bezeichnet vorspiel den gemeinsamen Genuss von Alkohol, bevor man zu einer Veranstaltung, einem Fest geht, bei dem hochprozentige Getränke ausgeschenkt werden.
Weltanschauung
Deutschsprachige Denker des 18. und 19. Jahrhunderts hatten auch in den europäischen Nachbarländern großen Einfluss. Allen voran Immanuel Kant. Er führte den Begriff der Weltanschauung ein, der es – mit gleicher Bedeutung – ins Französische und Englische geschafft hat.