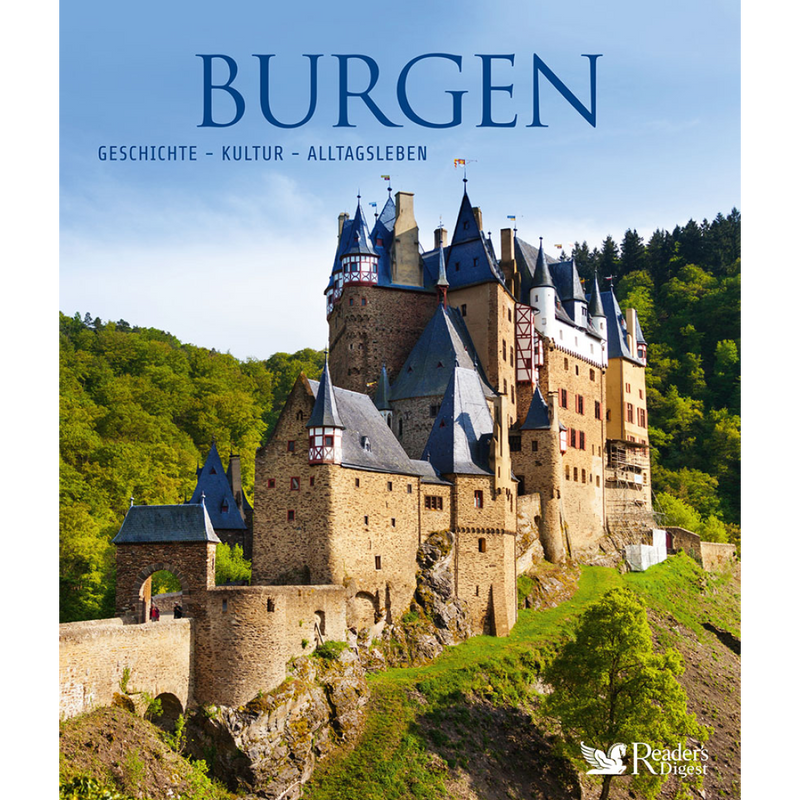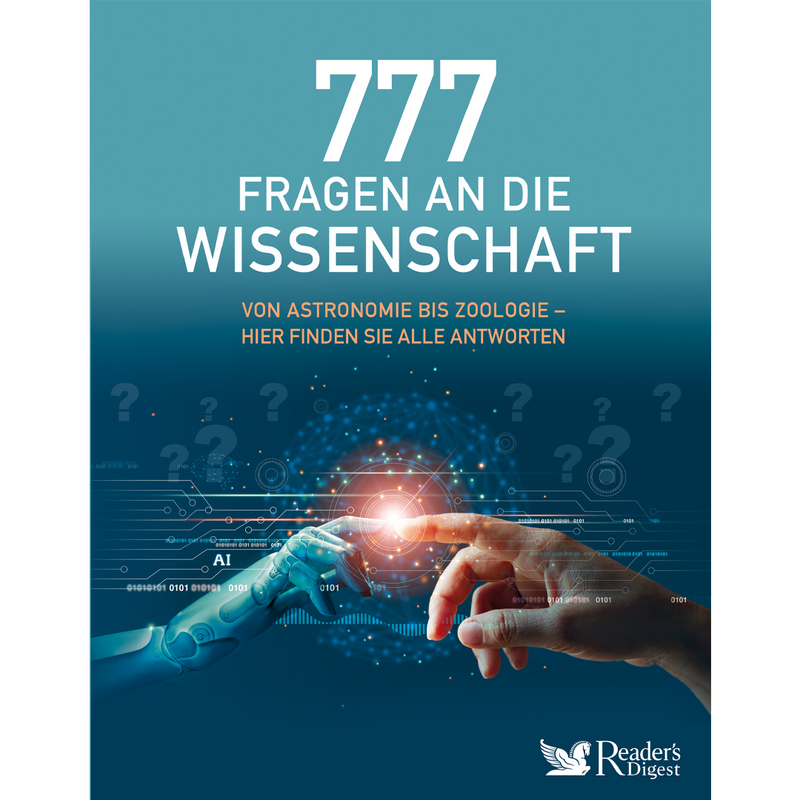Wenn die Erde bebt
Die gewaltigen Kräfte im Erdinneren zeigen sich an der Oberfläche nicht nur in Form von Vulkanen und Geysiren, auch Erdbeben beweisen der Menschheit oft, dass sie diesen Urgewalten auch im 21. Jh. wenig entgegensetzen kann.

©
Noch immer lassen sich die verheerenden Erschütterungen kaum vorhersagen. Immerhin kennen die Forscher inzwischen die Regionen, in denen das Risiko schwerer Erdbeben besonders hoch ist und können sich so besser wappnen.
Was passiert bei einem Erdbeben?
Weltweit entstehen die meisten Erdbeben in Regionen, in denen sich zumindest zwei Erdplatten in unterschiedliche Richtungen bewegen. Gleiten die Platten aneinander vorbei, kann sich ihr Gestein verhaken. Zwar bewegen sich diese nur wenige Zentimeter pro Jahr. Wegen der gigantischen Massen bauen sich dort aber im Lauf der Zeit gewaltige Spannungen auf. Irgendwann reißt das Gestein und holt die versäumte Bewegung in wenigen Sekunden und Minuten nach. Ein solches Erdbeben kann auch in größerer Entfernung verheerende Schäden anrichten. Schließlich breiten sich die Erdbebenwellen in einer einzigen Stunde rund 12 000 – 13 000 km weit aus. Neben solchen tektonischen Beben können Vulkanausbrüche oder einstürzende Hohlräume in Bergbauregionen ebenfalls Erdbeben auslösen. Auch Fehler bei Bohrungen für Erdwärmekraftwerke oder das Fracking zum Gewinnen von Erdgas und Erdöl können für erhebliche Erschütterungen sorgen.
Wie werden Erdbeben gemessen?
Besonders einfach ist die 1902 vom italienischen Seismologen, Vulkanologen und Priester Giuseppe Mercalli entwickelte Skala, weil sie Erdbeben in zwölf Stufen einteilt, die mit einfachen Beobachtungen ermittelt werden können. Zeigen sich z. B. Risse in Mauern, handelt es sich um Stufe 6 der Mercalliskala, bei Stufe 7 fallen Schornsteine von den Dächern, und bei Stufe 8 stürzen Giebelfronten ein. In den 1930er-Jahren entwickelte der US-amerikanische Seismologe Charles Richter die später nach ihm benannte Skala. Dabei misst ein einfaches Gerät die Erschütterungen. Stufe 1 steht für ein schwach wahrnehmbares Zittern, zur jeweils nächsten Stufe verzehnfacht sich die Stärke. Stärke 8 beschreibt sehr schwere Beben, noch oben ist die Richterskala nicht begrenzt.
Vor allem starke Erdbeben misst die 1977 entwickelte Momenten-Magnituden-Skala genauer als die Richterskala. Sie ermittelt den „seismischen Moment“ aus diversen Faktoren wie der Größe der im Untergrund gebrochenen Fläche und der mittleren Verschiebung der Gesteinsblöcke. So entstehen bei leichten Beben nur wenige Hundert Meter lange Brüche in der Erdkruste, bei schweren Erdstößen kann die Bruchzone dagegen einige Hundert Kilometer lang sein. Der größte mögliche Wert ist 10,6, bei dem die Erdkruste vollständig brechen müsste. Beim schwersten Beben des 20. Jh. am 22. Mai 1960 im Süden Chiles wurde die stärkste bisher berechnete Momenten-Magnitude (Mw) von 9,5 erreicht.
Wie groß ist die Gefahr in Mitteleuropa?
Obwohl Mitteleuropa auf keiner Plattengrenze liegt, kann es hier ebenfalls kräftig beben. So erschütterte am 13. April 1992 das Roermond-Beben mit einer Stärke von 5,9 auf der Richterskala die Niederrheinische Bucht. Und vor ca. 1300 Jahren gab es in der heutigen Grenzregion zwischen Belgien und Deutschland ein Beben der Stärke 6,4. Ursache hierfür sind Spannungen in der Erdkruste zwischen Bodensee und Nordsee. Das Rheinland ist besonders gefährdet, weil es dort viele Störungen in den Gesteinsschichten entlang der Flussgräben gibt.
Kann man Erdbeben genau vorhersagen?
Weil im Untergrund beim Entstehen von Erdbeben eine Reihe verschiedener Faktoren sehr komplex zusammenwirken, schließen Forscher eine genaue Vorhersage von Zeit und Stärke eines Bebens auf absehbare Zeit aus. Sehr gut möglich ist es dagegen inzwischen, die Wahrscheinlichkeit einer Bebenstärke innerhalb eines Zeitraums zu bestimmen. Mit solchen Angaben können Behörden dann Bauvorschriften durchsetzen, die das Einstürzen von Gebäuden bei Beben einer solchen Stärke verhindern. Zudem sind bestimmte, eher harmlose Erdbebenwellen sehr schnell und kommen daher einige Sekunden vor den zerstörerischen Wellen in besonders gefährdeten Gebieten wie z. B. der türkischen Metropole Istanbul an. Diese Wellen kann man als Warnsystem nutzen, das über automatische Signale z. B. bestimmte Bereiche sichert oder U-Bahnen in den Bahnhöfen anhält und Erdgasleitungen absperrt.
Können Tiere Erdbeben spüren?
Martin Wikelski vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Radolfzell und sein Team veröffentlichten 2020 eine Studie, nach der mit Halsbandmessgeräten ausgestattete Kühe im Apennin-Bergdorf Capriglia jeweils eine bis 20 Stunden vor stärkeren Erdbeben auffallend unruhig waren. Nimmt man diese Unruhe als Maß, hätten die Tiere von neun Erdbeben acht vorher gespürt, ohne sich einen Fehlalarm zu leisten. Nach vielen Jahren weiterer Forschung könnte daraus vielleicht ein zuverlässiges Warnsystem entstehen.