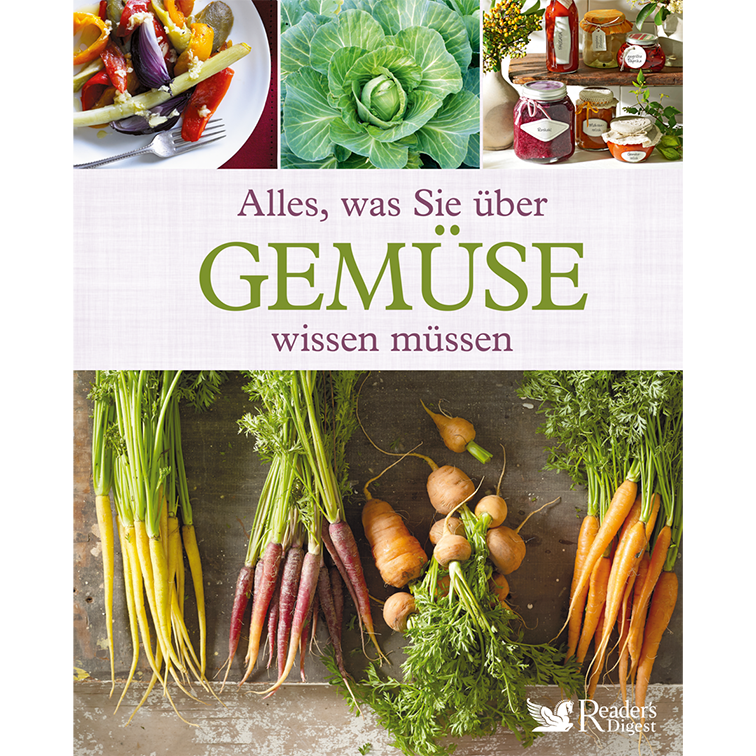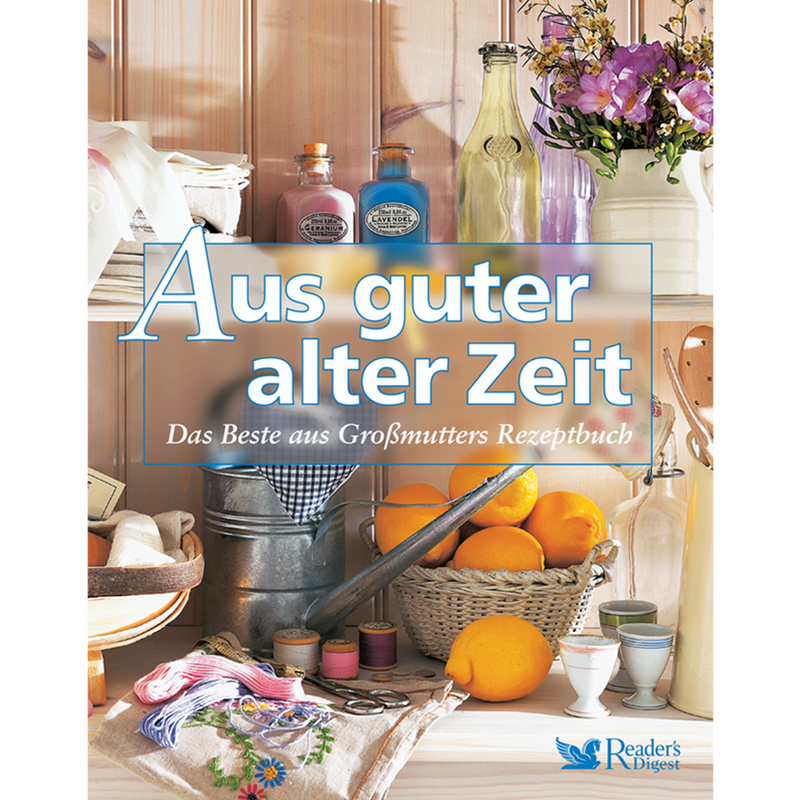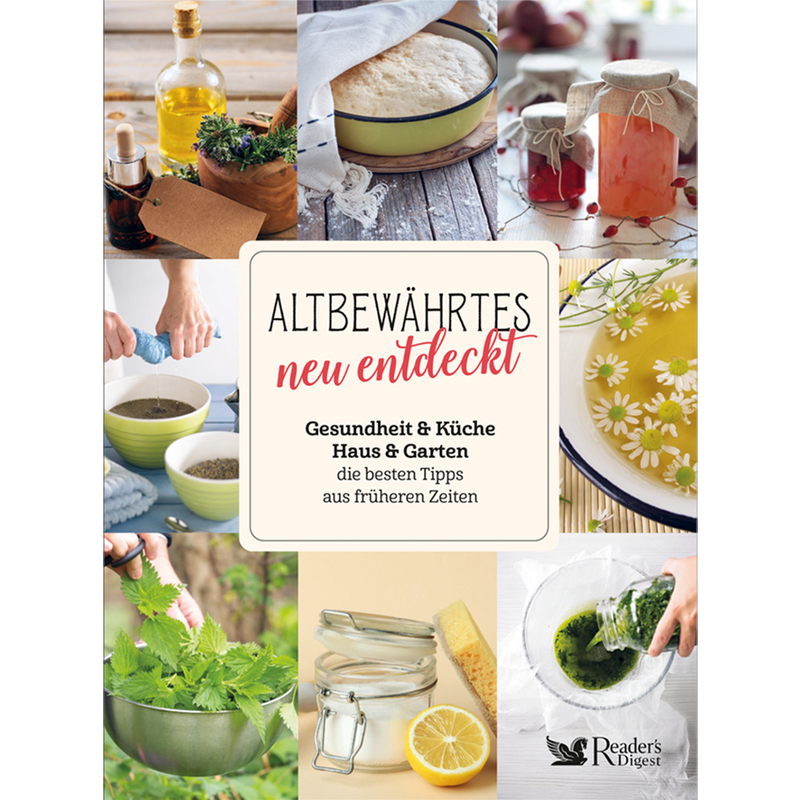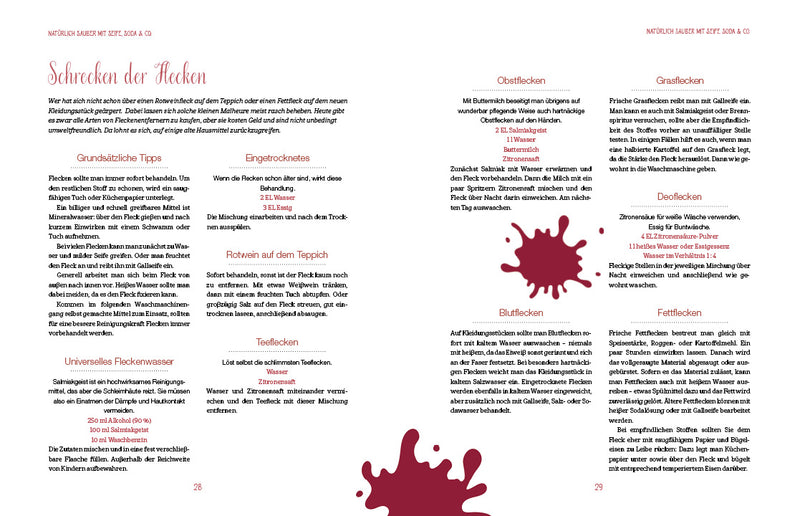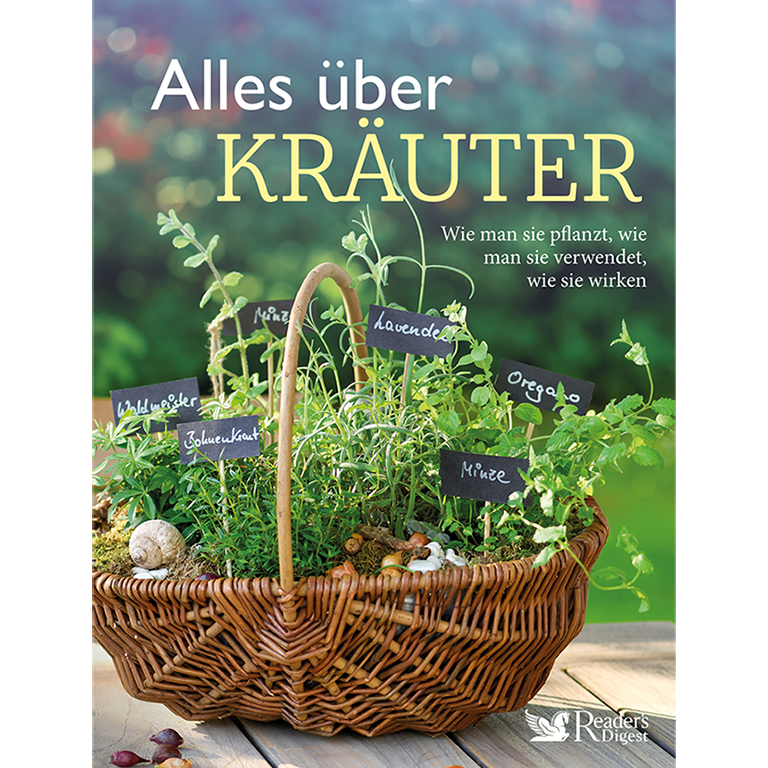Kennen Sie Waleien? Ungewöhnliche Oster-Traditionen
Rumpelnde Eier, Osterreiter, brennende Eichenräder – in manchen Gegenden Deutschlands werden Traditionen begangen, die kaum jemand kennt...

©
Schweigende Glocken
Am Gründonnerstag ertönen sie Kirchenglocken in katholischen Gegenden ein letztes Mal. Dann bleiben sie bis zum Ostersonntag stumm – zur Erinnerung an die Leiden Christi. Der Legende nach fliegen sie währenddessen nach Rom. In manchen Gegenden Deutschlands wie im Allgäu, an der Rhön, im Saarland, Hessen oder Franken wird dieser alte Brauch noch praktiziert. Das Glockengeläut wird durch Holzinstrumente, sogenannte Ratschen ersetzt. Die Messdiener ziehend ratschend von Haus zu Haus, lärmen und bauen sich vor der Kirche auf. Auf ihrem Weg durch die Stadt werden ihnen oft Süßigkeiten oder sogar Geld zugesteckt.
Osterreiter
1541 wurde das Osterreiten erstmals schriftlich erwähnt. In der Gegend zwischen Bautzen, Kamenz und Hoyerswerda findet es noch heute am Morgen des Ostersonntags statt. Die Prozession besteht aus Fahnenträgern, Reitern und Trägern der Christus-Statue. Die katholische Osterreiter verkünden dabei die frohe Botschaft der Auferstehung Christi, singen und beten. Gekleidet sind die Reiter mit Gehrock und Zylinder und auch die Pferde tragen festlichen Schmuck.
Brennende Räder
Meterhohe Eichenräder, mit Stroh – meist aus Roggen – gestopft und umwickelt, werden angezündet und von Hügeln in Täler hinabgestoßen – als Zeichen für die Auferstehung von Jesus Christus. Dieses Spektakel findet jedes Jahr, meist am Abend des Ostersonntags statt. Das wohl bekannteste gibt es in Lüdge bei Bad Pyrmont zu sehen. Im Jahr 784 hat karl der Große den Osterräderlauf gestattet, doch der Brauch ist wohl schon viel älter. Bereits vor 2000 Jahren sollen die Germanen brennende Räder als Willkommensgruß an den Frühling und die Sonne gerollt haben.
Stilles Osterwasser
In manchen Teilen Deutschlands wird der Brauch des Osterwasser-Holens noch heute gepflegt, etwa im brandenburgischen Spreewald und in Sachsen. Das Osterwasser muss in der Nacht von Samstag auf Ostersonntag zwischen Mitternacht und Sonnenaufgang aus einem Bach geholt und schweigend nach Hause getragen werden, ohne dass ein einziger Tropfen verloren geht. Sonst, so heißt es, verliert das Osterwasser seine Heilkraft. Und die verspricht so einiges: ewige Schönheit und Jugend, Fruchtbarkeit, Intelligenz sowie ein Jahr lang Schutz vor Krankheiten und Unglück.
Hauptsächlich unverheiratete Frauen zogen früher mit dem Wasser durch ihre Dörfer. Die Ursprünge des Brauchs gehen in die heidnische Zeit zurück. Wasser als Symbol des Lebens wurde bei den Germanen zum Gedenken an die Frühlings- und Fruchtbarkeitsgöttin Ostera verehrt. Erst in den Jahrhunderten nach Christus wurde es dann mit Ostern in Zusammenhang gebracht.
Waleien – rumpelnde Eier
Eierrollen, auch Waleien genannt, hat in den Spreewald-Dörfern während der Osterzeit eine lange Tradition. Hier werden gekochte und bemalte Eier in eine Grube – etwa einen Meter breit und zwei bis drei Meter lang – hinuntergerollt. Ein Mitspieler legt sein Ei in die Mitte der Grube. Der Mitspieler, der dieses Ei von Außen mit seinem eigenen trifft, bekommt das Ei seines Gegners und eine kleine Belohnung dazu. Trifft er nicht, muss auch sein Ei in der Grube bleiben, und der nächste ist an der Reihe. Trifft der nun beide Eier, darf er auch beide nehmen und bekommt zwei Belohnungen. Ein Mitspieler, der trifft, darf so lange weiterspielen, bis er kein Ei mehr „ankullert2. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Das Waleien galt in früheren Zeiten als Fruchtbarkeitzauber. Kullernde Eier über Wiesen und Felder sollen das Wachstum und Gedeihen der Saaten günstig beeinflussen.