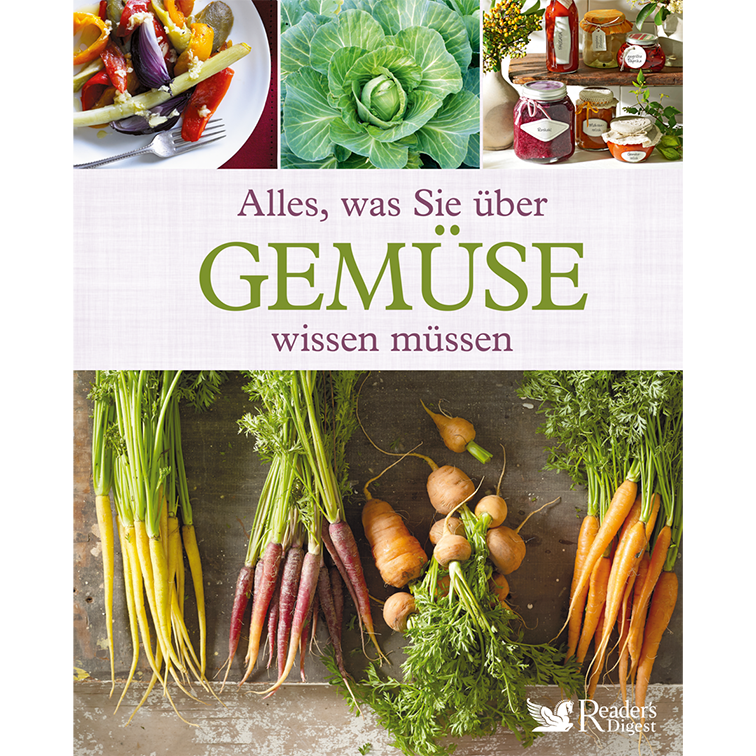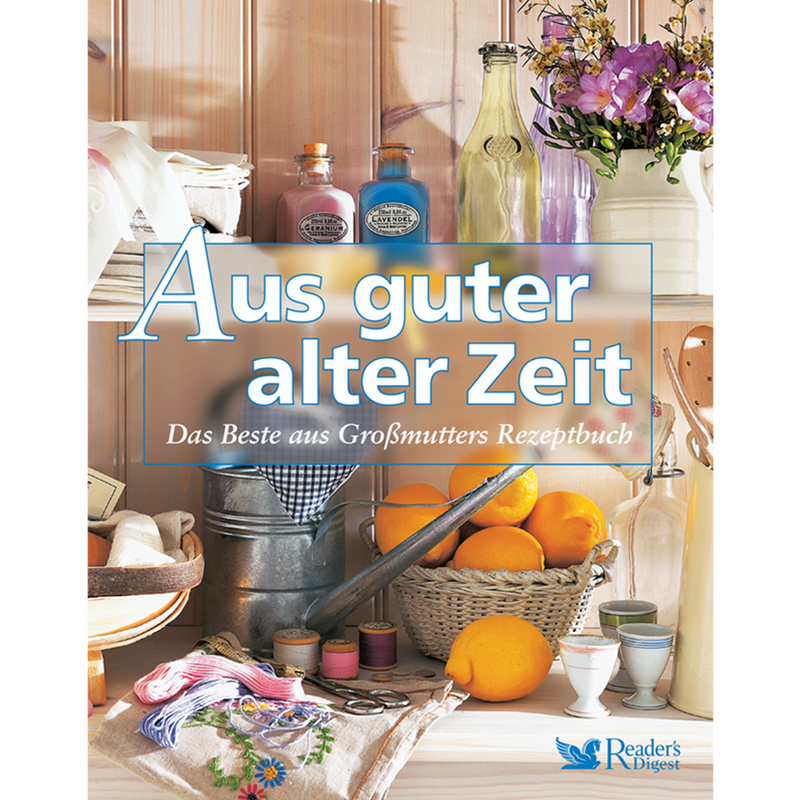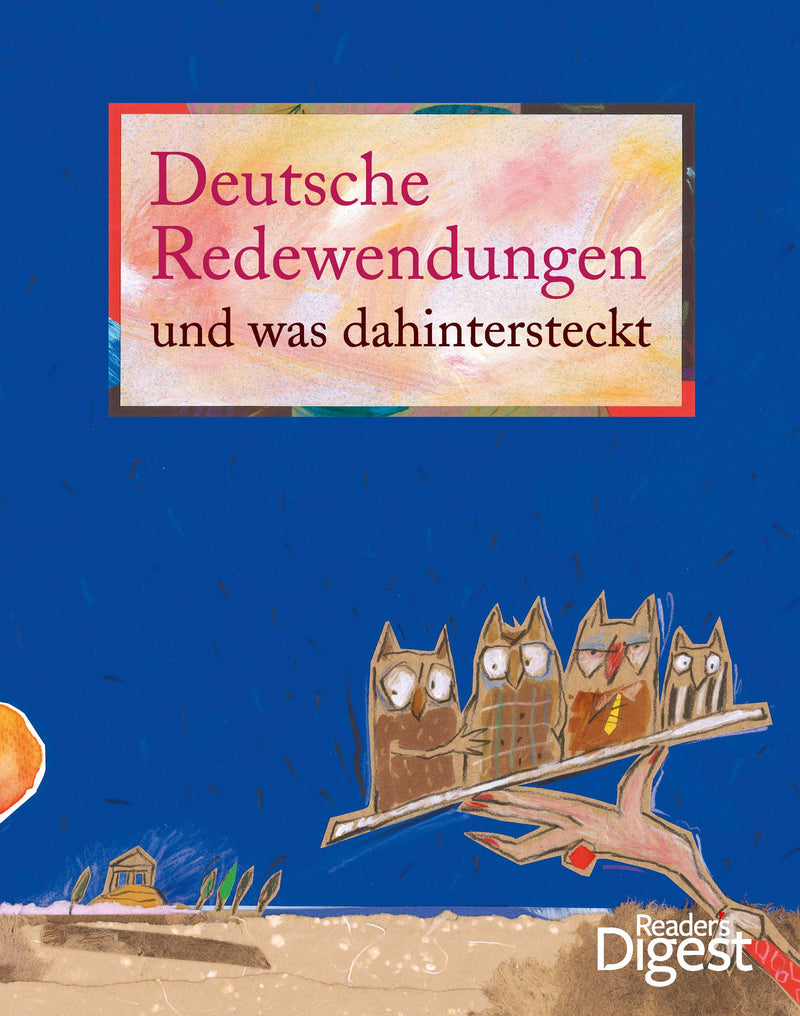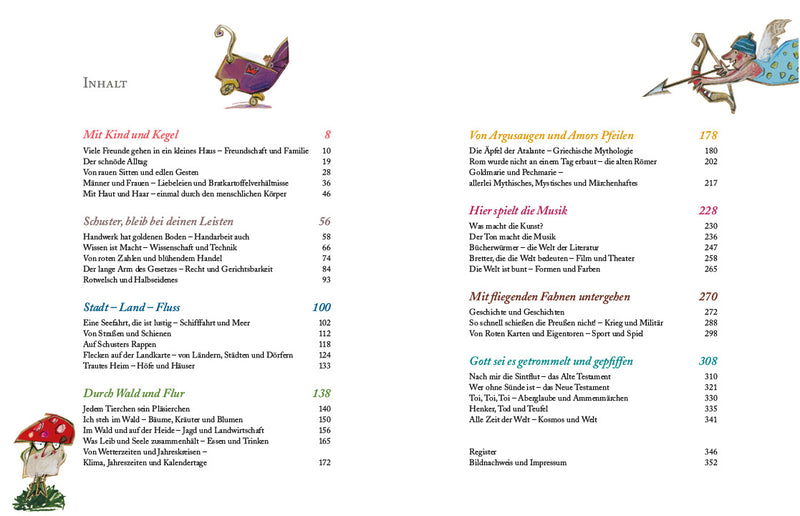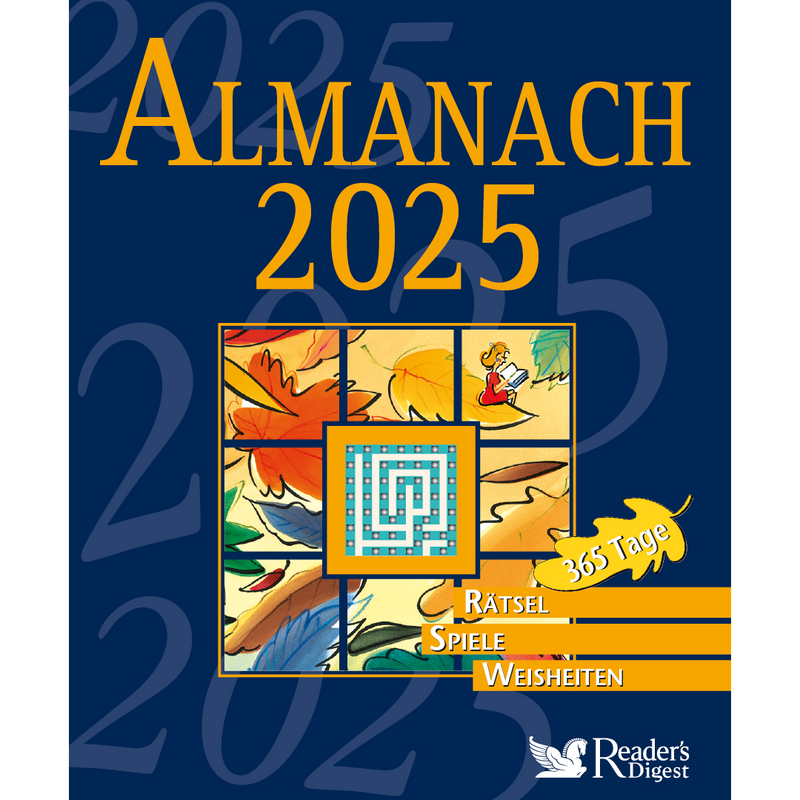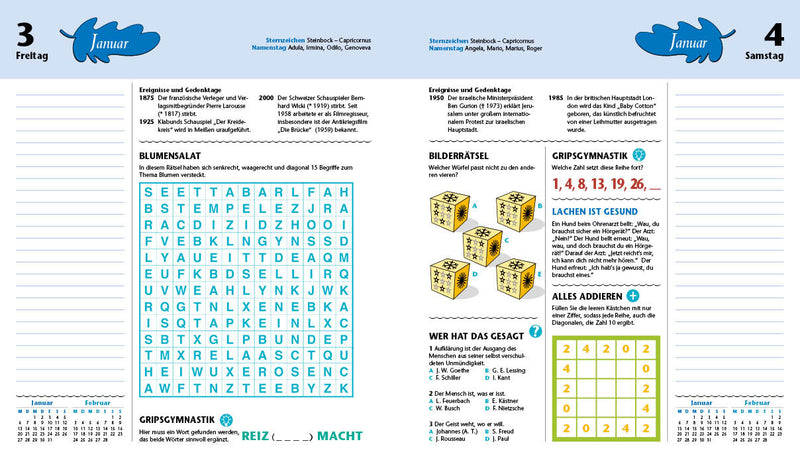Ganz besondere Osterbräuche in Deutschland
Ostereier färben und verstecken, das tut fast jeder. Die folgenden besonderes Osterbräuche zeigen jedoch, wie vielfältig und traditionsreich das Osterfest in Deutschland wirklich gefeiert wird.

©
Osterfeuer, Osterritt, Osterschießen, Gang nach Emmaus oder Wasserschöpfen – finden Sie auch sich und Ihre Region in unseren besonderen deutschen Osterbräuchen wieder?
Osterfeuer
Große prasselnde Osterfeuer, dieser Brauch ist besonders beliebt und verbreitet in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Dabei werden am Ostersamstag oder Ostersonntag große Feuer entzündet, um den Winter zu vertreiben und den Frühling zu begrüßen. Ursprünglich waren die Osterfeuer ein vorchristlicher Brauch, der später mit der christlichen Auferstehungsbotschaft verbunden wurde.
Ostereierschieben & Eiertrudeln
Dieser Osterbrauch ist besonders in Sachsen (z. B. Bautzen), Thüringen und Hessen verbreitet. Dabei werden Eier Hügel oder Bahnen hinuntergerollt. Gewinner ist, wessen Ei am weitesten rollt oder andere Eier zum Stoppen bringt. Der Brauch symbolisiert das Öffnen des Grabes Jesu oder den Lauf der Sonne.
Osterreiten
Das Osterreiten ist ein Brauch der Oberlausitz (Sachsen). Reiter in wunderschöner festlicher Tracht auf ihren Pferden verkünden die Auferstehung Jesu und reiten zwischen katholischen Dörfern hin und her. Diese sorbisch-katholische Tradition ist bereits über 500 Jahre alt.
Osterschießen
In Bayern und Niedersachsen wird an Ostern scharf geschossen. Die zahlreichen Schützenvereine der Regionen veranstalten das Osterschießen mit Holz- oder Luftgewehren. Dazu gibt es ein Schützenfest, bei dem der Schützenkönig gekürt wird. Der ohrenbetäubende Brauch diente früher zur Vertreibung böser Geister und zur Begrüßung des Frühlings.
Wasserschöpfen am Ostermorgen
Dieser weniger bekannte Brauch in Bayern und Baden-Württemberg ist etwas für die Damen. Mädchen holen dabei in aller Frühe Wasser aus einem Bach oder einer Quelle. Wer das Wasser schweigend nach Hause bringt, soll besonders gesund und schön bleiben. Ursprünglich war der Brauch ein heidnischer Fruchtbarkeitsritus, den die Kirche später mit der Taufe Jesu verband und damit offiziell akzeptierte.
Ostereierwerfen & Eierlauf
Die Herkunft dieses vermutlich landwirtschaftlichen Frühlingsbrauchs in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ist ein wenig unklar. Klar geregelt ist jedoch, was dabei passiert: Eier werden auf Feldern oder Straßen geworfen, um sie über möglichst große Distanzen zu bewegen. Beim Eierlauf müssen die Teilnehmer mit einem Ei auf einem Löffel eine vorgegebene Strecke zurücklegen. Wer zuerst ankommt, ohne sein Ei verloren zu haben, hat gewonnen.
Georgiritt (Osterprozession auf Pferden)
In Bayern (z. B. Traunstein) ziehen am Ostermontag beim Georgiritt Reiter in Tracht mit geschmückten Pferden durch die Stadt, um Segen für Mensch und Tier zu erbitten. Die Prozession wird veranstaltet zu Ehren des Heiligen Georg, Schutzpatron der Reiter und Bauern. Der Namenstag des heiligen Georg, ein frühchristlicher Märtyrer aus Kappadokien, ist der am 23. April.
Emmausgang (Osterspaziergang)
In anderen Regionen Bayerns, in Hessen und Rheinland-Pfalz hingegen wandern die Gläubige nach der biblischen Geschichte von den Emmaus-Jüngern am Ostermontag zu Fuß durch die Natur, oft mit Gebeten und Gesang. Der christliche Brauch erinnert an die Auferstehung Jesu.
Ratschen statt Glockenläuten
Da die Kirchenglocken zwischen Gründonnerstag und Karsamstag schweigen, ziehen in einigen Regionen stattdessen Kinder mit hölzernen Ratschen durch die Straßen, um zum Gebet oder Gottesdienst zu rufen. Die Tradition ist vor allem noch in Bayern und Rheinland-Pfalz (Hunsrück), einigen Teilen Baden-Württembergs und im Saarland verbreitet. Im Saarland heißen die Ratschen der Kinder auch „Kleppern“ und die Kinder „Klepperkinder“.
Osterbrunnen schmücken
Besonders in Franken (z. B. in der Fränkischen Schweiz) werden zu Ostern die Dorfbrunnen prächtig und teils sehr kunstvoll mit bunten Eiern, Girlanden und Blumen geschmückt, um Wasser als Lebensquelle zu ehren. Diese fränkische Tradition aus dem frühen 20. Jahrhundert entstand in wasserarmen Gegenden.