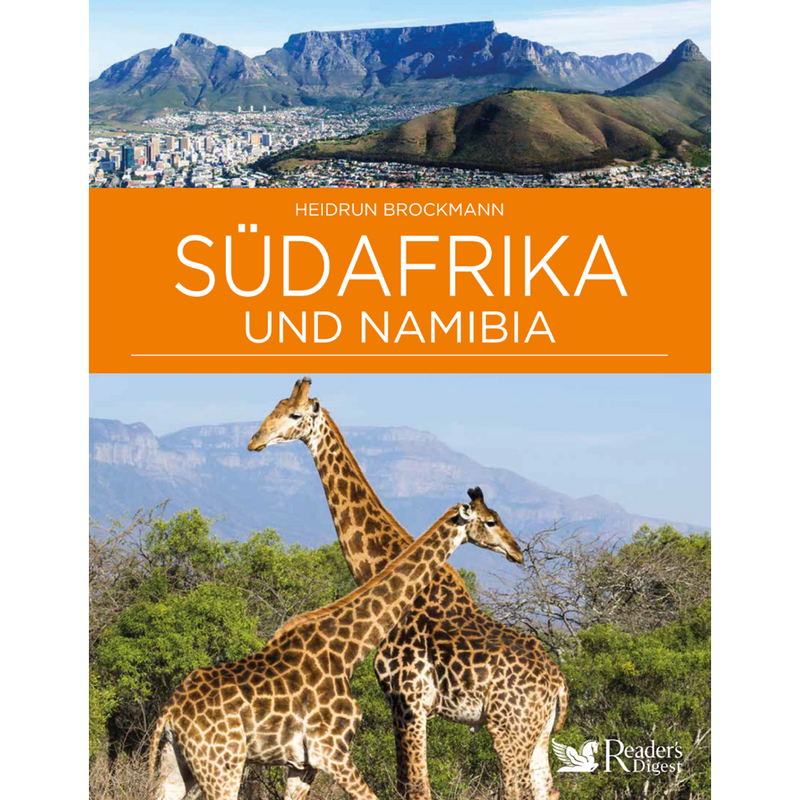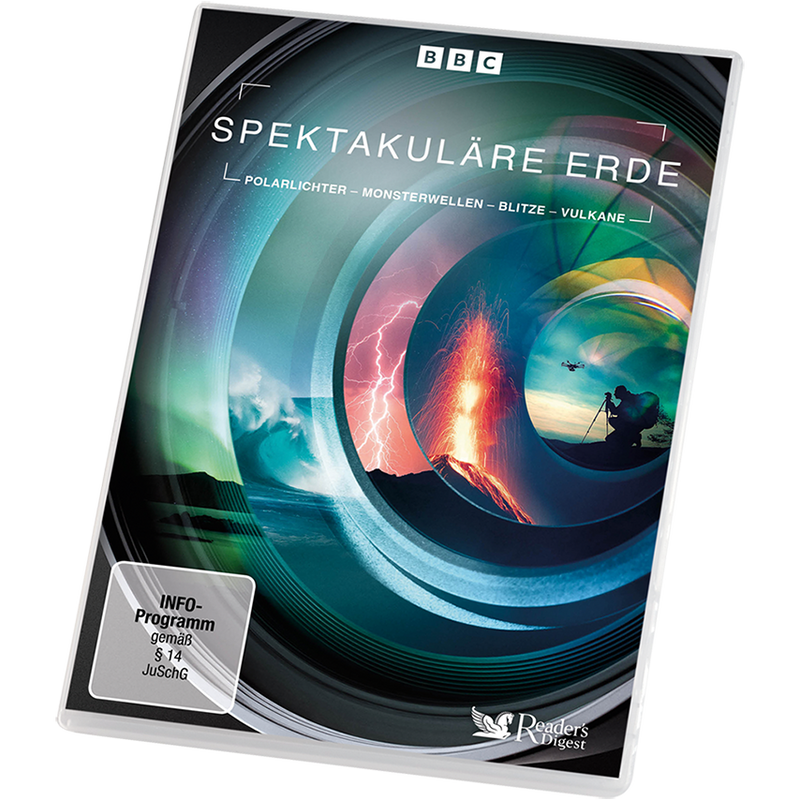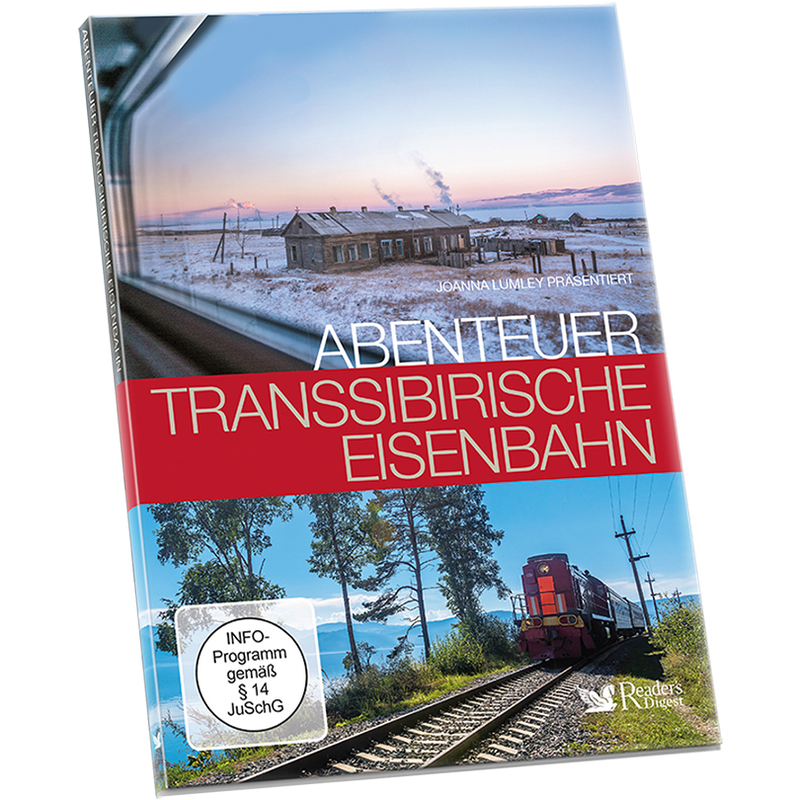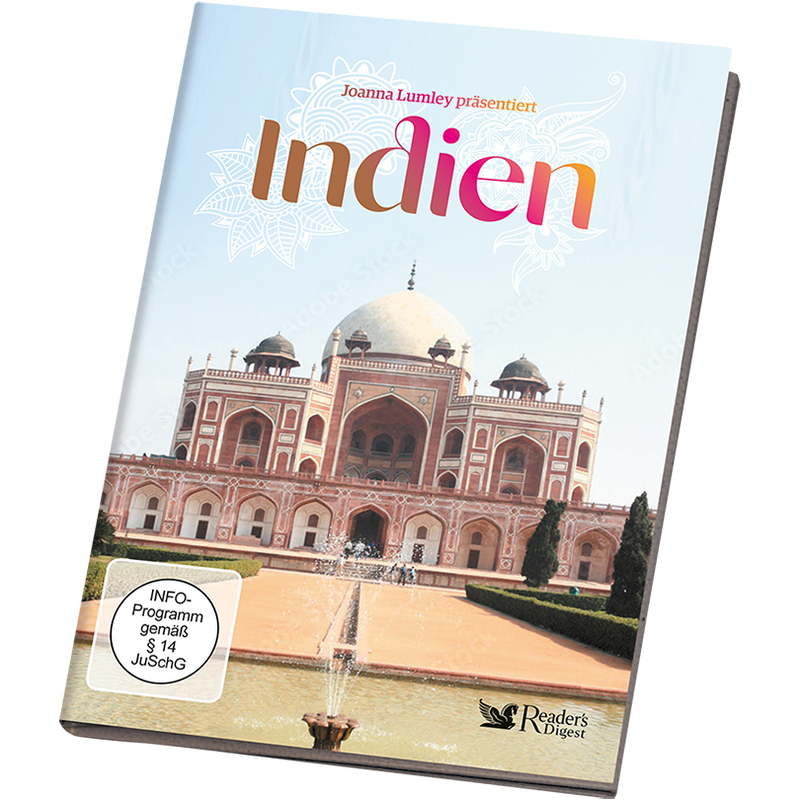Wismar: Alter Schwede und Störtebekers Spuren
Beim Bummeln durch die Hansestadt Wismar begegnet man dem Seeräuber Störtebeker - und einer Menge Schweden.

©
Wer über das bucklige Kopfsteinpflaster des Wismarer Marktplatzes schlendert, betritt – oft ohne es zu wissen – die halbe Welt. Die im Laufe der Jahrhunderte rund gescheuerten Steine haben eine lange Reise hinter sich. Einst dienten sie als Ballast für die heimkehrenden Handelskoggen der florierenden Hansestadt, die vor allem Bier in alle Herren Länder exportierte. Um auf dem Rückweg nicht zum Spielball der Wellen zu werden, luden die Wismarer Seefahrer jene Steine zum Beschweren an Bord, die bis heute, 800 Jahre nach Gründung der Stadt, den Marktplatz der malerischen Handelsstadt an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns pflastern.
Am Rande des Marktplatzes, der zu den größten Europas zählt, laden zwei Linden zur Rast ein. Dort, wo heute Verliebte ein schattiges Plätzchen finden, wurde früher Recht gesprochen – nicht selten ging es dabei um Leben oder Tod. Doch von dieser blutigen Zeit ist nichts mehr zu spüren. Im Gegenteil, die Stadt wird immer schöner. „So bunt und so gut erhalten wie heute war Wismar noch nie“, schwärmt Karl-Heinz Happke, gebürtiger Wismarer und Stadtführer mit Leib und Seele. Es gibt wohl in der ganzen Stadt keinen Kieselstein, zu dem er nicht eine Anekdote und Jahreszahlen parat hätte. Über 70 Prozent der Bauten seien bereits restauriert worden, erzählt Happke. Das zeigt sich nicht nur auf den Hauptstraßen, sondern auch abseits in den Gassen und kleinen Straßen, in deren Zentrum der Marktplatz liegt.
Alter Schwede
Da sich der Baupreis einst an der Häuserbreite orientierte, stehen die meisten der prächtigen Bauten mit ihrer schmalen Giebelfront zum Platz. Einzige Ausnahme dieser Bauweise ist das mächtige Rathaus aus dem frühen 19. Jahrhundert. Der klassizistische Bau in strahlendem Weiß beherrscht die gesamte Nordfront des Platzes und diente einst als Handelshaus, wovon ein kleines Museum im liebevoll restaurierten Gewölbekeller erzählt. Vom Balkon des Rathauses grüßte neben Willy Brandt und Helmut Kohl auch schon das schwedische Königspaar. Ihr Blick vom Balkon dürfte zuerst auf den „Alten Schweden“ gefallen sein – ein spätgotisches Bürgerhaus mit dreiteiligem Staffelgiebel aus dunkelrotem Backstein. Heute können sich dort hungrige Besucher am Schwedenhappen laben, einem traditionellen Gericht aus Rollmops, Zwiebel-Dill-Matjes und Shrimps. Der Name des ältesten Hauses am Platze erinnert an die Zeit der schwedischen Herrschaft, die der Niederlage im Dreißigjährigen Krieg folgte.
Die Wismarer bezeichnen sich als Südschweden
Die Wismarer Bucht war als südlichster Punkt der Ostsee von strategischer Bedeutung für die Schweden. Heute pflegen die Wismarer, die sich scherzhaft als Südschweden bezeichnen, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihren nördlichen Nachbarn. Beim Bummel über die belebte Krämerstraße, der 800 Jahre alten Einkaufsmeile Wismars, bleibt Stadtführer Karl-Heinz Happke plötzlich stehen. Eben hat er noch berichtet, dass auf dem Wappen der Stadt neben einer Kogge drei silberne Fische und eine Möwe zu sehen sind, da zeigt er auf ein Eckhaus im Jugendstil. „Na, kennen Sie den Laden?“ Sicher, Karstadt, daraus kann der passionierte Stadtführer nun wirklich keine Geschichte zaubern. Doch, kann er: „Hier hat alles angefangen, das ist das allererste Karstadt-Kaufhaus überhaupt.“ Mit gerade einmal 1.000 Talern und einem Möbelwagen voller Waren eröffnete Rudolph Karstadt 1881 in diesem Gebäude seine erste Filiale. Im sorgsam erhaltenen Stammhaus kann man einen Blick auf das Kontor der ersten Stunde werfen – mit dem original Schreibpult und Panzerschrank des Gründers.
Der Gang durchs Wassertor zum alten Hafen lohnt
Auf dem Weg zum Hafen werden die Häuser allmählich kleiner. Hier wohnten die einfacheren Leute, erzählt Happke und deutet auf ein kleines, blaues Haus mit kunstvoll bemalter Eingangstür und Geranien vor den Fenstern. Neben der Tür starrt Störtebeker mit seiner Augenklappe von einem Relief auf die Gasse. Darin also soll er geboren sein, der berüchtigte Seeräuber und Haudegen, der angeblich einen Vierliterkrug Bier in einem Zug leeren konnte und vor nichts Angst hatte. Der Stadtführer zwinkert verschwörerisch und verrät dann, dass es sich bei der Info-Tafel um einen Scherz handle, der vor einigen Jahren am Stammtisch ersonnen wurde. Zwar ist urkundlich belegt, dass Störtebeker in Wismar weilte, sein Geburtsort ist indes nicht überliefert. Heute hätte es Störtebeker wohl hinunter zum Wassertor getrieben. Vor dem letzten erhaltenen Stadttor mit spätgotischen Zinnengiebeln, das die Stadt vom Hafen trennt, hätte es ihm gefallen. Denn dort befindet sich die letzte von einst 182 Brauereien der Hanse. Im „Brauhaus am Lohberg zu Wismar“ entsteht nach einem 550 Jahre alten Rezept die berühmte Wismarer Mumme, ein dunkles, kräftiges Bier. Zu Zeiten des legendären Seeräubers, als Bier noch ein Grundnahrungsmittel war, hatte die Mumme mit zehn Prozent einen weit höheren Alkoholgehalt als heute. Als Ausgleich bietet das Brauhaus neuerdings einen klaren Brand aus der Mumme an, der so köstlich schmeckt, dass das Weiterziehen schwerfällt.
Der Gang durch das Wassertor zum alten Hafen lohnt sich aber. An der Lebensader Wismars wurden einst Bierfässer aufgeladen und bis nach Hinterindien verschifft. Heute ist das Treiben am Hafen friedlicher geworden: Aus den kleinen Jollen verkaufen die Händler ihre Fischbrötchen, und die Besucher sitzen in der Sonne. Es wäre vollkommen friedlich, starrten da nicht auf Dalben im Wasser zwei grimmige, überlebensgroße Holzköpfige mit Löwenmasken in die Ferne. Wo die sogenannten Schwedenköpfe an vielen Stellen der Stadt herkommen, kann nicht einmal Karl-Heinz Happke erklären. Aber nach ein paar Gläsern Wismarer Mumme ist das auch nicht mehr so wichtig.