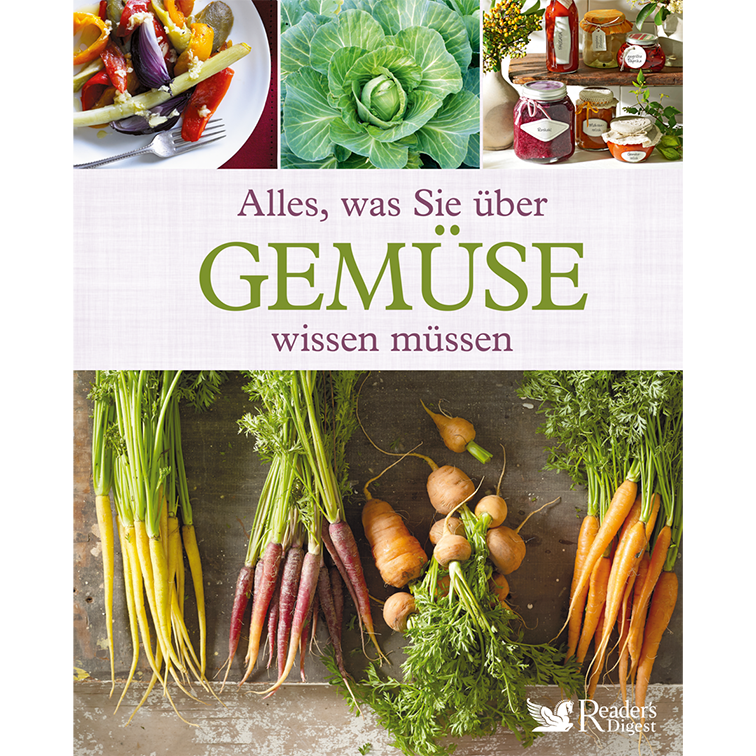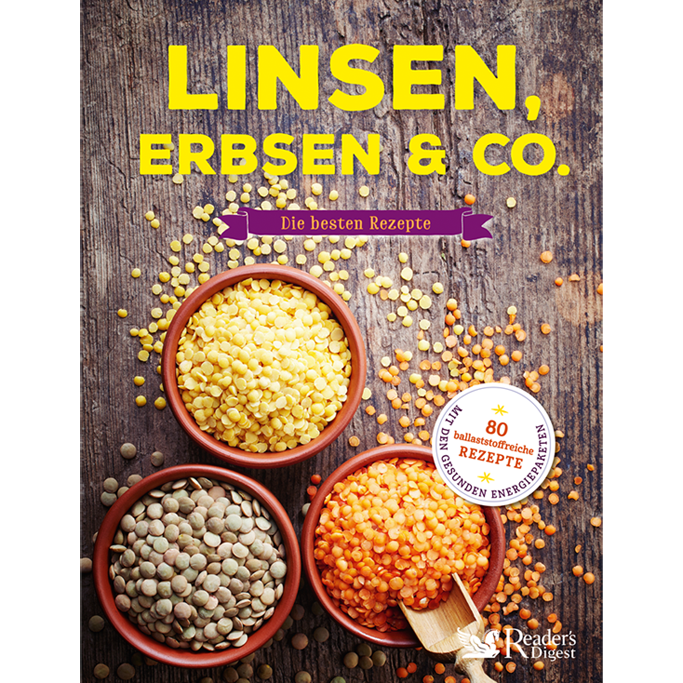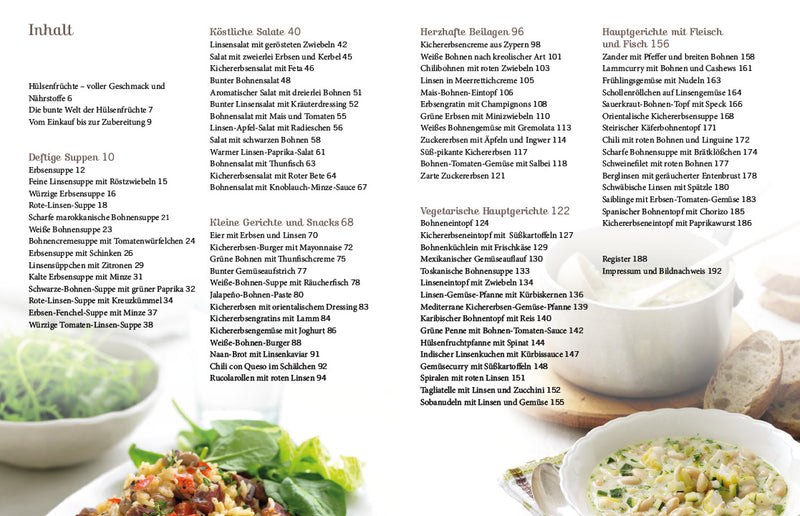Reiche Kartoffelernte
Die Kartoffel gehört zu unseren wichtigsten Nahrungsmitteln. Das war nicht immer so. Zunächst wurde die Pflanze mit großer Skepsis behandelt.

©
Eine Pflanze, die mit keinem Wort in der Bibel erwähnt wird, das fanden die Menschen früher doch reichlich dubios. Hinzu kam, dass ihre braunen Knollen im Dunkeln unter der Erde wachsen – Grund genug für die Kirche, diese als Teufelszeug zu brandmarken. Davon ließ man doch besser die Finger. Die Bevölkerung tat sich schwer mit der Kartoffel, die im 16. Jahrhundert mit den spanischen Seefahrern nach Europa kam. Von den Italienern wurde sie wegen der äußeren Ähnlichkeit mit Trüffeln „tartufolo“ genannt. Daraus leiteten sich die Bezeichnungen Tartuffel und schließlich Kartoffel ab. Wie Tomate, Mais und Paprika ist sie also ein Lebensmittel mit Migrationshintergrund.
Ihre Heimat ist Südamerika. Schon vor 5000 Jahren kultivierten die Inkas die „Frucht der Götter“, die im Gegensatz zu Getreide auch in den Höhenlagen der Anden gedieh. Ihr Reich gründete im Grunde auf der Knolle. Doch in der Alten Welt begeisterte man sich vor allem für die hübschen weißen, rosa oder lila Blüten des exotischen Souvenirs. Als Zierpflanze in den Gärten der Fürsten- und Königshäuser verbreitete sich die Kartoffel in ganz Europa. Die adelige Damenwelt, darunter die französische Königin Marie Antoinette, soll Kränze aus Kartoffelblüten in ihren Hochsteckfrisuren getragen haben.
Langer Weg vom Teufelswerk zum Grundnahrungsmittel
Unkenntnis und Unwissenheit führten auch dazu, dass die Menschen zuerst die oberirdischen Beeren, die aus den Blüten entstehen, probierten. Doch deren Verzehr führt zu Bauchkrämpfen und manchmal zu tödlichen Vergiftungen, denn die Kartoffel ist ein Nachtschattengewächs. Vor allem ihre Blätter, Beeren und Keimlinge sind giftig. Vom Teufelswerk zum Lebensretter und Grundnahrungsmittel war es ein langer, mühsamer Weg. Noch 200 Jahre nach ihrer Ankunft wollte kaum jemand Kartoffeln essen. Vor allem die Preußen misstrauten den Erdäpfeln mit dem schlechten Ruf, obwohl man inzwischen wusste, dass ihre Knollen gekocht genießbar waren und satt machten. Dabei hungerte das Volk aufgrund von Pest und Kriegen.
1740 bestieg Friedrich der Große den Thron. Er erkannte den Wert der nahrhaften Knolle und erließ für Schlesien den Befehl, Kartoffeln anzubauen – allerdings ohne den gewünschten Erfolg. Vielleicht schickte er Pastoren als Knollenprediger durchs Land, inspizierte er den einen oder anderen Kartoffelacker. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin Brandenburg räumt jedoch mit der Legende auf, der König habe die Kartoffel in Deutschland oder speziell in Preußen eingeführt und verbreitet. Gegessen habe er sie auch nicht. Nach Missernten in den Jahren 1770, 1771 und 1772 öffnete er stattdessen seine Getreidespeicher für das Volk. Das Potenzial der Kartoffel, deren Ertrag um ein Vielfaches höher ist als der von Getreide, schöpfte er nicht aus. Der Siegeszug der robusten Knolle, die auch auf kargen, steinigen Böden gedeiht, begann erst im 19. Jahrhundert. Sie ernährte – lange als Arme-Leute-Essen – die inzwischen rasch wachsende Bevölkerung. Aber auch Goethe schwärmte: „Morgens rund, mittags gestampft, abends in Scheiben, dabei soll’s bleiben, es ist gesund.“
Forschung für Kartoffelanbau auf dem Planeten Mars
Tausende Sorten gibt es heute rund um den Globus, etwa 200 sind in Deutschland vertreten: braune, rote, violette, dicke, lange, runde, fest oder mehlig kochende. Sie ernähren einen Großteil der Welt. Längst kennen wir den Wert der mineralstoff- und vitaminreichen, vielseitig verwendbaren Kartoffel. Die leckere Wunderknolle liefert zudem hochwertiges Eiweiß und weniger Kalorien, als man ihr andichtet. Wie den Rosen haben wir den Sorten Namen gegeben. Sie heißen Linda, Sieglinde, Annabelle, Augusta oder Goldmarie. Und die NASA forscht an einer Sorte, die auf dem Mars gedeiht.
Bis heute staunen Touristen aus dem Ausland über Kartoffeln, die die Grabplatte Friedrich des Großen vor dem Potsdamer Schloss Sanssoucis schmücken. Die Legende lebt, ebenso wie jene, dass die Deutschen die Kartoffel- esser Nummer eins seien. Dabei liegen wir weit unter dem EU-Durchschnitt, den die Iren, Polen und Letten kräftig anheben. Und was wären die Amerikaner ohne ihre Pommes?
Bis Mitte des 20. Jahrhunderts aber gehörte zu jedem bäuerlichen Betrieb ein Kartoffelacker. Denn mit Kartoffeln konnte man auch das Vieh füttern, mit Kartoffelschnaps Automobilmotoren antreiben und Köpfe günstig zum Glühen bringen. Die Herbstferien hießen damals Kartoffelferien. Zur Erntezeit mussten alle von morgens bis abends mit anpacken. Nach der Plackerei loderten dann im ganzen Land die Kartoffelfeuer, bei denen das Kraut verbrannt wird. Dann zog der Duft von gerösteten Erdäpfeln in den schon kühlen Herbstnächten über die Felder.
Diese schöne Tradition wird vielerorts noch immer gepflegt und oft von Vereinen organisiert. Dabei wird auch Stockbrot über dem Feuer gebacken sowie Butter und Salz zu den Kartoffeln aus der Glut gereicht, denn damit schmecken sie am besten. Zu großen Kartoffelfesten mit Markt und Programm laden landwirtschaftliche Betriebe wie die „Domäne Dahlem – Landgut und Museum“ im Südwesten Berlins ein. Besucher dürfen selbst Kartoffeln vom Feld ernten und natürlich Kartoffelspezialitäten genießen.
Das Gold der Inkas ist mittlerweile das drittwichtigste Grundnahrungsmittel der Welt und lässt sich am Tag der Kartoffel am 19. August international feiern. Vergangenes Jahr erhielt die tolle Knolle eine außergewöhnliche Auszeichnung: Sie wurde bei uns tatsächlich zur Giftpflanze des Jahres 2022 gewählt.