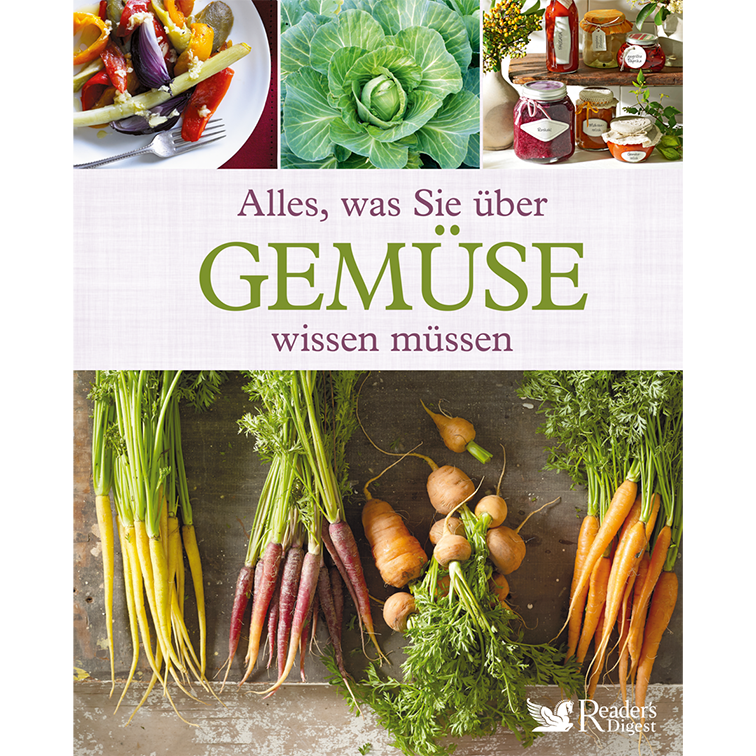Streuobstwiesen, kleine Paradiese
Streuobstwiesen sind artenreiche Naturräume und Heimat vieler alter Sorten. Nicht nur Äpfel reifen auf der Streuobstwiese, sondern auch Birnen, Zwetschgen, Kirschen und Nüsse.

©
Was hat eine jahrhundertealte Gesetzgebung mit einem schmackhaften Apfelkuchen zu tun? Jede Menge! Denn ab dem 17. Jahrhundert mussten in vielen deutschen Fürstentümern alle, die heiraten oder umziehen wollten, Bäumchen auf öffentlichem Grund pflanzen. Die sogenannten Ehestands-Baumgesetze trugen zur Entstehung einer neuen Kulturlandschaft bei: die Streuobstwiese. Hier könnte er also ganz entspannt wachsen, der Apfel für den besagten Kuchen aus heimischem Obst – wenn die Streuobstwiesen nicht allerorten bedroht wären. Was man beim Anblick der weiten Flächen, die vor allem den deutschen Südwesten prägen, zunächst einmal gar nicht glauben mag.
Im Herbst schlägt die Stunde der feinen Traditionssorten
Im Frühjahr verwandeln diese sich – locker bepflanzt mit Apfel-, Birnen-, Kirsch- und Pflaumen- oder Zwetschgenbäumen unterschiedlicher Sorten und jeden Alters – in einen weiß-rosafarbenen Traum. Alle Jahre wieder flutet ein Meer aus Obstblüten die sattgrünen Blumenwiesen. Mit den Pflanzgeboten nach 1650 wollten die Obrigkeiten den Verwüstungen des Dreißigjährigen Kriegs entgegenwirken, der kurz zuvor zu Ende gegangen war. In den Fürstentümern, Grafschaften und kirchlichen Ländereien nahm der Obstbau Fahrt auf, wurde immer weiter verfeinert – und 1758 sogar zu einer Wissenschaft: Johann Hermann Knoop veröffentlichte in diesem Jahr sein Werk „Pomologia“ mit einer Systematik der Obstsorten. Die Pomologie war geboren.
Im Frühjahr bezaubert uns die Schönheit der Streuobstwiese, ihre eigentliche Hochzeit hat die Kulturlandschaft aber im Herbst. Dann spielt sie ihre Trümpfe aus, in Form sattreifer Früchte, die nur darauf warten, verspeist, vergoren, gebrannt oder gebacken zu werden. Jetzt schlägt die Stunde der lokalen Sorten. Vollmundig, saftig, erntefrisch stecken sie das industriell gezüchtete Einheitsobst locker in die Tasche. Wenn man sie denn erntet.
Denn genau das ist das Problem: Streuobstwiesen sind zu Liebhaberprojekten geworden. Die extensive Bewirtschaftung – das Ernten des Obstes, das Mähen der Wiesen für Grünfutter, das Beschneiden der Bäume – lohnt sich für viele Besitzer nicht mehr. Angestoßen wurde diese Entwicklung in den 1950er-Jahren: Europa setzte ab da auf kostengünstigere, maschinell bewirtschaftbare Plantagen mit kleinen Bäumen. Sogar eine Rodungsprämie für die „Hochstammbäume“ wurde bezahlt. Und auch heute noch werden dort, wo Streuobstwiesen existieren, Straßen geplant und Neubaugebiete ausgewiesen. Um bis zu 80 Prozent, so schätzen Experten, ist ihre Fläche in den letzten Jahrzehnten zurückgegangen.
Zwischen den Bäumen tummelt sich das Leben
Ihren Namen haben Streuobstwiesen erst seit den 1970er-Jahren. Er soll ausdrücken, was die früheren Bezeichnungen „Obstbau in Streulage“ oder „Streuobstbau“ nicht können: Dass es neben dem Obstbau vor allem auch um die Natur zwischen den Bäumen geht. Mehr als 5000 Tier- und Pflanzenarten haben Naturschützer dort ausgemacht. Darunter sind Bienen, Schmetterlinge und unzählige andere Insekten, Vögel wie Steinkauz und Gimpel, aber auch Fledermäuse, Blindschleichen, Wiesel oder Siebenschläfer. Und dann ist da ja auch noch die Vielfalt der oft uralten Obstsorten, die kultiviert wird: Von nicht weniger als 250 Kirschsorten gehen die Pomologen aus, dazu mehr als 300 Zwetschgen-, 1000 Birnen- und sogar 1200 Apfelsorten.
Die tragen so wunderbare Namen wie Schafsnase, Geflammter Kardinal, Schleswiger Erdbeerapfel, Goldparmäne. Oder Edelborsdorfer: Er ist goldgelb, klein und kugelrund und soll der älteste Kulturapfel Deutschlands, vielleicht sogar Europas sein. Schon im 12. Jahrhundert haben ihn Zisterziensermönche gezüchtet, vermutet man. Später galt er als ausgestorben, bis er vor wenigen Jahren wiederentdeckt wurde – ein Zeichen der Hoffnung. Denn wiederentdeckt haben die Menschen auch die Streuobstwiese im Allgemeinen. 2021 wurde sie von der Unesco zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland ernannt. Die Bewirtschaftung von Streuobstwiesen wird von der Politik gefördert, auf Wochenmärkten finden sich die traditionellen Obstsorten wieder. Wer sie kauft, unterstützt – auch ohne eigenhändig zu mähen und zu ernten – die Erhaltung einer einzigartigen Kulturlandschaft. Die würde nämlich ohne diese Pflege langsam aber sicher wieder zu Wald werden.