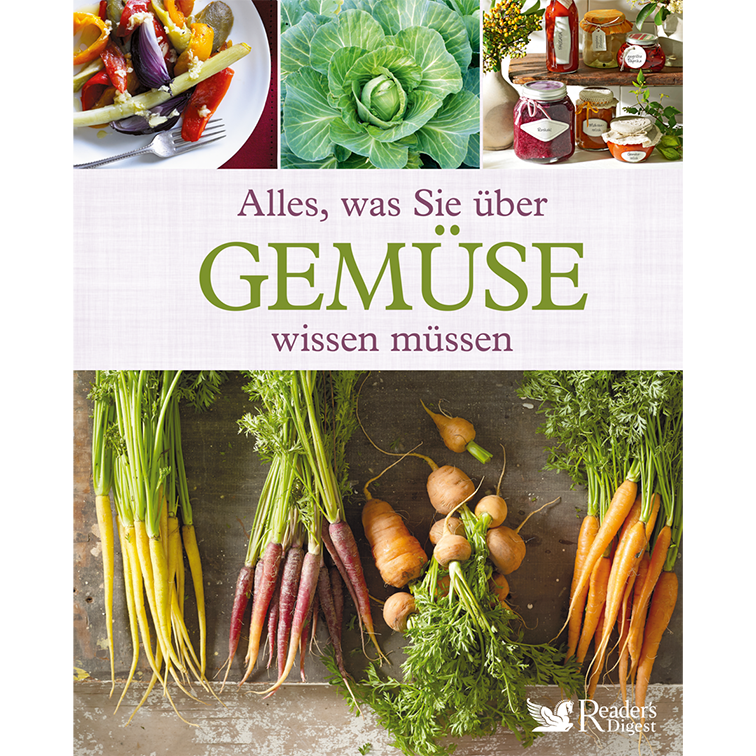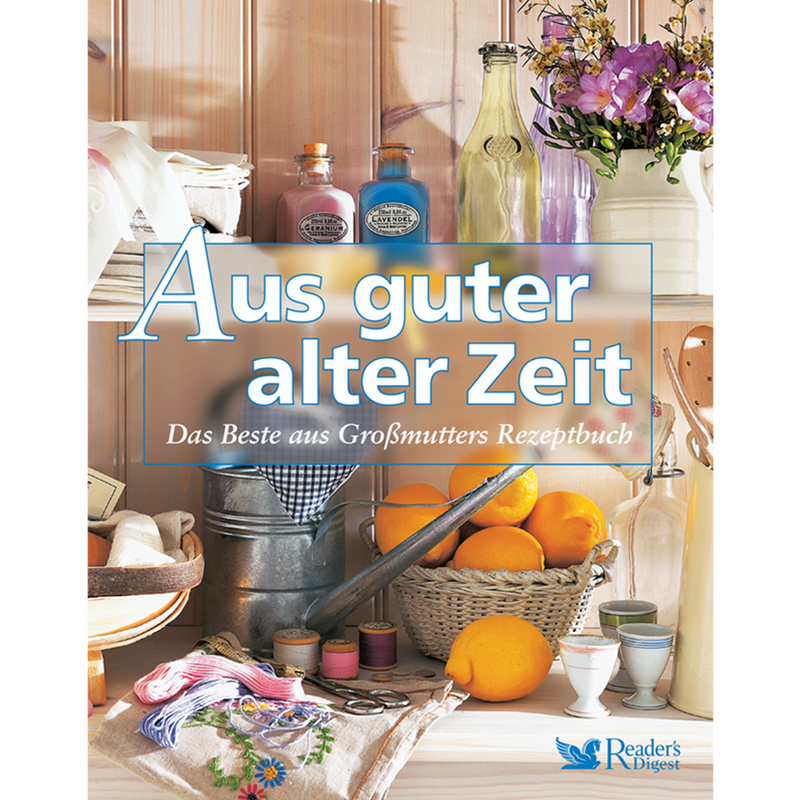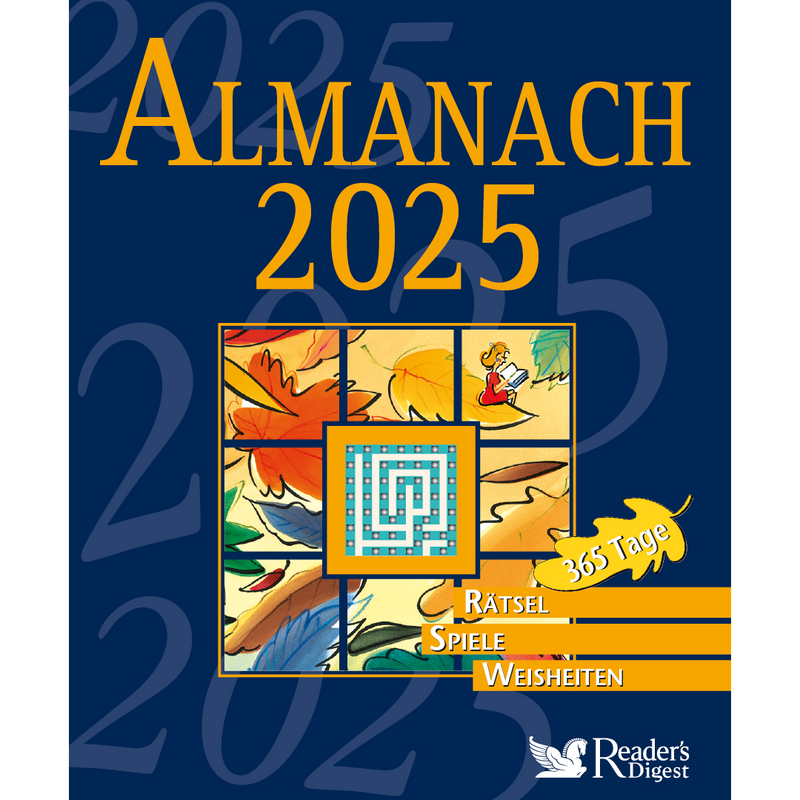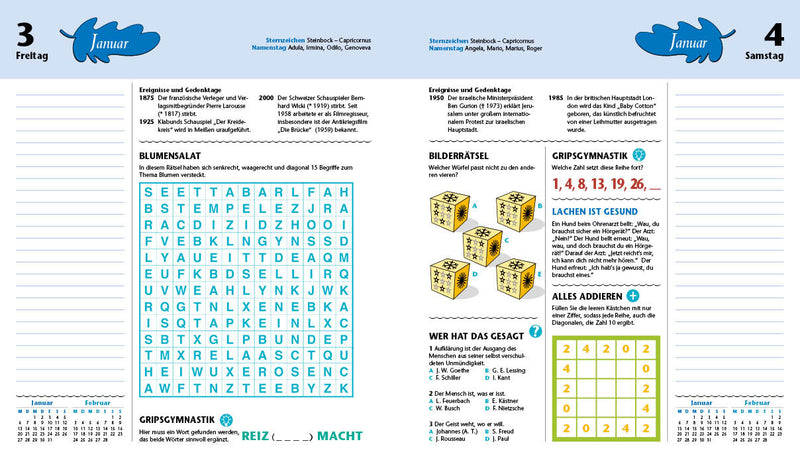Wirkung und Möglichkeiten von mRNA-Impfstoffen
Auf der mRNA-Technologie basierende Impfstoffe gegen Corona sind Gegenstand von vielen kontroversen Diskussionen. Dabei ist das weitreichende Potenzial von Therapien, die auf RNA beruhen, in der Öffentlichkeit kaum bekannt.

©
Die Möglichkeiten beschränken sich nicht nur auf die Prävention von Infektionskrankheiten: Auch therapeutisch können diese Impfstoffe im Kampf gegen Krebs oder als Medikament bei schweren Erbkrankheiten eingesetzt werden.
Unsere Erbsubstanz, die DNA, galt lange als Schlüssel zu unserer Identität: Anhand dieses genetischen Codes, der in jeder Zelle derselbe ist, entscheidet sich, wer wir sind. Warum sieht jeder ein bisschen anders aus als ein anderer? Wie werden wir zu der Person, die wir sind? Aber auch: warum entstehen Krankheiten? Und warum hat eine Person eine Krankheit, die eine andere nicht hat?
Jeder Mensch hat seine eigene, einzigartige Erbinformation, seinen genetischen Fingerabdruck. 2001 wurde das menschliche Genom entschlüsselt. Die Ergebnisse verblüffen, denn zwischen Menschen liegen die Gemeinsamkeiten bei 99,9 %. Die Frage, wie diese verschwindend geringen Unterschiede der DNA dennoch einzigartige Individuen hervorbringen, führte die Wissenschaftler zu einem lang unterschätzten Molekül, der Ribonukleinsäure, kurz RNA. Informationen werden abgeschrieben Die RNA liegt, ebenfalls wie die Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA, im Zellkern. Auf der DNA steht der genetische Code, der im Grunde eine Bauanleitung für Proteine, also Eiweiße, ist. Um diese Informationen in Proteine umschreiben zu können, muss die Botschaft erst einmal den Zellkern verlassen, denn die Produktionsstätte für Proteine liegt außerhalb des Zellkerns. Und hier kommt die RNA ins Spiel: Im Unterschied zur DNA kann sie den Zellkern verlassen. Sie vermittelt also Informationen zwischen dem Zellkern bis zum Protein. Dafür wird die DNA abgeschrieben und es entsteht eine instabile RNA, die nun den Zellkern verlässt. Ihre Information wird in der Zelle in einer Proteinproduktionsstätte zunächst in Aminosäuren übersetzt, die sich schlussendlich zu einem Protein falten.
RNA als Medikament: ein Geniestreich
Diese Genkopie therapeutisch zu nutzen ist eine einfache und zugleich geniale Idee, die eine Vielzahl an neuen Therapien ermöglicht. Denn RNA erlaubt uns, in der Sprache zu sprechen, die der Körper versteht. Das winzige Molekül ist die Schlüsselstelle der Stoffwechselwege unseres Körpers und damit indirekt Ursache für viele Krankheiten. Ingmar Hoerr war schon früh von den enormen therapeutischen Möglichkeiten der RNA überzeugt. „Innerhalb von Minuten war mir klar: Das ist eine Revolution, die wir da entdeckt haben“, sagt der Gründer von CureVac. Das Unternehmen aus Tübingen hat sich als eines der Ersten auf die Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln auf der Grundlage von RNA spezialisiert. Bereits seit 30 Jahren wird an RNA-Therapien geforscht. Lange Zeit allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Dann kam der große Durchbruch als Coronavakzin: Dem winzigen Virus, das in rasanter Geschwindigkeit eine globale Krise auslöste, musste schnell die Stirn geboten werden.
Mittels Notfallzulassung dauerte es weniger als ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie, bis der erste Impfstoff gegen Corona auf dem Markt war. Während noch kein Medikament entwickelt werden konnte, mit dem sich die Krankheit behandeln ließ, war der Impfstoff das einzig wirksame Mittel, mit dem nicht nur schwere Verläufe verhindert werden konnten. Auch weniger Menschen infizierten sich durch die Impfung mit dem Virus.
%%%contend-ad-gesundheit%%%
Wie funktioniert die Impfung?
Bei einer Impfung soll das Immunsystem auf den Krankheitserreger vorbereitet werden. Indem bereits vor einer Infektion das Oberflächenprotein des Virus in den Körper gelangt und bekämpft wird, kann das Immunsystem dank seines guten Gedächtnisses bei einer späteren Infektion genau dieses Oberflächenprotein des Krankheitserregers erkennen. Die Antwort des Immunsystems bei einer richtigen Infektion erfolgt dann unmittelbar und mit sofortiger Wirkung. Beim neuartigen mRNA-Impfstoff (das m steht für messenger = Transport) wird nun nicht, wie bei der herkömmlichen Impfung, das abgeschwächte Protein des Krankheitserregers verabreicht. Im Impfstoff enthalten ist lediglich die mRNA. Die Produktion des Proteins übernimmt der Körper selbst.
Vorteile der RNA-Technik
Zeitaufwendig in der Produktion von Impfstoffen war bislang vor allem die Herstellung von Proteinen, die das Immunsystem auf eine Infektion vorbereiten sollen. Für die Herstellung eines Grippeimpfstoffes etwa werden die Grippeviren in Hühnereiern angezüchtet und im weiteren Verlauf aufgereinigt, sodass nur noch das erwünschte Oberflächenprotein übrig bleibt. Diese Art der Herstellung für große Mengen des Proteins ist zeitaufwendig und teuer. Mit mRNA-Impfstoffen wird dieser Schritt in den eigenen Körper verlagert. Man benötigt nur eine kleine Anzahl entsprechender Viren. Aus diesen wird die DNA-Sequenz des Zielproteins analysiert und als Matrize zur Synthese zusammengefügt. Nach diesen Vorgaben lassen sich in kurzer Zeit große Mengen an mRNA herstellen.
Grenzen der RNA
Zwar wird für eine Impfung ein charakteristisches Oberflächenantigen des Virus benutzt, weil dadurch bereits präventiv das Virus vor dem Eindringen in die menschliche Zelle – also vor der Infektion – eliminiert wird, allerdings ist, wie im Falle des Coronavirus, solch ein Spikeprotein aufgrund der rasch erfolgenden Mutationen recht wandelbar. Deshalb wirkt der Impfstoff im schlechtesten Fall bei entsprechenden Mutationen nicht mehr und muss durch eine modifizierte Form nachgebessert werden, ein Vorgang, der Zeit kostet. Ein weiterer Nachteil der mRNA-Impfstoffe ist, dass sie nur auf Proteine hergestellt werden können und nicht für andere Zielstukturen wie Polysaccharide, etwa Bakterien und Pilze.
Nebenwirkung oder Impfreaktion
Bei allen Impfungen ist es wichtig, zwischen Impfreaktion und Nebenwirkung zu unterscheiden: Impfreaktionen treten direkt im Anschluss an eine Impfung auf und dauern meist nur kurze Zeit. Sie sind Zeichen einer Immunreaktion des Körpers und deshalb unbedenklich. Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Herzklopfen, Atemnot oder Brustschmerzen hingegen treten erst vier bis 16 Tage nach der Impfung auf und sind Gegenstand von neu entflammten Debatten und intensiver Forschung. Das gilt auch für sogenannte „Langzeitnebenwirkungen“, die scheinbar unerwartet und erst lange Zeit nach einer Impfung auftreten. Die Informationen hierzu werden im Paul-Ehrlich-Institut gesammelt.
Impfstoff gegen Krebs
Maßgebend hilfreich für die schnelle Entwicklung des mRNA-Impfstoffs war die jahrelange Forschung an Krebs. Tatsächlich wird schon seit 30 Jahren an einer mRNA-basierten Impfung gegen Krebs geforscht, aber bislang hat man mit keinem Medikament einen Durchbruch erzielt. Und das hat Gründe, die in der Entstehung von Krebs liegen. Vorläuferzellen von Krebs entstehen mehrmals täglich. Was sich erschreckend anhört, ist eigentlich kein Problem für das Immunsystem: Normalerweise werden die Vorläuferzellen zuverlässig vom Immunsystem erkannt und ausgeschaltet. Falls es den Vorläuferzellen allerdings gelingt, sich vor dem Immunsystem zu tarnen, entsteht Krebs. Die Impfung zu therapeutischen Zwecken funktioniert im Prinzip ähnlich wie eine Impfung zur Vorbeugung von Corona. Anstatt gegen Oberflächenproteine von Krankheitserregern soll das Immunsystem auf die besondere Oberfläche von Krebszellen angesetzt werden. Dafür wird dem Patient Krebsgewebe entnommen. Die speziellen, unnatürlichen Proteine der Krebszellen werden identifiziert und die mRNA für eine Impfung aufbereitet. Das hilft dem Immunsystem, Fremdes wieder als Fremdes zu erkennen und zu bekämpfen.
Ein Molekül – viele Möglichkeiten
„Welch zentrale Rolle die RNA im Leben spielt, ist außerhalb von Fachkreisen kaum bekannt“, sagt Jonathan Hall, Professor für Pharmazeutische Chemie an der ETH Zürich. Gut möglich, dass vor allem die große Vielfalt und Komplexität des kleinen Moleküls dafür der Grund ist. Viele verschiedene RNAs sind mittlerweile gut beschrieben. Wie Medikamente auf der Basis von RNA wirken, lässt sich verstehen, wenn man weiß, wie die unterschiedlichen RNAs funktionieren. Ein Beispiel hierfür ist die sogenannte siRNA. Sie ist kleiner als mRNA, aber gerissen in ihrer Funktion, denn sie interagiert mit der mRNA, sodass bestimmte Abschnitte nicht mehr in Proteine umgeschrieben werden können. Hinter dem Einsatz dieser Moleküle in Medikamenten steht der Versuch, krank machende Proteine abzuschalten. Ein erstes Medikament, das auf dem Abschalten von RNA mittels siRNA beruht, wurde bereits 2018 zugelassen. Mit Patisiran wird die seltene Erbkrankheit Transthyretin- Amyloidose behandelt. Die von der Nervenkrankheit Betroffenen leiden unter einer Vielzahl von Symptomen: Taube Hände und Füße, Beschwerden beim Urinieren, Erektionsprobleme, Veränderungen der Herzmuskulatur sowie Lähmungen sind nur einige Krankheitszeichen. Grund dafür ist die Ablagerung fehlerhafter Proteine, die vom Körper nicht mehr abgebaut werden können. Das Medikament zielt auf die mRNA des Körpers ab, die als Vorlage für das fehlerhafte Protein dient. Die enthaltene siRNA interagiert mit der mRNA und schaltet sie dadurch ab. Es ist eine Möglichkeit zur vorübergehenden Stilllegung von Genen.
Medikamente im Körper herstellen
Eine weitere Möglichkeit, RNA therapeutisch zu nutzen, ist die Herstellung von Medikamenten im Körper. Sinnvoll ist das vor allem, wenn die eigene Erbsubstanz fehlerhaft ist und deshalb lebenswichtige Eiweiße nicht hergestellt werden. Durch die direkte Verabreichung von mRNA ist die körpereigene Vorlage nicht mehr notwendig. Was wie die Lösung für die Ursache vieler unterschiedlicher Krankheiten klingt, stellt sich in der Praxis als schwierig heraus: Weil mRNA im Körper so schnell abgebaut wird, verweilt sie kaum lang genug im Körper, um oft genug abgeschrieben zu werden. Je häufiger die mRNA abgeschrieben wird, desto größer ist die Menge an entstandenem Protein. Um also überhaupt einen Effekt gegen die Krankheit zu haben, muss auch die Menge des Proteins groß genug sein. Eine Impfung gegen Herzschwäche Ein Krankheitsbild, bei dem RNA als Medikament im Körper zum Einsatz kommen könnte, ist die Versteifung des Herzens infolge einer Herzfibrose, deren Ursache nicht bekannt ist. Das geschwächte Herz versucht, die verminderte Pumpleistung durch ein größeres Volumen auszugleichen, und dazu wird Bindegewebe zwischen die Herzmuskelzellen eingeschoben. Ähnlich wie bei einem Impfstoff gegen Krebs sollen bei einem Therapieansatz Immunzellen so umprogrammiert werden, dass sie gegen die krankhafte Versteifung des Herzens vorgehen. Im Tierversuch mit Mäusen ist dies bereits gelungen: RNA, die so konstruiert wurde, dass sie gegen Bindegewebezellen gerichtet ist, wurde in einer Lipidhülle in den Körper der Maus injiziert. Außerdem wurde die Hülle so dekodiert, dass die Partikel direkt von Immunzellen aufgenommen wurden. Diese produzieren also dann das RNA-Produkt und transportieren dieses zum Herzen. Eine Spritze genügte, das Herzvolumen der Mäuse zu reduzieren und die Herzfunktion wieder zu normalisieren.
Ein Blick in die Zukunft
Die Liste der Infektionskrankheiten, gegen welche aktuell mRNA-Impfstoffe entwickelt werden, ist lang. An Impfungen gegen Malaria, Gürtelrose, HIV und Tollwut wird geforscht. Denkbar ist auch, dass es in einer zweiten Welle bivalente oder trivalente Impfstoffe geben wird, sodass man sich mit einer einzigen Impfung gegen mehrere Infektionskrankheiten schützen kann. Ein Impfstoff gegen Krebs wird wohl frühestens in fünf Jahren zugelassen werden, hilfreich dabei sind sicher die vielen Studien über Verträglichkeit sowie Nebenwirkungen und der Erfahrung, die mit dem Coronavakzin gesammelt werden konnte. Die RNA als Biomolekül birgt ein großes Potenzial und viel davon beginnen Forschende gerade erst zu verstehen.
Impfskepsis: Verändert RNA-Impfstoff Gene?
Die mRNA befindet sich ausschließlich im Zellkörper, außerhalb des Zellkerns. Ihre Information kann nicht einfach zu einem DNA-Code umgeschrieben werden, da hierzu die nötigen Enzyme fehlen. Sie weist damit eine unterschiedliche chemische Struktur zur DNA auf. Infolge könnte sie auch nicht in das Erbmaterial eingebaut werden, wenn sie denn – was nie geschieht – den Weg zurück in den Zellkern fände. Es handelt sich grundsätzlich um eine Form der Einbahnstraße. Außerdem ist die mRNA recht instabil und zerfällt rasch.