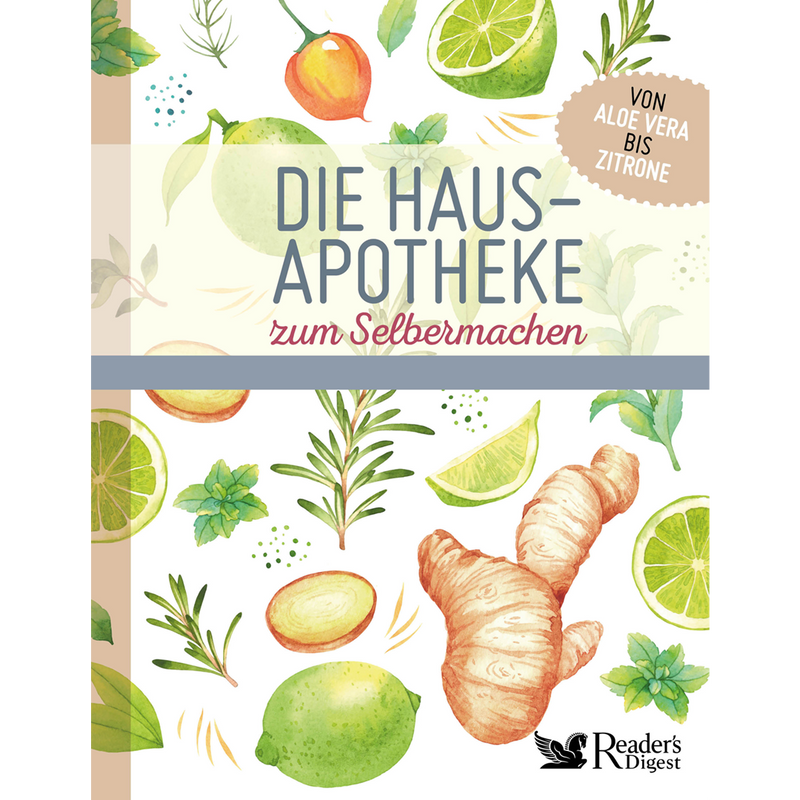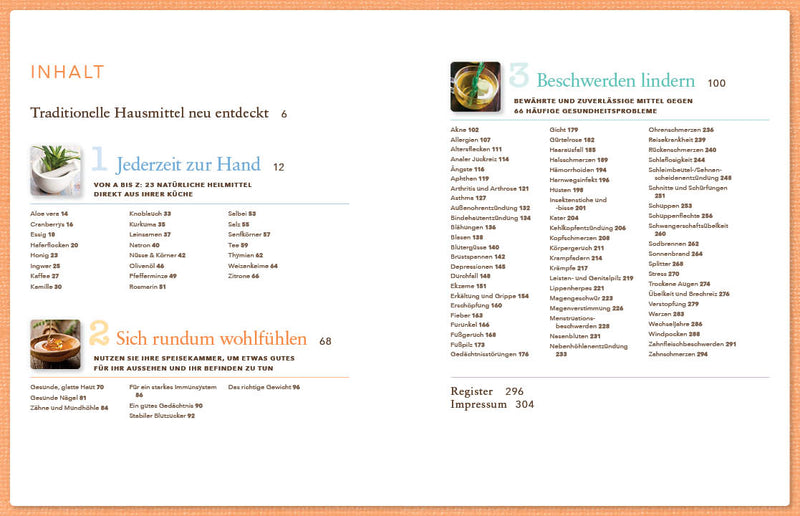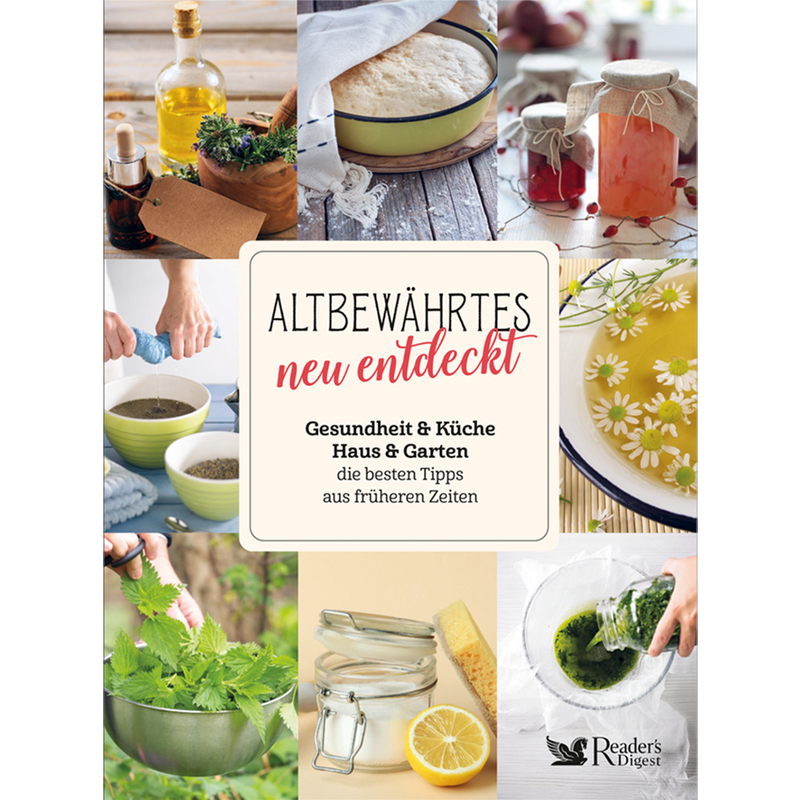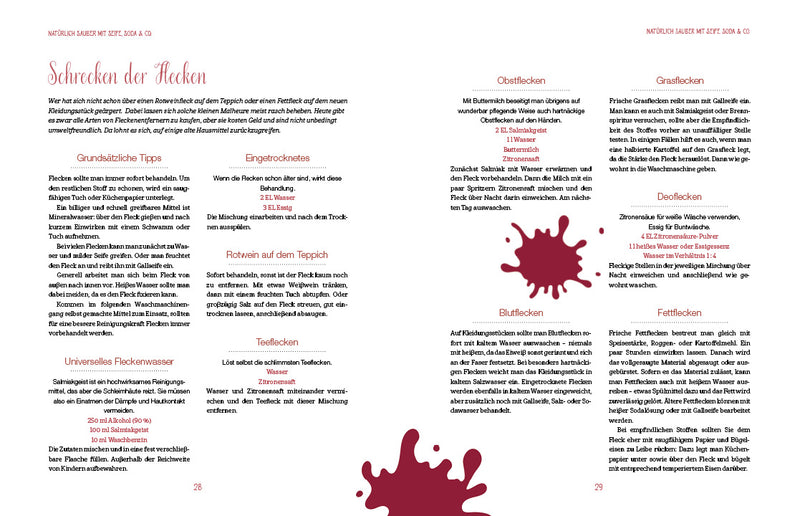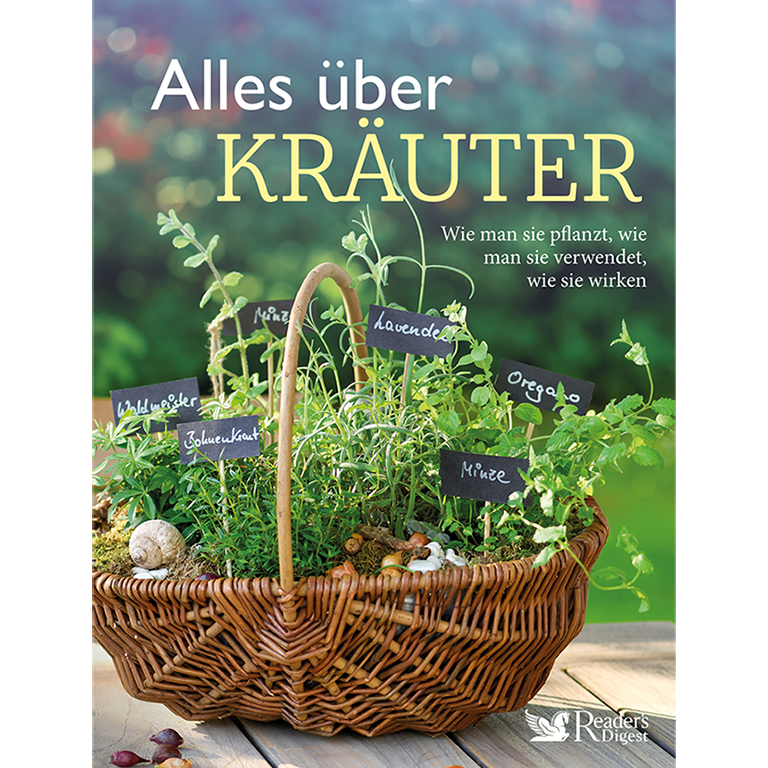Woran erkennt man eine Gehirnerschütterung?
Menschen mit Gehirnerschütterungen riet man früher zu absoluter Ruhe in dunklen Räumen. Nun bringen neue Forschungsergebnisse Licht ins Dunkel.

©
Nicole Weeks erlitt im Januar 2023 eine Gehirnerschütterung. Fast ein ganzes Jahr lang kämpfte sie mit Symptomen wie Migräne, Müdigkeit und Schwindel. Zunächst war der 43-Jährigen nicht bewusst, wie hart sie mit dem Kopf aufgeschlagen war. „Ich lief auf dem Bürgersteig, rutschte auf einer Stelle mit Glatteis aus und schlug mit dem Hinterkopf auf“, erzählt sie. Eine Minute lang blieb die junge Frau unter Schock mit ausgebreiteten Armen auf dem Rücken liegen.
Dann stellte sie erleichtert fest, keine Verletzungen zu haben, wischte sich den Schmutz von der Kleidung und eilte weiter zum Brunch mit einer Freundin. Während des Treffens fühlte sich Weeks benommen und ihr war, als rede ihre Freundin aus weiter Ferne zu ihr. Da sich dieser Zustand wieder legte, machte sie sich keine weiteren Gedanken. Erst eine Woche nach dem Sturz wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert. Die späte Behandlung könnte einer der Gründe sein, warum die Nachwirkungen so lange anhielten.
Was passiert bei einer Gehirnerschütterung?
Das Gehirn wird durch eine stoßdämpfende Flüssigkeit sowie durch den Schädel geschützt. Bei einem harten Schlag prallt es gegen den Schädelknochen und kann dabei auch gedreht werden. Die Neuronen im Gehirn werden durcheinandergewürfelt und die dazwischenliegenden Axone – dünne Fasern, die elektrische Impulse weiterleiten – werden überdehnt oder zerreißen. Durch den Stoß kann zudem der Blutfluss zum Gehirn verringert und die Mitochondrien (Energielieferanten in den Neuronen) können geschädigt werden.
Für das Gehirn ist das wie ein mittelschweres Erdbeben: Es steht zwar noch alles, aber Straßen und Gebäude haben Risse. Die mikroskopisch kleinen Schäden haben schwerwiegende Folgen – darum werden Gehirnerschütterungen auch als leichte Schädel-Hirn-Traumata bezeichnet. Das Gehirn verwendet viel Energie darauf, sich zu regenerieren. Zusammen mit einer geringeren Blutzufuhr und Funktionsstörungen der Mitochondrien kann das zu extremer Müdigkeit führen. Weitere Symptome sind Kopfschmerzen, Erinnerungslücken, Gereiztheit, Schlaflosigkeit, Gleichgewichts- und Sehstörungen. Noch vor einigen Jahrzehnten wurden Gehirnerschütterungen in der Öffentlichkeit mit der Bemerkung abgetan: „Das gibt sich wieder.“ Inzwischen sind die langfristigen Auswirkungen besser bekannt.
Der US-amerikanische Film Erschütternde Wahrheit von 2015 erzählt die wahre Geschichte des forensischen Pathologen Dr. Bennet Omalu, der die chronische-traumatische Enzephalopathie (CTE) untersuchte: eine Gehirnerkrankung, die durch wiederholte Kopfverletzungen verursacht wird. CTE führt zu Zellabbau und Symptomen wie Beeinträchtigung des Urteilsvermögens und Demenz.
Die Krankheit lässt sich nur durch eine Obduktion endgültig nachweisen. In den letzten Jahren stellte sich heraus, dass mehrere ehemalige American-Football-Spieler darunter litten. Möglicherweise ist auch der 2023 verstorbene René Weller, einer der bekanntesten deutschen Boxer, von CTE betroffen gewesen. Doch nicht nur Profisportler ziehen sich Gehirnerschütterungen zu. Menschen jeden Alters erleiden diese täglich durch Stürze, Sport-, Arbeits- oder Verkehrsunfälle.
Das Ende der Dunkeltherapie
Noch bis vor Kurzem empfahlen die meisten Ärzte ihren Patienten, sich in einem abgedunkelten Zimmer auszuruhen und alle geistigen Anstrengungen zu meiden, bis die Symptome abgeklungen waren. Diese Empfehlung basiert auf Studien aus den 1990er- und frühen 2000er-Jahren, nach denen sich Sportler mit Gehirnerschütterungen langsamer erholten, wenn sie weiterhin Sport trieben, als jene, die sich Ruhe gönnten.
Da das Gehirn nach einer Erschütterung viel Energie verbraucht, um sich zu regenerieren, folgerte man, dass körperliche wie geistige Ruhe zur Selbstheilung beitragen würde. Doch längere Zeit in einem dunklen Zimmer zu verbringen, auch Cocooning genannt, führt bei Patienten eher zu Angstzuständen, Depressionen und Schlafproblemen. Sie bewegen sich kaum, werden körperlich schwächer.
Weitere Forschungen begannen schließlich darauf hinzudeuten, dass gemäßigte Aktivitäten vorteilhafter sein könnten. Nach einer 2008 im Journal of Athletic Training veröffentlichten Studie schnitten Sportler, die nach einer Gehirnerschütterung ihre Aktivitäten im eingeschränkten Umfang wieder aufnahmen, bei Tests zu Gedächtnis, Reaktionszeit und Visuomotorik (Koordination von visueller Wahrnehmung und Bewegungsapparat) besser ab als solche, die sich stärker betätigten oder nur wenig taten.
Weitere Studien stützen die Vermutung, dass die goldene Mitte bei der Wiederaufnahme der Aktivitäten nach einer Gehirnerschütterung der beste Weg zur Genesung ist. „Inzwischen weiß man, dass wir mit der Einstellung aller Aktivitäten den Erholungsprozess sogar behindern“, sagt Shelina Babul, Expertin für Sportverletzungen und außerordentliche klinische Professorin der Abteilung für Pädiatrie an der University of British Columbia, Kanada.
Aktive Ruhe: Therapie in vier Phasen
Der Ansatz der aktiven Ruhe nach einer Gehirnerschütterung spricht für eine allmähliche Steigerung der Aktivitäten. Patienten beginnen an einem oder zwei Tagen mit einer leichten Aktivität, allmählich kommen weitere hinzu, bis sie wieder ihrem Alltag ohne Einschränkungen nachgehen können.
„Es braucht aber im Schnitt 15 bis 17 Jahre, bis wissenschaftliche Forschung vom Labor beim Patienten angekommen ist“, so Babul. Mit anderen Worten, bis Ärzte die Erkenntnisse in ihren Praxisalltag integriert haben. Babul hat deshalb ein vierstufiges Trainingsprogramm für Patienten, Ärzte, Pflegekräfte und Betreuer entwickelt, das diese für Gehirnerschütterungen sensibilisieren soll: Es ist darauf ausgerichtet, dass Betroffene stufenweise wieder in ihren Alltag zurückkehren können. Die Phasen sollten immer unter ärzt-licher Aufsicht durchlaufen werden.
Die erste Phase dauert 24 bis 48 Stunden. In dieser Zeit schlafen die Betroffenen am besten viel, vermeiden den Blick auf Bildschirme sowie Autofahren, üben aber weiterhin Aktivitäten wie leichte Hausarbeit oder Spaziergänge aus.
In Phase zwei sind einfache bis moderate körperliche Aktivitäten möglich, etwa Radfahren auf dem Heimtrainer, schnelles Gehen und Gartenarbeit. Allmählich auch wieder eine Bildschirmtätigkeit.
Vertragen die Patienten diese Anstrengungen, folgt die dritte Phase, in der sie zur Arbeit oder Schule zurückkehren und meist ihre normalen Aktivitäten wieder aufnehmen – außer Sportarten, bei denen sie durch Kopfstöße eine weitere Gehirnerschütterung erleiden könnten. Treten bei diesen normalen Aktivitäten erneut Symptome der Gehirnerschütterung auf, sollten sie eine Pause einlegen und es am nächsten Tag erneut versuchen.
In der vierten Phase, wenn die Patienten all das machen können und von ihrem Arzt grünes Licht bekommen, kehren sie ohne Einschränkungen zur Normalität zurück, einschließlich Sport treiben. Ziel ist es, die Toleranzschwelle nicht zu überschreiten, so Babul. Durch zu viele und zu frühe Aktivitäten wird das Gehirn überanstrengt. Darum ist es wichtig, auf den eigenen Körper zu hören.
Dr. Charles Tator, Neurochirurg und Leiter des kanadischen Zentrums für Gehirnerschütterung in Toronto, empfiehlt zudem, den Alkoholkonsum einzuschränken und Cannabidiol (CBD) zu meiden: „Das aus Cannabis gewonnene Öl scheint die Produktion von Botenstoffen im Gehirn zu verhindern.“
Guter Schlaf kann auch helfen, vielleicht muss man dafür auf Kaffee verzichten oder seine Schlafhygiene verbessern. Menschen, die eine Gehirnerschütterung hatten, leiden laut Tator auch häufiger an Schlafapnoe und sollten bei Verdacht darauf untersucht werden.
Langfristige Folgen vermeiden
„Gehirnerschütterungen stecken wir nicht so schnell weg, wie wir früher dachten“, so der Neurochirurg. Während die meisten Patienten in rund vier Wochen wieder genesen sind, leiden 30 Prozent länger an den Symptomen. Einige werden ihr Leben lang damit zu tun haben.
„Kein Patient mit Gehirnerschütterung gleicht dem anderen, was Anzahl und Art der Symptome oder das Genesungspotenzial betrifft. Jeder Patient muss individuell betreut werden, oft von mehr als nur einem Spezialisten“, erläutert Tator. Betroffene mit Schwindel als Hauptsymptom müssen beispielsweise einen Vestibulartherapeuten aufsuchen, der sich auf Schwindelerkrankungen spezialisiert hat, während Angstzustände, Depressionen oder posttraumatische Belastungsstörungen von Psychiatern behandelt werden.
Weitere Faktoren, die bei der Genesung eine Rolle spielen, sind die Stärke des Aufpralls sowie die Zahl bereits erlittener Gehirnerschütterungen. Bei mehr als einer Gehirnerschütterung steigt das Risiko für bleibende Schäden.
Mehr als ein Jahr nach ihrem Sturz führt Nicole Weeks wieder ein sehr aktives Leben – obgleich sie immer noch unter Symptomen wie Kopfschmerzen und Schwindel leidet. Sie bedauert, die Anzeichen für eine Gehirnerschütterung nicht früher erkannt zu haben, um diese stufenweise zu therapieren.
Darum sind Aufklärung und Sensibilisierung so wichtig, erklärt Babul. „Patienten, die sich an die richtige Behandlung und Anleitung halten, erholen sich meist problemlos, während diejenigen, die sich in ihren Aktivitäten nicht einschränken, eher an bleibenden Beschwerden leiden“, sagt sie. „Es ist wichtig, das Problem sofort zu erkennen und zu wissen, was zu tun ist.“
Symptome einer Gehirnerschütterung
Zu den physischen Symptomen gehören Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, Druck im Kopf, verschwommenes Sehen, Licht- und Geräuschempfindlichkeit, Klingelgeräusche, Gleichgewichtsstörungen, Müdigkeit oder Lethargie sowie allgemeines Unwohlsein.
Kognitiv kann sich das Trauma dadurch äußern, dass Sie sich benebelt fühlen, es Ihnen schwerfällt, klar zu denken, sich zu konzentrieren und an Dinge zu erinnern. Sie haben das Gefühl, langsamer zu sein als sonst. Emotional fühlen Sie sich vielleicht gereizt, traurig, nervös, ängstlich oder generell emotionaler. Möglicherweise schlafen Sie auch mehr oder weniger als üblich oder es fällt Ihnen schwer, einzuschlafen. Lassen Sie jeglichen Verdacht auf eine Gehirnerschütterung so schnell wie möglich ärztlich abklären.