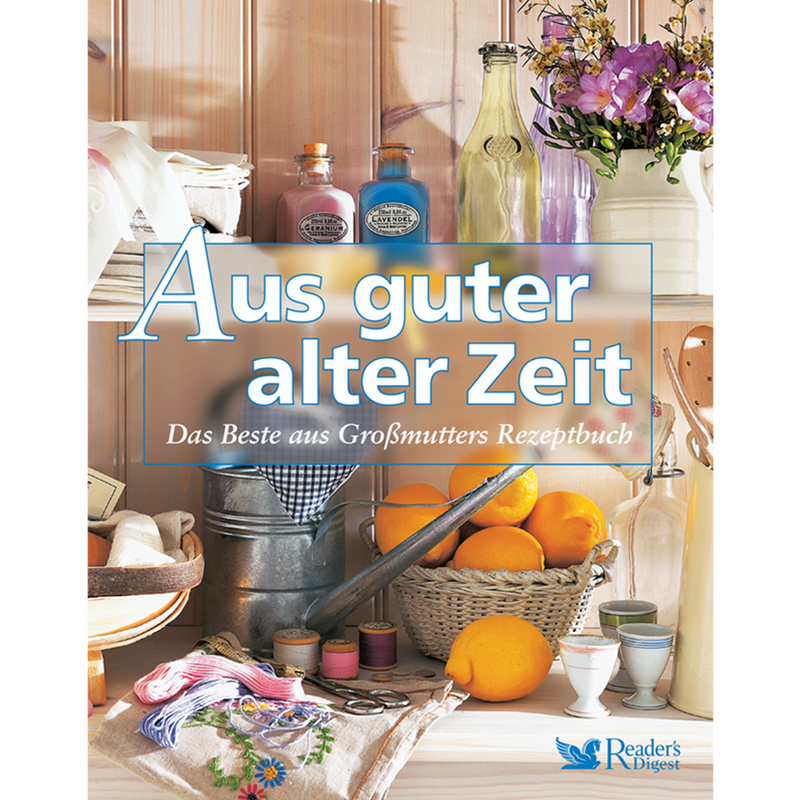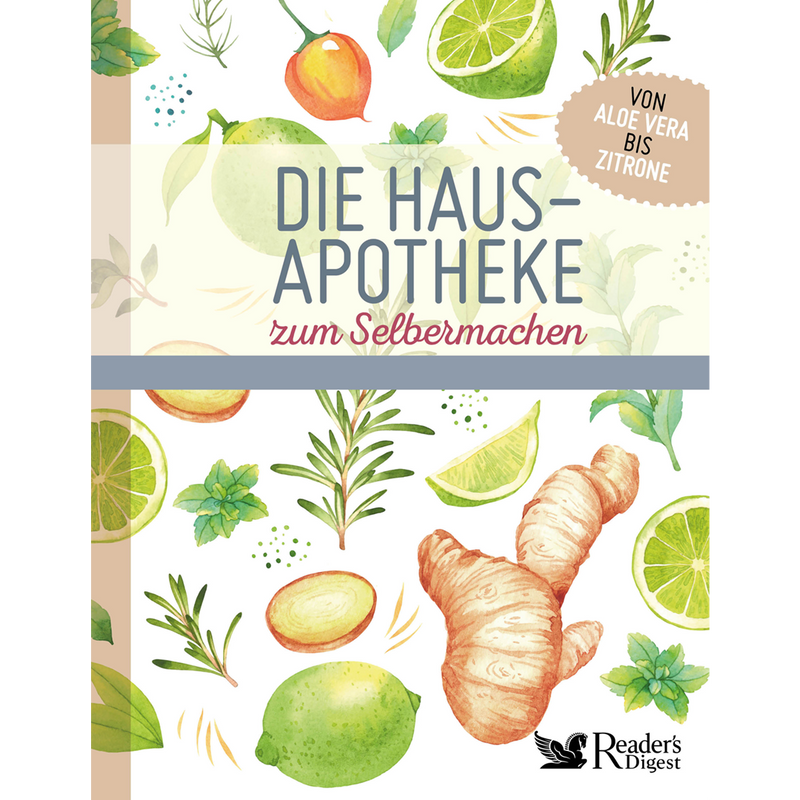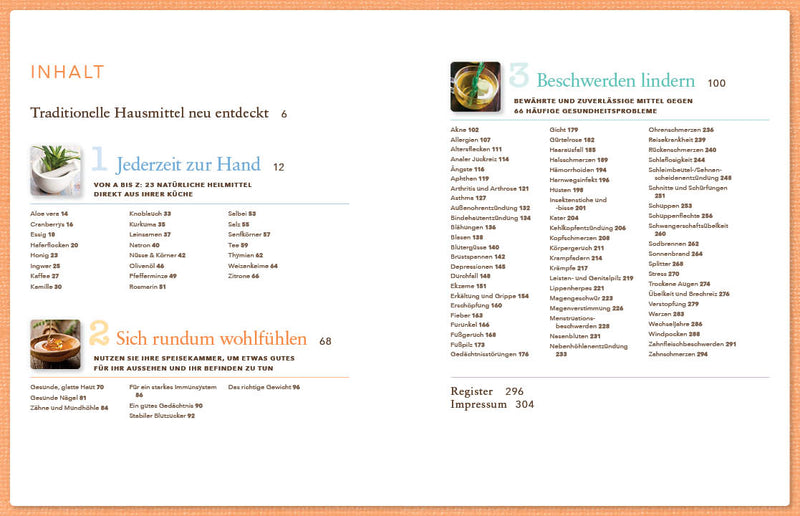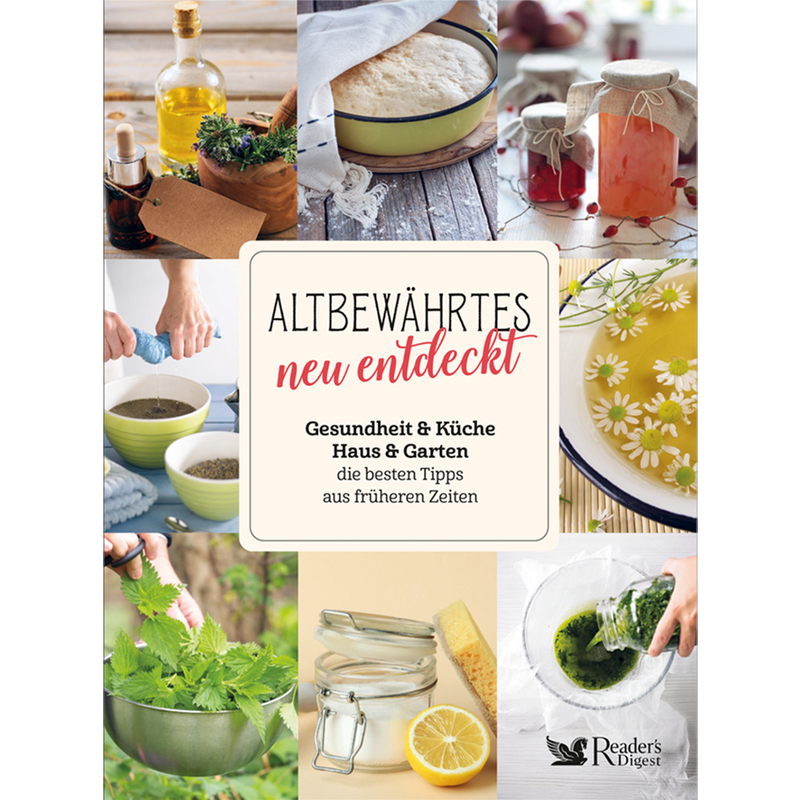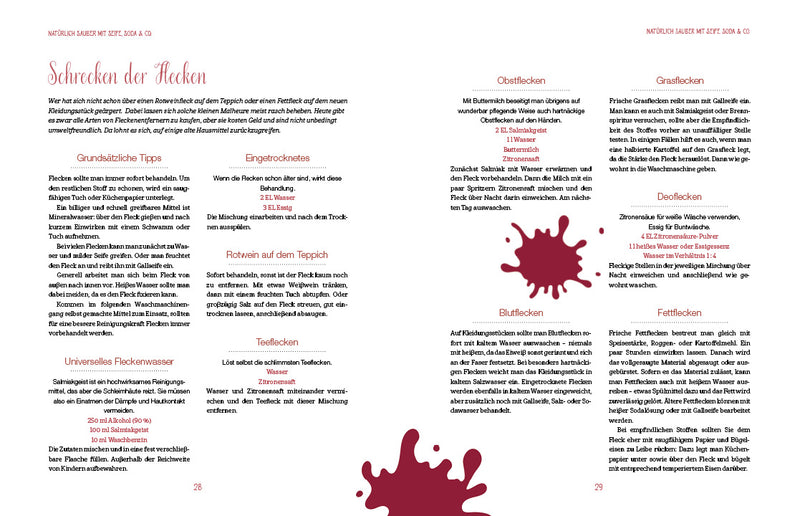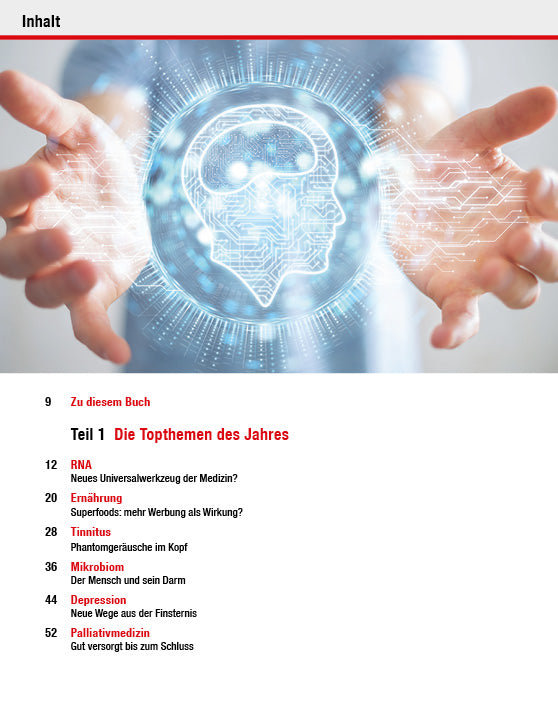Geizig, rüde, immer zu spät?
Viele Klischees über nationaltypische Verhaltensweisen enthalten ein Körnchen Wahrheit. Ja, auch über die Deutschen...

©
Ein US-amerikanischer Pfarrer erkrankte während einer Europareise schwer und musste ins Krankenhaus. Weil er fürchtete, dass sein Ende nahte, ließ er den Geistlichen des Krankenhauses an sein Bett rufen. „Vater“, sagte der Pfarrer, „wenn ich hier sterbe, komme ich dann in einen europäischen Himmel?“„Ja, mein Freund“, antwortete der Geistliche, „aber es ist ein wunderbarer Ort. Jeden Abend findet ein großes Fest statt, und die Italiener sind für das Essen zuständig. Das Unterhaltungsprogramm geht den ganzen Abend, dafür sind die Engländer verantwortlich. Und organisiert wird das Ganze von den Deutschen, es geht also niemals etwas schief.“
„Aber ich habe kein perfektes Leben gelebt“, sagte der Pfarrer. „Was, wenn ich in die Hölle komme?“ „Nun, das ist ein furchtbarer Ort“, erwiderte der Geistliche. „Abends bereiten die Engländer das Essen zu, für die Unterhaltung sind die Deutschen zuständig, und das Ganze wird von den Italienern organisiert.“
Hat dieser Witz Sie zum Schmunzeln gebracht? Dann liegt es vermutlich daran, dass die Klischees Ihnen bekannt vorkommen. Klischees und Vorurteile enthalten oftmals einen wahren Kern, das habe ich bei meiner Arbeit als Journalist festgestellt. Ich war in den Niederlanden stationiert und habe von dort aus ganz Europa bereist, vom Nordkap in Norwegen bis zum Absatz des italienischen Stiefels, von Moskau bis Dublin. Und in jedem Land bin ich auf etwas gestoßen, das man als „typisch französisch“, „typisch deutsch“, „typisch italienisch“ und so weiter ansehen konnte.
Ein Beispiel: Vor einigen Jahrzehnten nahm ich in Russland an einer Veranstaltung teil und wurde zum Mittagessen eingeladen. Es begann mit einem Trinkspruch auf internationale Zusammenarbeit und Freundschaft, worauf mit einem Glas Wodka angestoßen wurde. Der nächste Trinkspruch folgte zwei Minuten später, dann ein weiterer zwei Minuten später. Ich lernte schnell, wie ich mein Getränk unauffällig in der Pflanze hinter mir entsorgen konnte. Im Geiste sah ich mich im Kreise meiner künftigen Enkel sitzen und sagen: „Und jetzt will euch Opa mal von den Russen und ihrem Durst erzählen …“
Und dann erst die Franzosen. Wie den Italienern sagt man ihnen nach, dass sie vom Essen besessen seien. Der einzige Unterschied: Während die Italiener normalerweise keine allzu exotischen Zutaten wählen, essen die Franzosen absolut alles. (Haben Sie schon einmal Andouillette probiert? Dann wissen Sie ja, dass die dicke Schicht Senf nur notdürftig übertüncht, dass auf dem Teller Magen und Darm vom Schwein liegen.)
Ich musste einmal in einem Aquarium in der Bretagne laut loslachen. An einem der Fischbecken stand: „Dieser Fisch ist die wichtigste Zutat der traditionellen Bouillabaisse aus Marseille.“ So etwas gibt es wohl nur in Frankreich – da wird ein Tier zur Schau gestellt, und man erklärt gleich dazu, wie es normalerweise auf den Teller kommt. Meine Fantasie ging mit mir durch und ich stellte mir ein Schild im Pariser Zoo vor: „Der Rüssel des Elefanten ist das beste Stück bei l’éléphant-au-vin.“
Später ergab sich die Gelegenheit, dieses Klischee auf die Probe zu stellen, als mich nämlich ein Ranger in den berühmten Feuchtgebieten der Camargue herumführte. Wir standen am Ufer und blickten auf Hunderte rosafarbener Flamingos. Ich konnte es mir nicht verkneifen, spaßeshalber zu fragen: „Wie schmecken die?“ Der Ranger antwortete ernst: „Wir dürfen sie nicht jagen.“ Um dann zu ergänzen: „Aber das Fleisch ist sehr zart und schmeckt ein wenig wie Krabbe.“ Er verschwieg, welcher Wein gut dazu passen würde, aber ich vermute, es wäre einer aus der Region.
Ich habe festgestellt, dass man in jedem europäischen Land über seine engsten Nachbarn herzieht. Franzosen sagen den französisch sprechenden Belgiern dasselbe nach wie die Niederländer den niederländisch sprechenden Belgiern – nämlich dass sie nicht die hellsten Kerzen auf der Torte seien.
Ich als Holländer wiederum kann nicht alle Klischees über uns entkräften – zum Beispiel unsere Überpünktlichkeit. Ab dem Tag, an dem uns unsere Mütter das erste Mal im Kindergarten abgeben, bestimmen Uhren und Zeitpläne unser Leben. Der bloße Gedanke, ich könne zu einer Verabredung zu spät kommen, bereitet mir körperliches Unbehagen.
Dem musste ich mich vor einigen Jahren stellen, als ich bei einer internationalen Nachrichtenagentur arbeitete. Bei meinem ersten Besuch im Firmensitz in Rom lud man mich zum wöchentlichen Treffen der Führungskräfte ein. Angesetzt war es für elf Uhr, und als ich fünf Minuten vor elf zum Konferenzraum kam, fand ich dort niemanden vor – bis auf die Sekretärin des Direktors.
Sie fragte mich lächelnd: „Was machen Sie denn hier?“„Findet denn jetzt nicht das Meeting statt?“, erwiderte ich. Die Sekretärin lachte. „Offiziell ja“, sagte sie. „Aber Giovanni ist beim Zahnarzt, und sonst ist noch niemand da, also geht es frühestens um 13 Uhr los. Warum gehen Sie nicht einen Espresso trinken? Die anderen werden sicherlich bald dazustoßen.“
Noch ein Spleen der Niederländer:
Wir sind stolz darauf, „direkt“ zu sein, anders als unsere Nachbarn, die mehr Wert auf Diplomatie legen. Aber „direkt“ wird häufig mit „unhöflich“ gleichgesetzt. Nehmen wir nur unseren Ministerpräsidenten Mark Rutte. Es gilt allgemein als nicht angebracht, seinem Gastgeber bei einem offiziellen Staatsbesuch zu widersprechen. Aber Rutte hat sich einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert, als er bei einem Besuch im Weißen Haus Behauptungen des damaligen US-Präsidenten Donald Trump widersprach. So geschehen 2018, als die Handelsbeziehungen zwischen den USA und der EU angespannt waren. Bei der Pressekonferenz erklärte Trump, dass es auch „positiv“ sein könne, wenn der Handelsdisput ungelöst bliebe. Rutte unterbrach ihn: „Nein.“ Trump redete einfach weiter, woraufhin Rutte wieder unterbrach: „Das ist nicht positiv. Wir müssen eine Lösung finden.“
Einige bewunderten Rutte dafür, dass er sich mit Trump angelegt hatte, andere fanden, er sei zu weit gegangen. Ich muss gestehen, dass auch ich schon zu weit gegangen bin. Etwa bei einem Abendessen in Rom, bei dem eine große Gruppe Kollegen und Kolleginnen anwesend war. Das war vor drei Jahrzehnten, kurz vor Gründung der Europäischen Union. 22 Nationalitäten waren am Tisch vertreten.
Im Verlauf des Abends zogen wir uns gegenseitig auf. Als ich dran kam, begann ich, einen Witz zu erzählen, aber mittendrin wurde mir klar, dass meine deutsche Kollegin ihn nicht zum Lachen finden würde. Ich machte dennoch weiter. Den Witz möchte ich hier nicht wiederholen, aber es ging um die Niederlage in Stalingrad ...
Alle lachten, und meine deutsche Kollegin versuchte, sich ein Lächeln abzuringen. Ich wollte mich bei ihr entschuldigen, aber bevor ich die Gelegenheit dazu bekam, stand ein Journalist aus Indien auf. Immer noch lachend, rief er einem anderen asiatischen Kollegen zu: „Diese Europäer! Kannst du dir vorstellen, dass aus denen jemals eine richtige Union wird?“
Nun schlug die Stunde meiner deutschen Kollegin. Schlagfertig erwiderte sie: „Natürlich werden wir eine Union werden. Wir müssen nur vorher die Niederländer rauswerfen!“ Geschlagen senkte ich den Kopf, während sie den Applaus der Runde genoss. Wir wurden Freunde fürs Leben.
Die meisten Menschen, die ich im Laufe der Jahre in Europa kennenlernen durfte, waren freundlich, herzlich, offen und großzügig – und trotz aller Witze, die sie übereinander machen, kommen sie gut miteinander aus. Ich liebe sie alle, von Norwegen bis Griechenland. Nein, das stimmt so nicht ganz. Ein Menschenschlag liegt mir, egal, wo auf der Welt ich ihn antreffe, nicht so sehr am Herzen – Souvenirverkäufer. Sie scheinen stets ein- und dasselbe Gespräch mit mir zu führen:
„Wo bist du her?“
„Holland.“
„Ah, Holland. Kijken, kijken, niet kopen“ (etwa: Schauen, schauen, nichts kaufen). Wollen sie damit andeuten, dass Niederländer nicht nur Pünktlichkeitsfanatiker und unhöflich sind, sondern auch geizig? Souvenirverkäufer machen Erfahrungen mit Menschen aus aller Welt – insofern muss ich zähneknirschend einräumen, dass dieses Klischee der Wahrheit entsprechen könnte.
Nicht umsonst witzeln die Belgier: Wie lautet das niederländische Rezept für Pfannkuchen? Erstens: Leihe dir zwei Eier.