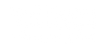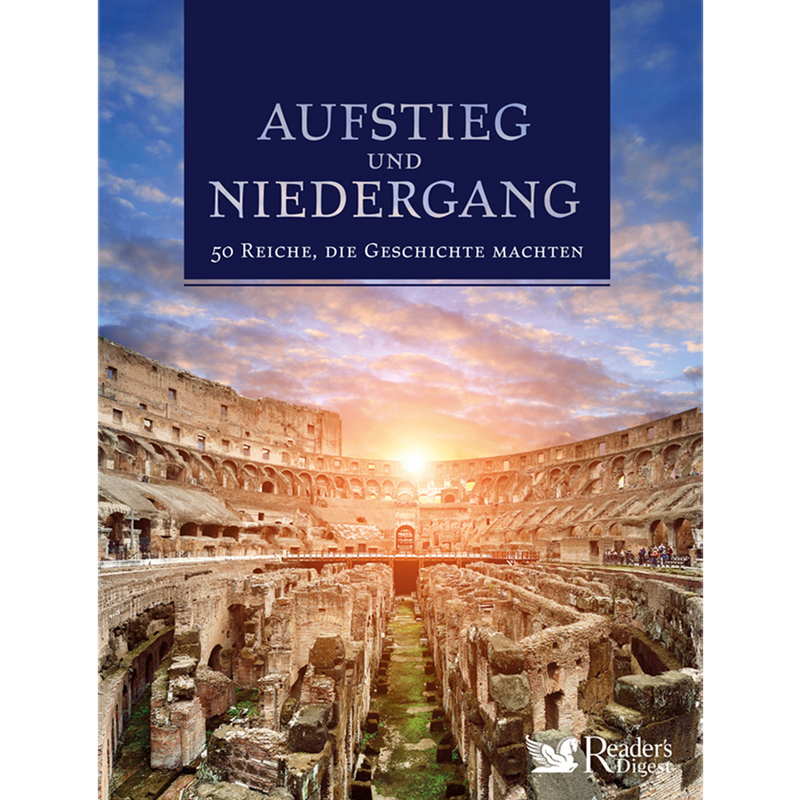Ich habe überlebt!
Drei Menschen berichten, wie sie dem Tod entronnen sind.

©
Ich habe das Ahr-Hochwasser überlebt (Christian Fleischmann, 33)
Es war 1.20 Uhr am 15. Juli 2021. Ich war gerade ein wenig beschwipst ins Bett gegangen, nachdem ich in meiner Souterrainwohnung im Haus meiner Schwester mit Freunden meinen 31. Geburtstag gefeiert hatte. Wir wohnen südlich von Bonn in Sinzig, die Stadt liegt etwa 500 Meter vom Ufer der Ahr entfernt. In dieser Woche schüttete es wie aus Eimern. Für einige Bezirke in der Nähe gab es Hochwasserwarnungen und Evakuierungsanordnungen, aber nicht für unsere Gegend. Ich hatte vorsichtshalber Sandsäcke vor die Gartentür gestellt sowie Elektrogeräte und Kleidung auf Tische und Couch verteilt, für den Fall, dass doch Wasser eindringen würde. Als meine Freunde gingen, lachten sie mich deswegen aus, aber ich dachte: „Warum ein Risiko eingehen?“ Kaum war ich eingeschlafen, weckte mich das Geräusch von rauschendem Wasser, so als läge ich neben einem Wasserfall und nicht in meinem Schlafzimmer. Ich schwang meine Beine aus dem Bett und spürte zu meinem Entsetzen, dass ich bis zu den Knien in kaltem Wasser stand, das schnell höher stieg. „Das muss ein Rohrbruch im Badezimmer sein“, dachte ich. Zitternd griff ich im Dunkeln nach meinem Handy und schaltete die Taschenlampe ein. Als ich in den Flur trat, sah ich, dass es kein Rohrbruch war. Das Wasser schoss wie ein Geysir durch die Gartentür, es musste die Sandsäcke beiseite gedrückt haben. Im Wohnzimmer schwammen Stühle, Bücherregale und Teile meines Schlagzeugs umher. Ich spürte Panik in mir aufsteigen. Die sonst so ruhige, träge Ahr war gewaltig über die Ufer getreten. Ich musste raus – schnell! Die Wirkung des Alkohols war wie weggeblasen. Angst ernüchtert. Ich hörte, wie die Gartentür dem Druck nachgab und das Holz krachend zersplitterte – ein Geräusch, das ich noch nie gehört hatte.
Inzwischen reichte mir das Wasser bis zur Hüfte. Barfuß watete ich zu meinem einzigen Ausweg: der Tür, die nach oben ins Haus führte. Um mich herum zerbrachen die Lampen, Kühlschrank und Schränke barsten auseinander. Endlich hatte ich die Tür erreicht und versuchte sie zu öffnen, doch der Druck des Wassers war zu stark. Jedes Mal, wenn ich sie ein Stück weit geöffnet hatte, schlug sie wieder zu. Ich sah mich nach etwas um, womit ich die Tür verkeilen konnte. In der Ecke standen ein Besen, ein Kleiderständer und ein schweres Schwert, das ich auf einem Mittelaltermarkt erstanden hatte. Ich schnappte mir alle drei, riss die Tür mit aller Kraft wieder auf, warf Besen und Kleiderständer in den Spalt und verkeilte sie mit dem Schwert – die so gewonnenen 30 Zentimeter reichten, um mich hindurchzuzwängen. Im Dunkeln rannte ich hoch in den zweiten Stock und klopfte wie wild an die Tür meiner Schwester, bis mir einfiel, dass sie in dieser Nacht gar nicht zu Hause war. Dann lief ich hinunter ins Erdgeschoss und nach draußen. Durchnässt und keuchend starrte ich auf eine Wasserlandschaft, in der Trümmer, Äste und Bäume schwammen. Der Fluss hatte unser Viertel überschwemmt. Als ich wieder klar denken konnte, wurde mir bewusst, dass ich ertrunken wäre, wenn ich nur ein paar Minuten später aufgewacht wäre. Man hat uns versichert, dass so etwas nur alle 100 Jahre passiert. Ich hoffe es. Mehr als 180 Menschen starben bei dem Hochwasser, in der Region wurden ganze Ortsteile weggespült.
Zurzeit wohne ich bei meinen Eltern im Stadtzentrum. Ich studiere Psychologie und bringe Kindern in Schulen Kampfsport bei. Meine Schwester war nicht gegen Hochwasser versichert, weil das Haus nicht in einem Risikogebiet lag. Also renovieren wir es auf eigene Kosten. Wenn wir das geschafft haben, werde ich in meiner alten Wohnung eine Kampfsportschule einrichten. Aber wohnen will ich da nie wieder, weil ich ständig denken würde: Was ist, wenn es wieder passiert? Die Erinnerungen sind zu traumatisch. Viele der Häuser um uns herum wurden zerstört, darunter auch ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. Es war so furchtbar. Nicht alle konnten entkommen. Letztendlich glaube ich, dass mich diese Erfahrung dankbar gemacht hat und mich darin bestärkt hat, jeden Augenblick auszukosten. An jenem Tag wäre ich beinahe ertrunken. Aber statt darüber nachzudenken, was hätte passieren können, halte ich mich lieber an das, was meine Mutter sagt: „Christian, denk nicht daran, was du alles verloren hast, sondern daran, dass du überlebt hast.“
Ich habe einen Fallschirmunfall überlebt (Jordan Hatmaker, 36)
Der 14. November 2021 war ein perfekter Tag zum Fallschirmspringen: sonnig und wenig Wind. Mit 14 Sprüngen war ich eine Anfängerin im Solosprung, es reichte noch nicht für eine Sprunglizenz. Ich hatte zwar jedes Mal Angst, bin aber auch ein risikofreudiger Mensch. Genau das lockte mich am Fallschirmspringen, Extreme waren schon immer mein Ding. Von meinem Wohnort bis zum Hangar bei Suffolk im US-Bundesstaat Virginia fuhr man rund 40 Minuten. Zusammen mit etwa 15 anderen Fallschirmspringern stieg ich gegen 13.30 Uhr zum ersten Sprung mit dem Flugzeug auf, es war herrlich. Mit meinem Trainer ging ich das Sicherheitsverfahren durch – ein Ritual, das vor jedem Sprung abläuft, egal, wie viel Erfahrung der Springer hat. Dazu gehört auch, von der Flugzeugtür aus in die Richtung zu zeigen, in welcher man gut 4000 Meter weiter unten landen soll. Das ist wichtig, um den Sprung richtig zu lenken.
Dann sprangen wir ab, ich zuerst, dann mein Trainer. Mit etwa 200 km/h ging es im Freifall pro Sekunde rund 60 Meter nach unten. Es war berauschend und beängstigend zugleich. Die Welt entfaltete sich in Sekundenschnelle vor meinen Augen, auch wenn es mir viel länger vorkam. In etwa 1200 Metern Höhe löste ich den Hilfsschirm aus – den kleinen Fallschirm, der den Hauptfallschirm aus dem Rucksack herauszieht. Nachdem sich der Hauptschirm geöffnet hatte, schwebte ich sanft nach unten und kam dem Boden immer näher. Etwa eine Minute lang konnte ich die Ruhe genießen. Ich fühlte mich unbesiegbar. Kurze Zeit später stiegen wir für einen zweiten Sprung auf. Die Stimmung im Flugzeug war locker, wir scherzten und lachten viel. Mein Trainer und ich gingen die gleiche Sicherheitsroutine durch, dann sprangen wir. Nach etwa 30 Sekunden bewegten wir uns voneinander weg, denn man braucht viel freien Raum, um den Fallschirm sicher zu öffnen. Der Blick auf den Höhenmesser zeigte mir, dass ich tiefer war als gedacht. Ich wusste vom ersten Sprung, wann ich den Hilfsschirm ziehen musste. Doch der Boden raste so schnell auf mich zu, dass ich diesmal nicht auf die richtige Position achtete. Als ich den Hilfsschirm auslöste, wickelte er sich um mein rechtes Bein, statt sich zu entfalten. Der Schirm zog mein Bein hoch wie bei einer Ballerina, während der Hauptschirm in der Tasche blieb. „Mach ihn einfach los“, sagte ich mir. Etwa sieben Sekunden verschwendete ich bei dem erfolglosen Versuch, mich zu befreien. Stattdessen hätte ich sofort den Reserveschirm öffnen sollen. Während ich auf den Boden zustürzte, bereitete ich mich auf den Aufprall vor. Ich rechnete nicht mit dem Schlimmsten – ich war schon immer eine Optimistin. Dann öffnete sich plötzlich der Reservefallschirm. Ich bekam ihn halbwegs in den Griff und steuerte auf eine Wiese zu.
Meine Erleichterung dauerte nur wenige Sekunden. Denn jetzt öffnete sich der Hauptfallschirm! Die beiden Fallschirme zogen in entgegengesetzte Richtungen, was meinen Fall beschleunigte. Der Aufprall war schrecklich, es fühlte sich an, als stünde ich in Flammen. Ich wollte aufstehen, denn das soll man tun, um zu zeigen, dass alles okay ist. Aber es ging nicht. Unterhalb meiner Taille konnte ich nichts bewegen. Ich lag da, mit ausgestreckten Armen, das Gesicht im Gras und schrie: „Hilfe, helft mir!“ Zwischen den Hilferufen betete ich laut: „Bitte, Gott, lass mich nicht gelähmt sein.“ Etwa fünf Minuten lag ich im Gras, bevor die Leute vom Fallschirmspringerklub bei mir waren. Sie umringten mich und wollten mir helfen, aber sie konnten nichts tun. Es war zu riskant, mich zu bewegen, es blieb ihnen nichts anderes übrig, als auf die Rettungssanitäter warten. Aber das verstand ich in diesem Moment nicht, und sie mussten sich anhören, wie ich fluchte und sie anschrie, mir zu helfen, als der Schock nachließ und der Schmerz richtig einsetzte. Eine halbe Stunde später trafen die ersten Sanitäter mit dem Krankenwagen ein. Sie versuchten, mich für den Transport auf ein Wirbelsäulenbrett zu legen, aber es tat so weh, dass ich schrie. Dann hörte ich den Hubschrauber.
Die Crewmitglieder des Rettungshubschraubers flogen mich in ein Traumazentrum, wo meine schweren Verletzungen behandelt wurden: ein zertrümmerter Knöchel, ein gebrochenes Schienbein und eine Wirbelsäulenverletzung, durch die Rückenmarksflüssigkeit austrat. Im Februar 2022, drei Monate nach dem Unfall, konnte ich zum ersten Mal wieder gehen, und ein paar Monate später schaffte ich sogar den Aufstieg zum Mount-Everest-Basislager. Übrigens werde ich auch wieder Fallschirm springen. Aber das habe ich meinen Eltern noch nicht gesagt.
Ich habe einen Schneesturm überlebt (Shannon St. Onge, 38)
Der Schneesturm war für den Abend des 31. Januar 2022 angekündigt. An diesem Montag arbeitete ich von zu Hause aus, musste aber am Nachmittag noch ins Büro an der First Nations University in Regina in der kanadischen Provinz Saskatchewan, um einen Scheck für ein Stipendium zu unterschreiben. Als Leiterin der Finanzabteilung wollte ich ihn dem Studenten so schnell wie möglich zukommen lassen, Schneesturm hin oder her. Die Fahrt zur Uni dauert etwa eine halbe Stunde. Der Highway führt schnurgerade Richtung Osten über eine große flache Ebene. Als ich im Büro war, kam ein Kollege, um den Scheck gegenzuzeichnen, dann machte er sich auf den Heimweg. Beim Zusammenpacken sah ich, dass er die Tasche mit seinem Laptop in meinem Büro vergessen hatte. Ich rief ihn an. „Mist“, sagte er, „ich bin schon zu Hause.“ „Ich bringe ihn dir schnell vorbei“, schlug ich ihm vor. Es war 16.30 Uhr. Der Schneefall sollte erst später einsetzen, aber vorsichtshalber fuhr ich über die Landstraßen und mied den Highway, der schnell zu einer Rutschbahn werden konnte. Unterwegs tankte ich noch und kaufte zwei Pizzas, die ich meinen beiden zehn und 15 Jahre alten Kindern versprochen hatte. In rund 15 Minuten war ich bei meinem Kollegen, gab ihm den Laptop und fuhr sofort weiter.
Dann begann es zu schneien – und zwar heftig. Innerhalb von Minuten steckte ich in einem sogenannten Whiteout, einem meteorologischen Phänomen, bei dem die Sicht drastisch reduziert ist. Der Sturm entwickelte sich zu einem „Snownado“ – einem Schneetornado. Es war entsetzlich! Schon bald ging der Asphalt in Schotter über, sodass ich langsamer fahren musste. Ich öffnete das Fenster, um mich am Straßenrand zu orientieren. Doch ich hatte keine Ahnung, wo ich war oder auch nur auf welcher Seite der Straße ich mich befand. Irgendwann hielt ich an, weil ich Angst hatte, auf einem Feld, im Graben oder sonst wo zu landen. Ich ließ den Motor laufen, um warm zu bleiben, und wählte den Notruf. Die Mitarbeiter der Leitstelle eröffneten mir, dass ich das Unwetter während der Nacht durchstehen müsse, Hilfe käme frühestens am nächsten Morgen. Die Sekunden nach dem Anruf waren die schlimmsten meines Lebens. Mitten in einem Whiteout bei heftigem Wind und -10 Grad zu Fuß loszuziehen – ohne zu wissen, wo ich mich befand – war keine Option. Aber ich hatte Angst, dass andere Autofahrer mich nicht sehen und in mein Auto krachen könnten. Oder dass der Auspuff mit Schnee verstopft und ich an einer Kohlenmonoxidvergiftung sterben würde. Oder dass der Sturm länger dauern könnte als angekündigt und man mich zu spät finden würde. „Tief durchatmen“, sagte ich mir. „Panik hilft nicht weiter.“ Es war das erste Mal, dass meine Kinder eine Nacht allein zu Hause sein würden. Ich rief sie an und erklärte ihnen, was passiert war. Ich zwang mich, ruhig zu klingen und sagte ihnen nicht, dass ich Angst hatte. Dass ich, die Problemlöserin, nicht wusste, was ich jetzt tun sollte.
Es war jetzt etwa 18 Uhr und dunkel. Wie sah mein schwarzes Auto wohl nachts bei einem Whiteout aus? Wie ein Schatten? Oder schlimmer noch, war es unsichtbar? Plötzlich fuhr ein Lastwagen vorbei und verfehlte mich nur knapp. Zuerst war ich erschrocken, doch dann dachte ich: Das ist meine Rettung! Ich folgte langsam dem Lkw, verzweifelt, ohne zu wissen, wohin es ging. Als er plötzlich abbog, wusste ich nicht, was ich tun sollte. „Ich fahre zum Strand“, rief mir der Fahrer durch sein offenes Fenster zu, wobei seine Worte fast vom Wind übertönt wurden. Ich wusste, dass der Strand nicht in Richtung meines Hauses lag. Doch ich hatte keine Ahnung, wo ich war. Also hielt ich an und schrieb meinem Kollegen, dem ich kurz zuvor den Laptop gebracht hatte, eine Textnachricht. Scherzhaft ergänzte ich, dass meine gute Tat in einer Katastrophe enden würde. Aber er hatte eine Idee: „Starte Google Maps auf deinem Smartphone und schick mir deine Standortdaten.“ Wir stellten fest, dass ich mich auf der Bouvier Lane befand, einer Straße zwischen zwei Farmen. Es war jetzt 18.30 Uhr. Diese Information postete ich in meiner Facebook-Gruppe und fragte, ob jemand in meiner Nähe Leute kannte, die mir zu Hilfe kommen könnten. Aber selbst wenn jemand wusste, wo ich war, würde er sich durch den wirbelnden Schnee und den kreischenden Wind zu mir durchkämpfen können?
Mir blieb nichts anderes übrig, als im Auto sitzen zu bleiben und mich warm zu halten. Ich war so froh, dass der Benzintank voll war. Ich hatte alles getan, was in meiner Macht stand, und egal, was passierte, ich musste mich damit abfinden. Doch schon bald kamen Antworten auf meine Nachricht. Einer meiner Facebook-Freunde kannte sogar die Familie, die dort wohnt. Um 20 Uhr klingelte mein Handy. Es war der Sohn des Farmers, dem das Land an der Straße gehörte, an der ich stand. Er sagte, sein Vater käme mich holen! Rund 45 Minuten später sah ich eine große Gestalt in einem gelben Regenmantel auf mich zukommen. Meine Güte, war ich erleichtert, ihn zu sehen! Auf der Suche nach mir war André Bouvier einen halben Kilometer durch den Schneesturm gelaufen. Bei jedem Schritt kämpfte er gegen Wind und Schnee an, mit einer behandschuhten Hand schützte er die Augen vor den stechenden Schneekristallen.
„Können Sie fahren?“, fragte ich ihn mit zitternder Stimme. „Meine Nerven sind am Ende.“ Trotz seines kraftvollen Ganges erkannte ich aus der Nähe, dass er schon älter war. „Nein“, antwortete er ruhig. „Folgen Sie mir mit dem Auto. Sie schaffen das.“ Er drehte sich um und stapfte zurück durch den Schnee. Langsam fuhr ich hinterher, hielt das Lenkrad fest umklammert und spürte, wie sich mein Herzschlag allmählich beruhigte. Als wir sein Haus einige Minuten später erreichten und ich aus dem Wagen stieg, brach ich in Tränen aus. Während seine Frau mich mit heißen Getränken und Apfelmus verwöhnte, kehrte André – der, wie ich erfuhr, 80 Jahre alt war – zurück in den Sturm, um weiteren Menschen zu helfen. Er hatte noch zwei weitere liegen gebliebene Autos bemerkt: einen Vater mit seinen beiden Kindern und ein Ehepaar mit Tochter.
Die Nacht verbrachten wir damit, Geschichten zu erzählen, die Kinder aßen die Pizzas, die ich gekauft hatte, und wir schliefen verstreut im Haus auf Sofas und in Sesseln. Am nächsten Morgen hatte André um 5.30 Uhr seine Einfahrt soweit vom Schnee befreit, dass wir alle nach Hause fahren konnten – was in meinem Fall nur fünf Minuten dauerte. Der Sturm hatte mich so durcheinandergebracht, dass ich nicht gemerkt hatte, so nahe zu sein. Trotzdem hätte ich nicht weiterfahren können, ohne mein Leben zu riskieren. Nach dieser Erfahrung sehe ich die Dinge anders, Herausforderungen und Überraschungen begegne ich jetzt viel gelassener. Mir ist klar geworden, wie wichtig es ist, immer für andere da zu sein und ihnen zu helfen – Freunden wie Fremden. Aber das Beste ist, dass ich André kennengelernt habe. Wir haben den Kontakt gehalten, und ich weiß, wir bleiben Freunde fürs Leben.