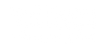Tückische Wüste
Ein kleiner Irrtum, ein falsches Abbiegen, ein paar lumpige Kilometer – der Unterschied zwischen Leben und Tod. Zwei Schreckenstage in mörderischer Sonnenglut.

©
Diesen Artikel gibt es auch als Audio-Datei
Es begann ganz harmlos in einer heißen Juninacht 1959, als ich mit meiner alten Limousine mitten in der Mojavewüste in Kalifornien von der Bundesstraße 91 auf einen Schotterweg abbog. Ich war erst 18 und wusste noch nicht, dass einen in der sommerlichen Wüste ein Augenblick der Gedankenlosigkeit Schritt für Schritt unweigerlich in die Katastrophe führen kann.
Ein grauhaariger Goldschürfer hatte meinem 16-jährigen Schulfreund Jim Twomey und mir gesagt, die Straße führe zu der aufgegebenen Rasor Ranch am Rande des sogenannten Teufelsspielplatzes. Solche verlassenen Orte in der Wüste reizten mich – und auch das, was der Prospektor über die Klapperschlangen dort erzählt hatte. Als angehender Zoologiestudent sammelte ich allerlei Tiere, um mir etwas hinzuzuverdienen.
Wir hatten für ein paar Tage Proviant im Wagen, und die Ranch sollte eine gute Quelle haben. Doch ich wäre nie mit nur zwei Halbliterflaschen Trinkwasser von der Hauptstraße abgebogen, wenn ich nicht so hundemüde gewesen wäre. Es ging schon auf Mitternacht zu. Wir waren mehr als 650 Kilometer von San Francisco gefahren, dann hatten wir am Nachmittag in der sengenden Sonne Vögel beobachtet.
Bei dem halb im Sand begrabenen Autoreifen, den der Prospektor erwähnt hatte, bog ich ab und fuhr die im Mondschein liegende Schotterstraße entlang. Nach einer Weile kamen wir an eine kleine Sandzunge, die sich quer über die Straße schob. Ich gab Gas, wir pflügten hindurch und dann noch durch drei weitere Verwehungen. Nach der vierten sahen wir im Licht unserer Scheinwerfer keine Schotterstraße mehr, sondern bloß fahlen, welligen Sand. Ein paar Meter noch behielt der Wagen seinen Schwung. Dann wühlten sich die Räder immer tiefer ein. Mit einem Ruck blieb das Auto stehen.
Ganz klar – ich war falsch abgebogen. Wir stiegen aus und schritten die Strecke bis zur Schotterstraße ab. Es waren 60 Meter. Jim wollte schlafen und erst am anderen Morgen mit dem Ausbuddeln anfangen. „Nein“, entschied ich. „Das machen wir lieber gleich. Dauert doch bloß ein paar Minuten.“ Nach einer Stunde hatten wir nicht einen Zentimeter geschafft. Die Hinterräder hatten sich nur noch tiefer in den Sand gewühlt.
Als wir dann im Mondlicht nach Steinen zum Unterlegen suchten, stießen wir auf die Reste eines alten Feldbahngleises. Die Schienen waren zwar abmontiert, doch ein paar Holzschwellen lagen noch da. Neun Stück fanden wir, mehr oder weniger morsch. Eine nahmen wir als feste Unterlage, wuchteten mit dem Wagenheber das Auto hoch und legten die Schwellen in Doppelreihe aus. Vorsichtig bugsierte ich dann den Wagen zurück. Er rollte langsam, aber stetig zwei, drei Meter. Dann rutschte ein Rad von einer Schwelle und das Auto blieb stehen.
Die ganze Nacht hindurch wuchteten wir den Wagen immer wieder hinauf, legten die Schwellen gerade, stießen ein, zwei Meter zurück bis zum unvermeidlichen Abrutschen. Meiner Schätzung nach waren wir mindestens 20 Kilometer von der Bundesstraße weg, vielleicht 30. Aber die Hauptcrux bildeten die 60 Meter Sand zwischen dem Wagen und der Schotterstraße. Gegen fünf Uhr morgens hatten wir etwa 15 Meter geschafft – 45 blieben uns noch. Völlig abgekämpft tranken wir bis auf zwei Becher unser Wasser aus und legten uns dann zum Schlafen auf den Sandboden.
Zu heiß zum Anfassen
Fast mit einem Schlag, so schien es, brannte die Morgensonne gnadenlos vom Himmel herab. Jetzt, im grellen Tageslicht, sah die ganze Sache doch ernster aus. Uns wurde rasch klar, warum dieser Sandkessel Teufelsspielplatz hieß. Nur halb verdorrtes Buschwerk sprenkelte die kahlen Hänge. Und in einiger Entfernung glitzerte blendend weiß ein ausgetrockneter Salzsee.
Mit nacktem Oberkörper gingen wir wieder an die Arbeit. Schon nach einer halben Stunde hatten wir einen Sonnenbrand. Bald wurde der Sand zu heiß zum Anfassen. „Lass uns lieber bis zum Abend warten“, sagte ich. „Wenn’s kühler wird, haben wir den Schlitten im Nu raus.“ Wir beschlossen, uns in der Flanke einer Anhöhe in etwa 400 Meter Entfernung einen Unterschlupf zu suchen. Ich war immer noch nicht ernsthaft beunruhigt und drehte sogar ein paar Meter Film.
Wir fanden zwei schattige Plätzchen, knapp zehn Meter voneinander entfernt. Unter einem niedrigen Überhang döste ich vor mich hin. Langsam rückte das Sonnenlicht näher, vom fahlen Sand grausam zurückgestrahlt. Bald blieb mir nur noch ein 30 Zentimeter breiter Schattenstreifen. Die ausgedorrten Lippen sprangen mir auf.
Gegen Mittag teilten wir uns die letzten zwei Becher Wasser. Hinterher lag ich da und beobachtete die wandernde Grenzlinie des Sonnenlichts. Ich fragte mich öfter, wie heiß es eigentlich war (nach amtlichen Berichten steigen die Junitemperaturen am Teufelsspielplatz bis auf 49 Grad im Schatten).
Nachtschicht
Endlich schob sich ein langsam größer werdender Schattenkeil von der einen Seite heran. Die Sonne ging unter; eine wunderbare Kühle breitete sich aus. Jim und ich stapften zum Wagen und aßen unsere erste richtige Mahlzeit seit 24 Stunden. Wir löffelten jeder eine Dose Hühnersuppe mit Nudeln aus, die in der Backofenhitze des Wagens tüchtig vorgewärmt waren, und teilten uns dann eine kleine Büchse Ananassaft.
Das Essen tat uns gut, und wir beratschlagten, ob wir nicht bis zur Straße gehen sollten. Doch wir fühlten uns zu matt für einen so langen Marsch, wir wollten uns lieber weiter mit dem Wagen abschuften. Auch da kapierte ich immer noch nicht ganz, wie groß die Gefahr war, in der wir schwebten. Zwar wusste ich, dass leichtsinnige Autofahrer in der Wüste schon verdurstet waren; erst vor Kurzem hatte man im Death Valley, nur 50 Kilometer weiter nördlich, die Leichen von zwei jungen Männern neben ihrem Wagen gefunden. Doch irgendwie hatte ich das Gefühl, uns könne das nicht passieren.
An diese zweite Nacht erinnere ich mich nur noch undeutlich. Wir konnten nichts weiter tun, als den Wagen hochzustemmen und ihn ein Stückchen zurückrollen zu lassen, bis er von den morschen Schwellen herunterrutschte. lmmer wieder ruhten wir uns aus und dösten vor uns hin. Gegen vier Uhr früh schliefen wir ein. Als ich aufwachte, brannte mir die Sonne schon auf der Haut. Da begriff ich zum ersten Mal, in welcher Gefahr wir waren: Ganze viereinhalb Meter hatten wir in der Nacht den Wagen zurückbugsiert! Jim, erschöpft und teilnahmslos, schien die Hoffnung schon aufgegeben zu haben. Aus Steinen und Zweigen legte ich die Buchstaben SOS auf den Boden.
Dieser zweite Tag war furchtbar. Selbst im Schatten spürte ich, wie die Hitze mir die Feuchtigkeit aus dem Körper sog. Jim begann zu fantasieren. „Was ist mit meinem Grapefruitsaft?“, murmelte er immer wieder. „Ich hab bezahlt dafür, ich will meinen Grapefruitsaft haben.“ Schließlich wurde er still. Einmal hörte ich leise rieselnden Sand: Einen Meter von mir glitt eine Klapperschlange vorbei. Ich lag jetzt in einem Dämmerzustand da. Dieser Tag schien nie zu Ende zu gehen.
Als ich zu unserem Wagen hinblinzelte, hatte ein Cabriolet neben ihm geparkt. Und über die schwarze Asphaltstraße flitzten Autos. War ich vielleicht doch bis zur Straße marschiert? Ich drehte den Kopf weg, blinzelte dann wieder hinüber: Unsere alte Karre stand ganz allein da.
Kühler Sand
Am Nachmittag konnte ich die brütende Hitze nicht mehr aushalten. Ich rappelte mich mühsam hoch und trat hinaus in die Sonne. Als ich zum Wagen hinüberstarrte, bemerkte ich zum ersten Mal, dass der flache Sandboden daneben früher ein See gewesen sein musste. „Wenn ich da grabe“, dachte ich, „finde ich vielleicht Wasser.“ Ich stolperte den Hang hinab.
Auf einer niedrigen Düne wuchsen grüne Kreosotbüsche, und mir fiel ein, dass ich beim Graben nach Eidechsen an solchen Stellen feuchten Boden gefunden hatte. lch begann, an der Schattenseite der Düne ein Loch zu buddeln, tief hinab zwischen die Wurzeln der Büsche. Da war kein Wasser; doch plötzlich spürte ich meine Hände fast kühl werden. Vielleicht konnte ich mir eine Grube scharren und mich in diese herrliche Kühle legen!
Wie lange ich zum Ausschaufeln der Mulde gebraucht habe, weiß ich nicht. Aber endlich war sie groß genug. Ich zog meine verschwitzten Sachen aus und legte mich nackt in die Grube. Der kühle Sand erfrischte mich wie wohltuender Balsam. Ich schlief ein. Als ich aufwachte, sah ich gerade noch die Sonne hinter einer Hügelkette untergehen. Ich fühlte mich ausgeruht, und mir war angenehm kühl.
Jim taumelte herbei. Sein Kopf pendelte kraftlos hin und her, seine Arme baumelten schlaff herab. Plötzlich sackte er auf die Knie, stürzte dann vornüber und lag wie leblos da. Ich schüttelte ihn, er stöhnte leise. Erschrocken rannte ich zum Wagen und suchte fieberhaft drinnen herum. Unter dem Sitz fand ich ein Fläschchen Rasierwasser. Hastig schraubte ich die Kappe ab und setzte es an den Mund. Der brennend scharfe Alkohol brachte mich jäh wieder zu mir. Und zum zweiten Mal durchzuckte mich der grausige Gedanke, nicht mehr ganz richtig im Kopf zu sein.
Ich rieb mir mit dem Rasierwasser Gesicht und Nacken ein. Das tat gut. Dann ging ich zu Jim, rieb auch ihm das Gesicht ein und goss etwas Rasierwasser auf sein Netzhemd. Er war leichenblass und hatte rissige Lippen. „Wir müssen beide was trinken“, dachte ich immer wieder.
Verzweifelt suchten meine Augen den Wagen ab. Und plötzlich schoss mir ein Gedanke durch den Kopf: Der Kühler! Ich griff mir einen Kochtopf, kroch unter die vordere Stoßstange und schraubte den Ablassstutzen des Kühlers auf. Ein Strom rostbraunen Wassers floss über die ölverschmierte Spurstange und plätscherte in den Topf. Noch unter dem Wagen liegend nahm ich ein paar tüchtige Schlucke: Das Wasser war voller Öl und Rost. Doch fast augenblicklich fühlte ich mich besser. Nachdem ich den Kühler entleert und eine Feldflasche gefüllt hatte, rannte ich zu Jim zurück und goss ihm vorsichtig Wasser in den offenen Mund. Er bewegte sich etwas.
Dann ging ich wieder zum Wagen, holte eine Dose chinesischen Gemüseeintopf mit Huhn und aß die Hälfte davon. Bald hatte Jim sich aufgesetzt und löffelte seine Hälfte aus.
Die letzte Chance
Mein Kopf war nun klarer und ich begriff, wenn wir hier noch rauskommen wollten, dann musste ich etwas Neues versuchen. Nach einer Weile erkannte ich, was das Nächstliegende gewesen wäre, falls ich einigermaßen logisch gedacht hätte: Ich musste den Wagen mit Vollgas zurücksetzen und über die Schwellen hinausjagen – und hoffen, dass er in Schwung blieb.
Wir waren beide noch elend schlapp. Als Jim mit anfassen wollte, brach er über dem Wagenheber zusammen und lag den Rest dieser dritten Nacht apathisch da. Ich muss wohl an die sechs Stunden für eine Arbeit gebraucht haben, die normalerweise 20 Minuten gedauert hätte, nämlich den Wagen genau auf den Schwellen auszurichten – für den allerletzten Versuch. Wenn wir’s auf Anhieb nicht schafften, würde ich nicht mehr die Kraft haben, es noch einmal zu probieren. Schließlich schlief ich völlig erschöpft ein.
Ich erwachte in glühender Sonne. Hastig tranken wir unser letztes Wasser. Ich half Jim in den Wagen, ließ den Motor an und ein paar Sekunden lang laufen. Dann sah ich Jim an, der in seinem Sitz zusammengesunken war. „Jetzt passiert’s“, sagte ich. Er schien mich gar nicht zu hören.
Ich jagte den Motor hoch, riss den Schalthebel in den Rückwärtsgang und trat aufs Gaspedal. Der Wagen machte einen Satz zurück. Wurde schneller, rutschte von den Holzschwellen, rollte weiter. Aber wir verloren bald an Fahrt, die Hinterräder begannen sich einzuwühlen – ein grässliches, uns leider zu vertrautes Gefühl. Wir standen schon fast still, da spürte ich, wie die Reifen etwas Festes fassten und wir fuhren gleichmäßig rückwärts. Endlich waren wir aus dem Sand raus und auf der Schotterstraße. Ich brüllte wie ein Verrückter, Jim neben mir lächelte matt.
Vier Stunden später, nach vielen Pausen in sengender Hitze, damit der ohne Wasser laufende Motor abkühlen konnte, bogen wir in die Straße ein: Nur knapp zehn Kilometer von der Bundesstraße 91 hatten wir festgesessen. Und nach weiteren zwei Kilometern – keine zwölf von dem unheimlichen Sandkessel, wo wir um Haaresbreite einem schrecklichen Tod entronnen waren – erreichten wir eine hochmoderne Raststätte.
Wir parkten und gingen hinein. „Ganz schön warm heute, Jungs“, begrüßte uns der Mann hinter der Bar. Dann musterte er uns genauer und sah, dass wir dreckverkrustet, todmüde und am Verdursten waren. Er stellte zwei Gläser Wasser auf die Theke. „Bloß schlückchenweise trinken“, riet er, „bis ihr euch wieder dran gewöhnt habt." Wir saßen auf den piekfeinen Barhockern, schlürften vorsichtig das kühle Wasser, langsam und dankbar. Und jeder Schluck bestätigte uns, was wir schüchtern nun wieder zu glauben wagten: Wir durften uns weiter des Lebens freuen.
*Anmerkung der Redaktion: Die Kühlflüssigkeit moderner Pkw ist nicht zum Verzehr geeignet und kann zu schweren Vergiftungen führen!
Lesen Sie weiter in unserer Ausgabe November 2025