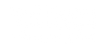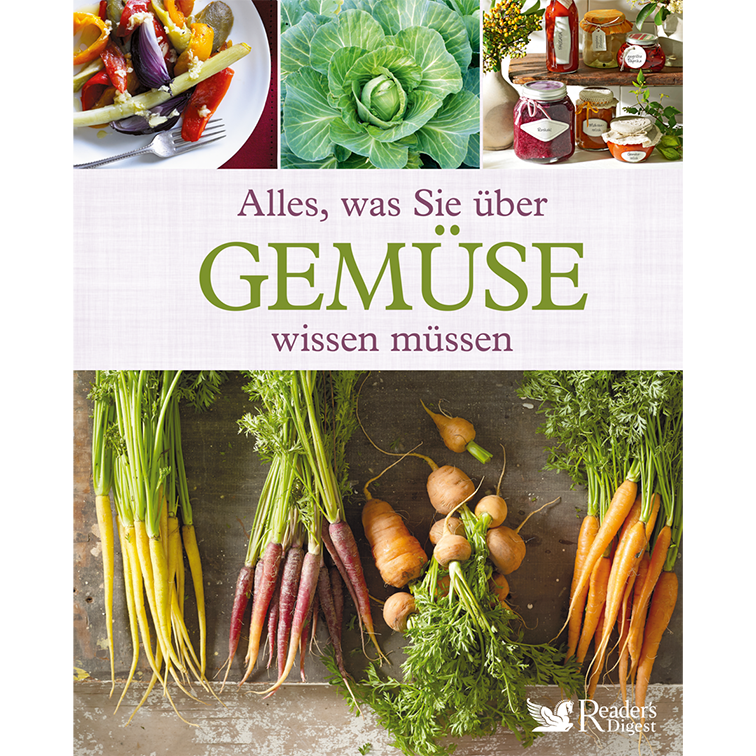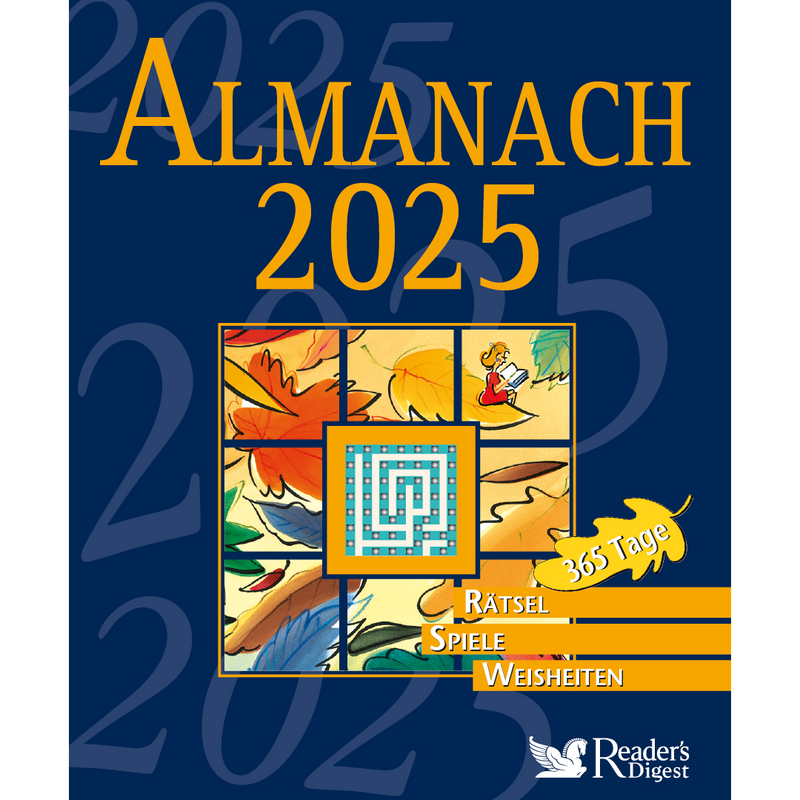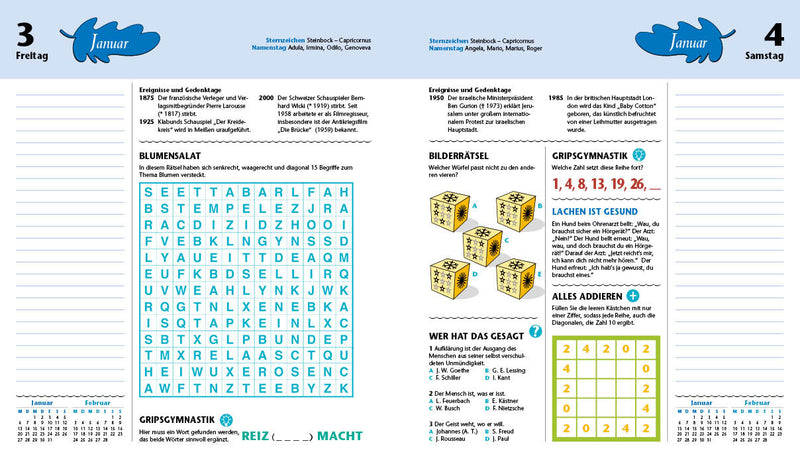Vier Tage in Angst
Tagelang liegt Michael schwer verletzt in seinem Auto, das in eine Schlucht gestürzt ist. Verzweifelt fragt er sich: „Wird mich jemand finden?“

©
Diesen Artikel gibt es auch als Audio-Datei
Im November 2023 setzte sich Michael Cabeldu am späten Abend spontan ins Auto und fuhr von Victoria, der Hauptstadt der kanadischen Provinz British Columbia, hinaus in die Wildnis. Das Radio lief, über ihm funkelten die Sterne. Er durchquerte die Kleinstadt Sooke und hielt sich auf dem Highway 14 weiter Richtung Westen. Nur wenige Menschen leben an dieser Straße, die sich an der Südküste von Vancouver Island viele Kilometer durch dichte Wälder schlängelt. Die Straßenverhältnisse waren ausgezeichnet. Doch das änderte sich schlagartig. Hinter einer Kurve hüllte dichter Nebel die Fahrbahn ein, die Straßenmarkierungen waren nicht mehr zu erkennen. Bevor Michael wusste, wie ihm geschah, kam er mit seinem alten Lieferwagen von der Straße ab und stürzte eine steile Böschung hinunter, krachte durch Gestrüpp und über liegende Baumstämme – geradewegs auf eine Klippe zu, die an der Juan-de-Fuca-Meerenge lag. Wenn er über die Klippe hinausschoss, würde seine Leiche vielleicht nie gefunden werden. Doch der Wagen prallte gegen einen großen Baumstumpf und kam abrupt zum Stehen.
Die Front des Lieferwagens wurde eingedrückt, das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Michael, der nicht angeschnallt war, knallte mit dem Kopf gegen das Lenkrad und landete auf der Beifahrerseite unter dem Armaturenbrett. Er stand unter Schock und hatte große Schmerzen.
Ich kenne Michael Cabeldu seit mehr als 50 Jahren. Wir lernten uns in der Highschool in Ontario, Kanada, kennen, wo ich immer noch lebe. Mit Anfang 20 zog er in den Westen und ließ sich auf Pender Island nieder. Er arbeitete als Bauunternehmer und Schreiner, und seit Kurzem betätigte er sich auch erfolgreich im Gemüseanbau. Mit 68 Jahren ist Michael seinen Hippie-Träumen treu geblieben. Er trägt immer noch lange Haare und einen Vollbart, inzwischen weiß. Im März 2023 entdeckten Ärzte einen Tumor an seiner Wirbelsäule. Nach einer achtmonatigen Chemotherapie wog Michael bei einer Körpergröße von 1,52 Metern nur noch 40 Kilogramm. Noch nie in seinem Leben war er so schwach gewesen.
Außerdem machten die Medikamente seine Knochen mürbe. Erst kürzlich hatte er sich einen Arm und ein Bein gebrochen, als er in seiner Einfahrt ausrutschte. „Ich kann einen Sturz nicht mehr abfedern wie früher“, sagte er mir. Und zu alledem brachte der Krebs seinen Natriumspiegel im Blut durcheinander, sodass er Mühe hatte, klar zu denken. Im Nachhinein hält er dies für eine mögliche Erklärung, warum er zu dieser verhängnisvollen Fahrt aufgebrochen war.
Michael hatte am Freitag, den 10. November, morgens einen Termin im Krankenhaus in Victoria. Also nahm er am Donnerstag die Fähre von Pender Island. Ursprünglich wollte er mit Freunden zu Abend zu essen und kaufte dafür ein. Doch dann war ihm das alles zu aufwendig – die Freunde wohnten drei Autostunden entfernt –, und er entschied sich dagegen. Stattdessen ging er in Victoria ins Kino. Und weil es ein schöner Abend war, beschloss er anschließend, noch ein wenig hinauszufahren. Und nun lag der Mann 44 Meter tief an einem Abhang im Fußraum auf der Beifahrerseite. Seine Nase war gebrochen und sein Gesicht blutverschmiert. Er hatte sich sein eines Bein erneut verletzt, dazu das andere und einige Rippen gebrochen. Die nächsten Stunden lag er wie betäubt da.
Als Michael im Morgengrauen wieder einigermaßen klar denken konnte, beschloss er, seine Position zu verändern. Er hatte genug Platz, weil er den Beifahrersitz ausgebaut hatte, um Arbeiten am Fahrzeug durchzuführen. Aber jeder Versuch, sich zu bewegen, war eine Qual. In den nächsten sechs Stunden machte Michael eine winzige Bewegung nach der anderen. Stück für Stück hievte er sich hoch, bis er auf der Mittelkonsole neben dem Fahrersitz saß. Draußen goss es in Strömen. Die Sonne ging bereits unter, als Michael es endlich schaffte, über den Schalthebel und die Handbremse hinweg auf den Fahrersitz zu klettern. Er klemmte sich ein Kissen unter die rechte Pobacke, um die Schräglage des Wagens auszugleichen, und aß ein paar Mini-Schokoriegel. Erschöpft schlief er ein.
Als der Samstagmorgen anbrach und der Regen nachließ, überlegte Michael, was er tun sollte. Mit dem Wagen zurück zur Straße fahren war ausgeschlossen. Er konnte auch nicht zum Highway hochsteigen. Der Wagen lag so schräg und seine Verletzungen schmerzten so sehr, dass allein das Öffnen der Fahrertür unmöglich war, ganz zu schweigen von den 44 Metern, die man durch unwegsames Terrain zurücklegen müsste. Er war also auf Hilfe anderer angewiesen. Aber das würde nicht einfach sein. Michael hörte die Autos auf der Straße über ihm vorbeirauschen. Doch selbst wenn Passanten zufällig sein Fahrzeug im schulterhohen Gebüsch sahen, konnten sie nicht hineinschauen und würden bestimmt davon ausgehen, dass es verlassen war.
Michael besaß kein Mobiltelefon – er hatte es nie für nötig gehalten, sich eines zuzulegen. Niemand wusste, dass er aus Victoria hinausgefahren war, also gab es auch keinen Grund, nach ihm zu suchen. Er konnte auch nicht hupen, um Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen. In den 19 Jahren, in denen er den Wagen schon besaß, hatte die Hupe noch nie funktioniert.
Das Gute war, dass der Verletzte im Trockenen saß. Im Wagen war es kalt, aber er hatte einen Pullover dabei – ironischerweise mit der Aufschrift „Erlebe das Abenteuer, lebe deinen Traum“. Zu essen hatte Michael das, was er für sein geplantes Treffen mit den Freunden eingekauft hatte: ein Fertiggericht mit Lamm und gebratenem Gemüse für drei Personen, sicher in Folie verpackt. Das Sushi lag auf dem Boden des Wagens verstreut und war mittlerweile ungenießbar, aber er besaß noch eine Tüte mit Mini-Schokoriegeln, die er im Kino gekauft hatte. Zu trinken hatte Michael eine Flasche Wasser, eine halb volle Flasche mit einem isotonischen Getränk und noch etwas kalten Kaffee in einer Thermoskanne. Er teilte seinen Vorrat an Schokoriegeln auf und schaltete seine Warnblinkanlage an – vielleicht würde ihn jemand vom Highway aus sehen. Doch die Lichter funktionierten nicht mehr.
Am Freitagmorgen hatte Michaels Lebensgefährtin Linda Dean auf Pender Island einen Anruf aus dem Krankenhaus erhalten und erfahren, dass Michael nicht zu seinem Termin erschienen war. Daraufhin hatte sie Freunde angerufen, doch die wussten auch nichts. Als er am Abend noch nicht aufgetaucht war, machte sie sich Sorgen und wandte sich an die Polizei. Die Nachricht von seinem Verschwinden machte schnell die Runde. Ein gemeinsamer Freund schickte mir eine Textnachricht. Eigentlich hatte ich Michael ein paar Tage später besuchen wollen. Stattdessen wartete ich jetzt unruhig auf die Nachricht, ob mein Freund wohlauf war.
Michael konzentrierte sich derweil aufs Überleben. Zur Ablenkung führte er Selbstgespräche. Er schlief immer nur kurz, und obwohl er durch die Chemo kaum Appetit hatte, wusste er, dass er essen musste. Die mundgerechten Schokoriegel waren die einfachste Lösung, und so aß Michael sie einen nach dem anderen auf. Am Samstagnachmittag war ihm klar, dass er sich überlegen musste, wie er die Vorbeifahrenden auf sich aufmerksam machen könnte. Er kam auf die Idee, ein Feuer anzuzünden. Den Rauch würden die Leute vielleicht entdecken und nachschauen.
Michael hatte ein wenig Holz im Wagen liegen. Samstag und Sonntag – beides nasse, trübe Tage – verbrachte er damit, alles an Holz und Papier zusammenzusuchen, das er finden konnte. Er kurbelte das Fenster herunter, stapelte das brennbare Material draußen zwischen den Ginstersträuchern und zündete ein Streichholz an. „Ich wollte den ganzen Hang in Brand stecken“, sagt Michael. Aber es begann heftig zu regnen, und die Flamme erlosch. Ein zweiter Versuch scheiterte ebenso kläglich.
Zu diesem Zeitpunkt – es war früher Sonntagabend – hatte er seinen Trinkvorrat aufgebraucht. Da erinnerte er sich an einen Tipp des britischen TV-Überlebenstrainers Bear Grylls, seinen eigenen Urin zu trinken. Er pinkelte in die leere Flasche und spülte mit der Flüssigkeit den Mund. „Es schmeckte so, wie man es sich vorstellt. Ich nahm nur einen winzigen Schluck, denn so nah war ich dem Tod dann doch noch nicht.“
Stattdessen konzentrierte sich Michael wieder auf sein Vorhaben, ein Feuer anzuzünden. Wenn es ihm vorn am Wagen nicht gelang, würde er es hinten versuchen, wo die Heckklappe vor dem Regen Schutz bot. Der Weg dorthin war ein zweitägiger Härtetest, ein regelrechtes Hinderniskriechen, bei dem er sich einen Weg bahnen musste. Jede Bewegung verursachte stechende Schmerzen, doch wenn er sich im Schneckentempo weiterbewegte, käme er vielleicht ans Ziel.
Michael bemerkte das Kondenswasser, das sich an den Fenstern gebildet hatte. Bei seinem ersten Versuch, das Wasser mit einer Visitenkarte abzustreifen, landeten die kostbaren Tropfen auf dem Boden. Er lernte, die Karte langsam zu bewegen, die Flüssigkeit mit Papierservietten aufzusaugen und in einen Becher auszudrücken. „Es waren etwa 30 Milliliter Wasser, und es schmeckte köstlich“, erinnert er sich.
Am Dienstagmorgen war Michael endlich an der Heckklappe angelangt, bestückt mit dem brennbaren Papier, das er noch gefunden hatte, inklusive der Einkommenssteuerbescheinigung vom Vorjahr. Die Sonne schien, und es war seine letzte Chance, um auf sich aufmerksam zu machen. Er tastete nach dem Türgriff und versuchte, ihn zu drehen. Da fiel ihm ein, dass er die alte Tür von außen mit einem Riegel verschlossen hatte, damit sie nicht von allein aufsprang. Es hatte zwei Tage gedauert, bis ihm das wieder einfiel.
Fast 108 Stunden nachdem sein Lieferwagen die Böschung hinabgefallen war, war Michael an einem Tiefpunkt angelangt. Er hatte seine Vorräte an Lebensmitteln und Wasser aufgebraucht. Die eiskalten Nächte hatten ihn geschwächt. Sollte er versuchen, zur Straße hinaufzukriechen? Das schien ihm unmöglich. Doch es graute ihm bei dem Gedanken, noch eine fünfte Nacht im Auto zu verbringen. Dann hörte er Stimmen.
Ethan Nesbitt und Will Mendham hielten gegen 13 Uhr für eine Mittagspause an. Die beiden Studenten von der University of Victoria waren unterwegs auf einer viertägigen Fahrradtour, und heute, Dienstag, war Tag drei. Sie bewunderten die Sonne, die sich in der Meerenge spiegelte, und dahinter das Panorama der Olympic Mountains im US-Bundesstaat Washington. Dann fiel ihnen ein Lieferwagen auf, der unter ihnen auf halber Höhe am Hang stand. Zuerst nahmen sie an, dass jemand darin wohnte. Doch als sie sahen, dass er im tiefen Gestrüpp steckte, gingen sie nachschauen. Sie bahnten sich einen Weg durch die Büsche und riefen: „Ist da jemand?“ Michael antwortete: „Hilfe!“
Mendham war als Erster am Wagen. Er entriegelte die Heckklappe und öffnete sie. Dort lag Michael in äußerst schlechter Verfassung: Er zitterte am ganzen Leib, fror und war blutverschmiert. Die Studenten gaben dem Mann ihre Jacken und eine Wollmütze. Dann versuchten sie, den Notruf zu wählen. Doch da der Empfang hier unten schlecht war, lief Mendham zur Straße hoch und hielt ein Auto an. Zum Glück konnte das Paar in dem Fahrzeug den Notruf wählen.
Die Rettungskräfte würden in etwa 40 Minuten eintreffen, sagte die Notrufzentrale. Daraufhin schnappte sich Mendham eine Wasserflasche und einige getrocknete Aprikosen aus seiner Fahrradtasche und kletterte damit zum Lieferwagen zurück. Michael hatte kaum noch die Kraft, den Kopf zu heben. Nesbitt hielt ihn, während der Verletzte etwas trank und aß. Nach einer halben Stunde traf ein Sanitäter ein, gefolgt von einem Krankenwagen und der Feuerwehr. Die Rettungskräfte legten Michael auf eine Trage und schnitten sich mit Motorsägen den Weg frei. Alle Anwesenden – sieben Rettungskräfte, Nesbitt, Mendham und das Paar, das den Notruf abgesetzt hatte – waren nötig, um ihn den steilen Hang hinaufzutragen.
Zweieinhalb Stunden nachdem die Radfahrer Michael gefunden hatten, wurde er zu einem wartenden Hubschrauber gebracht und ins Victoria General Hospital geflogen. Linda, die in der Zwischenzeit benachrichtigt worden war, machte ihm die Hölle heiß, weil er ihr nicht mitgeteilt hatte, was er vorhatte.
Die Ärzte entdeckten zahlreiche Brüche, versicherten Michael aber, dass sie ohne weitere Eingriffe heilen würden. Vier Tage später wurde er entlassen.
Anfang Dezember traf ich Michael in Victoria im Empress Hotel. Zusammen mit Linda, Michaels Schwester Wendy Stoll und zwei Highschool-Freunden befanden wir uns im Teesalon des Hotels mit Blick auf den Hafen. Michael saß in einem Rollstuhl, doch er freute sich, von alten Freunden umgeben zu sein. Kellner brachten Sandwiches und Gebäck, wir tranken Tee aus feinen Porzellantassen. Ein starker Kontrast zu den viereinhalb Tagen, die Michael in seinem Wagen verbracht hatte.
„Ich bin froh, dass es passiert ist“, versicherte uns Michael. Während der Tortur hätte er Zeit gehabt, über sein Leben nachzudenken, und er habe sich mit seiner Sterblichkeit abgefunden. Er hatte immer noch Schmerzen, aber die Wunden heilten. „An manchen Stellen geht es mir gut“, schmunzelte er. „Und ich bewege mich auch wieder schneller als im Schneckentempo.“