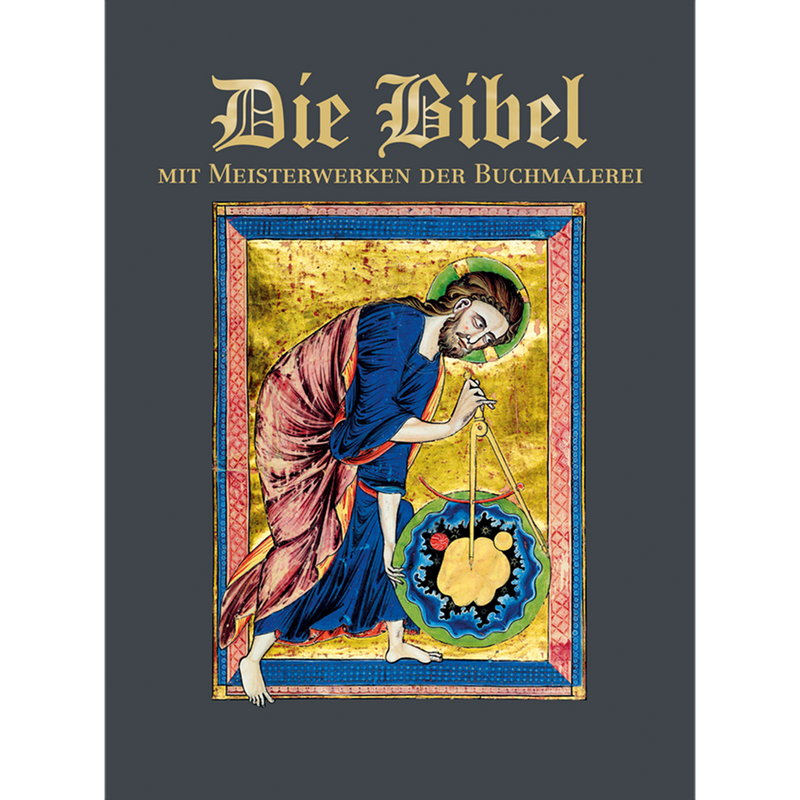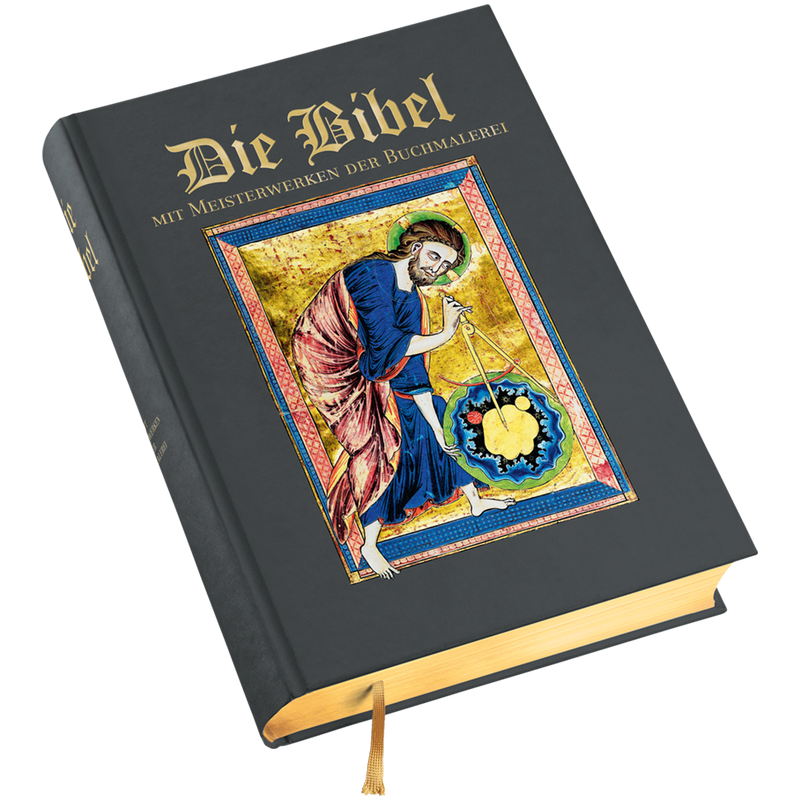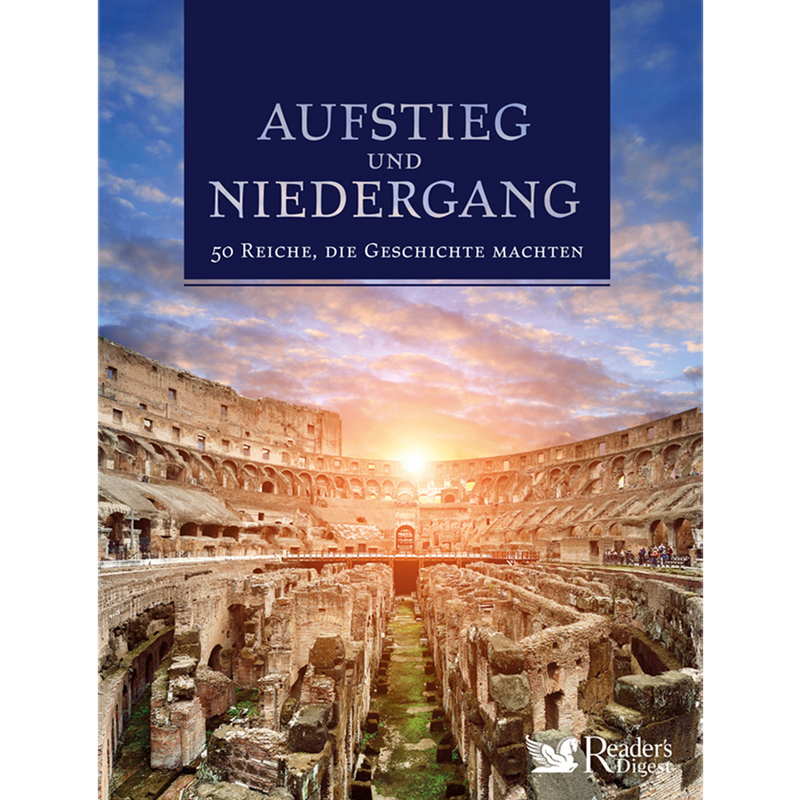Das Auto der Zukunft
Fachleute sind sich darüber einig, dass wir künftig mit deutlich anderen Autos unterwegs sein werden als bisher. Denn mit den herkömmlichen Benzinern und Dieselfahrzeugen lassen sich die Klimaziele nicht erreichen.

©
Außer an neuen Antrieben tüfteln Konstrukteure aber auch an nachhaltigen Alternativen für den Bau der Fahrzeuge und an Möglichkeiten, das Fahren noch bequemer und sicherer zu machen.
Kann man Autos aus nachwachsenden Rohstoffen bauen?
Schon in den 1930er-Jahren experimentierte der Autopionier Henry Ford mit einer Karosserie aus Hanffasern. Sein „Hemp Car“ verschwand zwar in der Versenkung, inzwischen haben Firmen die Idee aber wieder aufgegriffen und nutzen Verbundwerkstoffe aus Kunststoff und Hanffasern als Alternative zu herkömmlichen Kunststoffen. Denn diese haben viele Vorteile: Sie sind u. a. leicht, äußerst widerstandsfähig und schwer entflammbar. Verwendung finden diese Materialien z. B. in Tür- und Kofferraumauskleidungen, Armaturenbrettern und Heckspoilern. Die Firma Renew Sports Cars hat sogar eine von Hand produzierte Spezialanfertigung vorgestellt: Ein Auto, das ganz aus Hanfbauteilen besteht. Bis 2025 will die Firma Autos entwickeln, deren Produktion der Atmosphäre Kohlenstoff entzieht, statt weiteren freizusetzen.
Welche Antriebe haben Zukunft?
Viele Fachleute sehen den Verbrennungsmotor inzwischen als Auslaufmodell – auch dann, wenn man ihn nicht mit klimaschädlichem Benzin oder Diesel aus Erdöl betreibt. So ist Biosprit im Tank nicht unbedingt eine gute Alternative. Denn der Anbau der dafür nötigen Pflanzen konkurriert oft mit der Produktion von Nahrungsmitteln oder mit dem Naturschutz. Zwar lassen sich Verbrenner auch mit Wasserstoff antreiben, allerdings entfaltet dieser in einem Elektroauto mit Brennstoffzelle einen deutlich besseren Wirkungsgrad. In Sachen Klimafreundlichkeit sind Elektrofahrzeuge den Verbrennern also überlegen. Und das galt nach Angaben des Bundesumweltministeriums schon beim in Deutschland verwendeten Strommix des Jahres 2021. Wenn der Anteil der erneuerbaren Energien weiter steigt, wird die Bilanz noch besser ausfallen.
Es bleibt aber die Frage, welcher Elektroantrieb die größeren Vorteile hat. Außer mit Wasserstoff und einer Brennstoffzelle können Autos schließlich auch mit einem aufladbaren Akku fahren. Und da die Herstellung von Wasserstoff viel Energie kostet, gelten solche Batterieautos beim bisherigen Stand der Technik als effizienteste Lösung: Privat genutzte Pkws brauchen mit diesem Antrieb am wenigsten Energie für die gleiche Strecke. Die Herstellung der Batterien verschlingt aber viel Kobalt und andere Rohstoffe, die oft weder sozialnoch umweltfreundlich gewonnen werden können.
Werden wir in Zukunft noch selbst fahren?
Bisherige Assistenzsysteme können zwar durchaus selbstständig in eine Parklücke rangieren. Trotzdem galt jahrelang: Jedes Auto braucht einen Fahrer, der notfalls das Steuer wieder übernimmt. Mit einem neuen Gesetz zum autonomen Fahren, das 2021 in Kraft getreten ist, hat sich das aber geändert: Nun können auch Fahrzeuge ohne Fahrer am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen – allerdings nur in bestimmten Einsatzbereichen wie etwa dem Shuttleverkehr von A nach B.
Wie funktioniert autonomes Fahren?
Die für selbstfahrende Autos notwendige Technik gibt es bereits. Kameras liefern Bilder von der Umgebung vor, hinter und neben dem Fahrzeug, Sensoren messen den Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern und zu Hindernissen. Für den Überblick über die unmittelbare Umgebung hinaus ist das GPS-System zuständig. Zudem erkennt das Auto mithilfe von Beschleunigungssensoren, auf welcher Spur und in welcher Richtung es unterwegs ist. Und über WLAN oder das Handynetz ist auch die Kommunikation mit anderen Fahrzeugen und Datenquellen möglich. Das ist z. B. praktisch, wenn irgendwo ein unvorhergesehenes Hindernis auftaucht. Alle Informationen werden von einer Software ausgewertet, die das Auto lenkt, beschleunigt oder bremst. Solche Systeme können durch perfektes Schalten viel Sprit sparen und durch angepasste Geschwindigkeiten Staus vermeiden. Auch das Unfallrisiko sollen sie verringern. Denn anders als Fahrer aus Fleisch und Blut sind sie nie abgelenkt und können Abstände und Geschwindigkeiten viel genauer erfassen. Ihre Fehlerquote ist trotz aller möglichen Defekte deutlich geringer. Andererseits können Menschen komplexe Situationen und die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer viel besser einschätzen als Computer. Einen größeren Schwachpunkt selbstfahrender Autos sehen Fachleute aber in der IT-Sicherheit. Um zu verhindern, dass Hacker das Steuer übernehmen, muss noch viel getan werden.