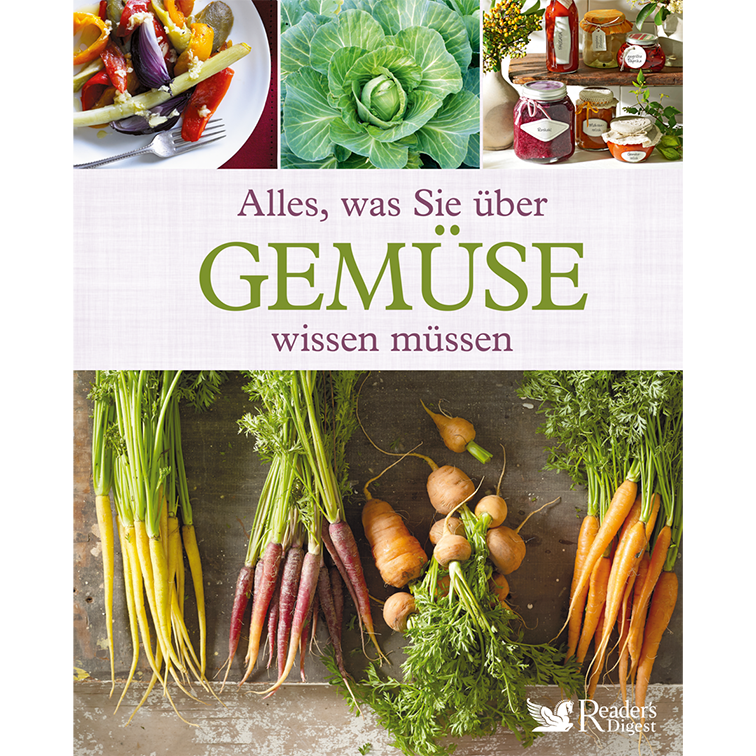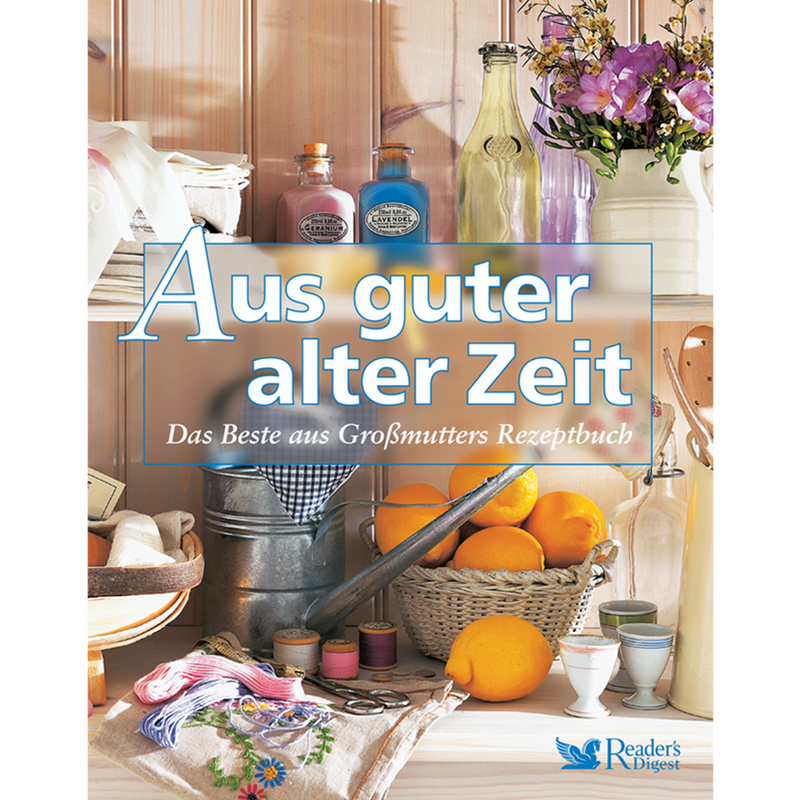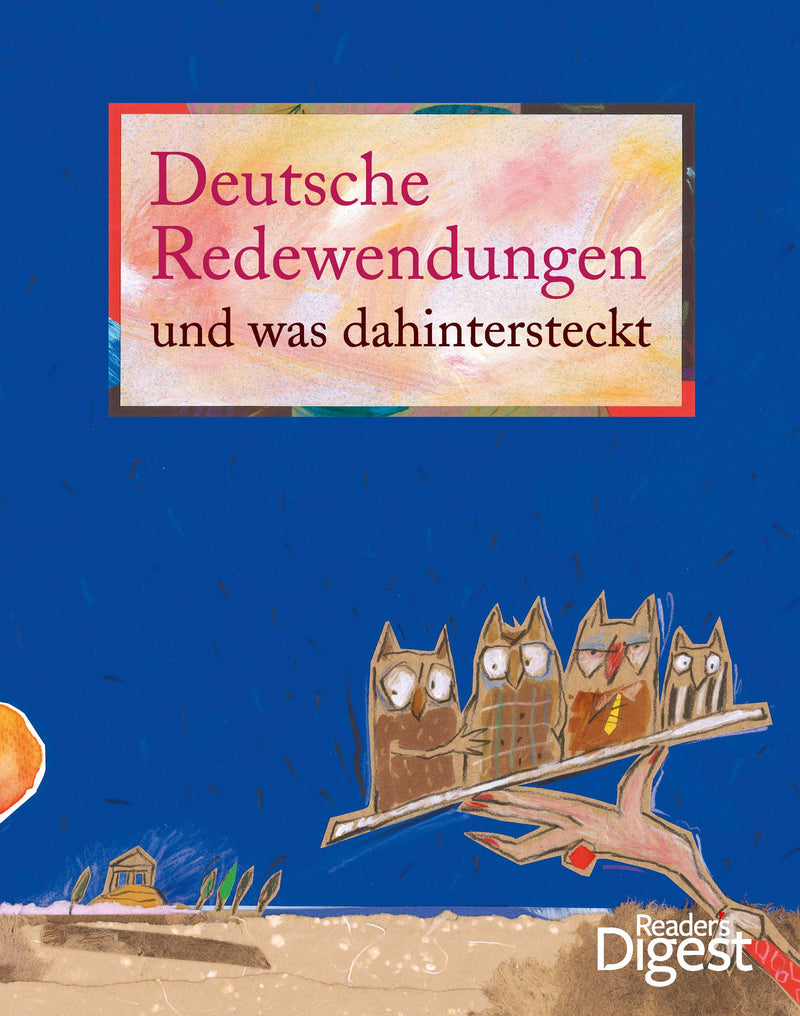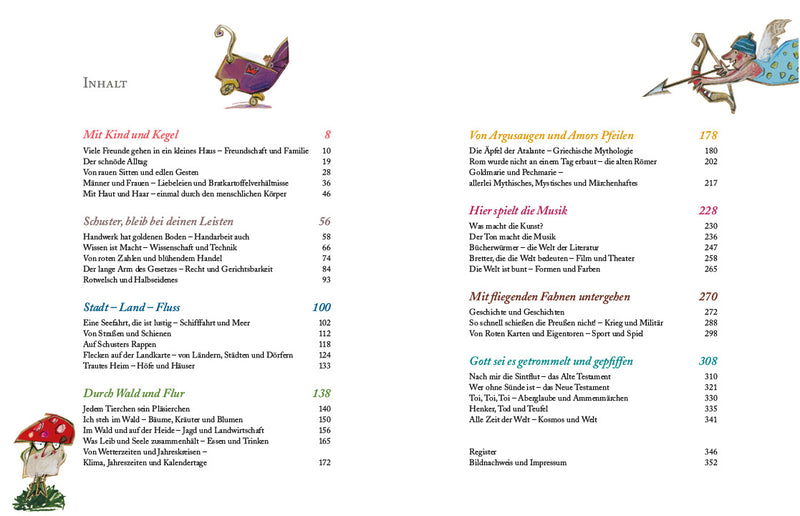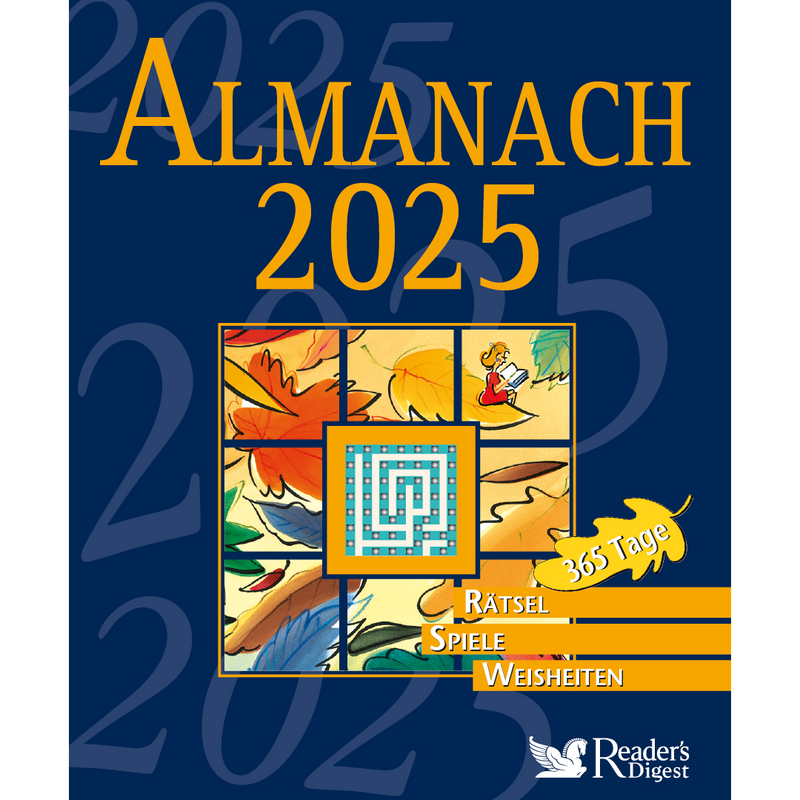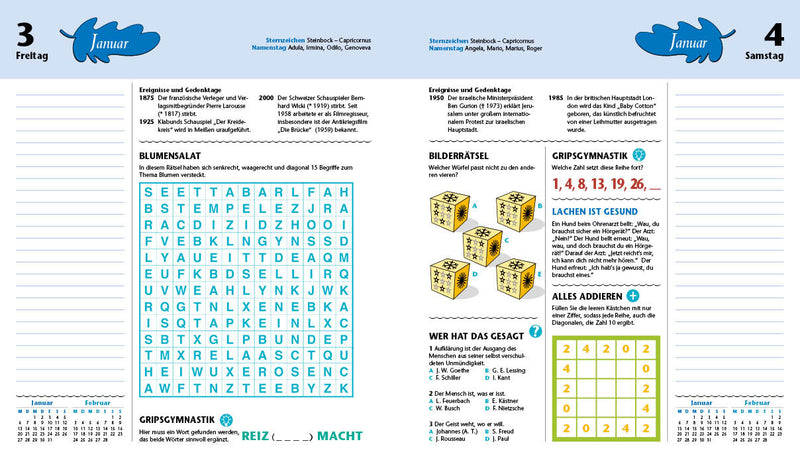Die Kulturgeschichte des Spiegels
Der Zauber des Widerscheins fasziniert die Menschheit seit der Entdeckung von Metall.

©
Ein klarer See, eine Landschaft darin auf den Kopf gestellt, gespiegelt in ihrer ganzen Schönheit. Glatte Wasseroberflächen waren die ersten Spiegel der Menschheit – lange vor der Blütezeit der Bespiegelung im Barock. In der griechischen Mythologie verlor Narziss sein Herz an seinen Widerschein in einem Teich und starb an unerfüllter Liebe.
Nach der Entdeckung von Kupfer und Bronze stellten die Sumerer bereits 3500 v. Chr. die ersten Spiegel her: Sie polierten Metallscheiben blank. Bei den alten Griechen waren die reflektierenden Scheiben so beliebt, dass sie eine Schule gründeten, in der die Kunst des Spiegelmachens gelehrt wurde. Sie stellten sogar schon Klappspiegel für unterwegs her. Über Jahrtausende blieb das begehrte Utensil der Eitelkeit jedoch ein Luxusobjekt im Kleinformat.
Im 14. Jahrhundert experimentierten Glasbläser erstmals mit Metalllegierungen in Glaskugeln. Aber erst mit der Renaissance änderte sich Grundlegendes. Den Glasbläsern von Murano bei Venedig gelang es, dünne Kristallglasplatten herzustellen, die nicht nur flach, sondern auch vollkommen glatt gewalzt und auf der Rückseite verzinnt waren. Diese Kostbarkeiten steckten sie in kunstvoll gestaltete Rahmen.
Das weckte Begehrlichkeiten bei den Königen von Frankreich. Sie begannen, ihre Schlösser verschwenderisch mit Spiegeln auszustatten. Spiegelsäle wie in Versailles befriedigten die barocke Lust am Spiel mit Schein und Wirklichkeit, vervielfältigten weibliche Schönheit und kostbares Interieur ins Unendliche. Bis der Glasspiegel beim Bürgertum ankam, dauerte es jedoch. Erst im 19. Jahrhundert fand er Eingang in die Wohnzimmer. Spiegellabyrinthe sorgten zudem für Belustigung auf Volksfesten.
Heute ist uns gar nicht bewusst, wie oft wir uns täglich spiegeln: im Badezimmer, im Flur, im Auto, in Umkleidekabinen… Der Luxusgegenstand von einst ist aus dem Alltag kaum mehr wegzudenken.