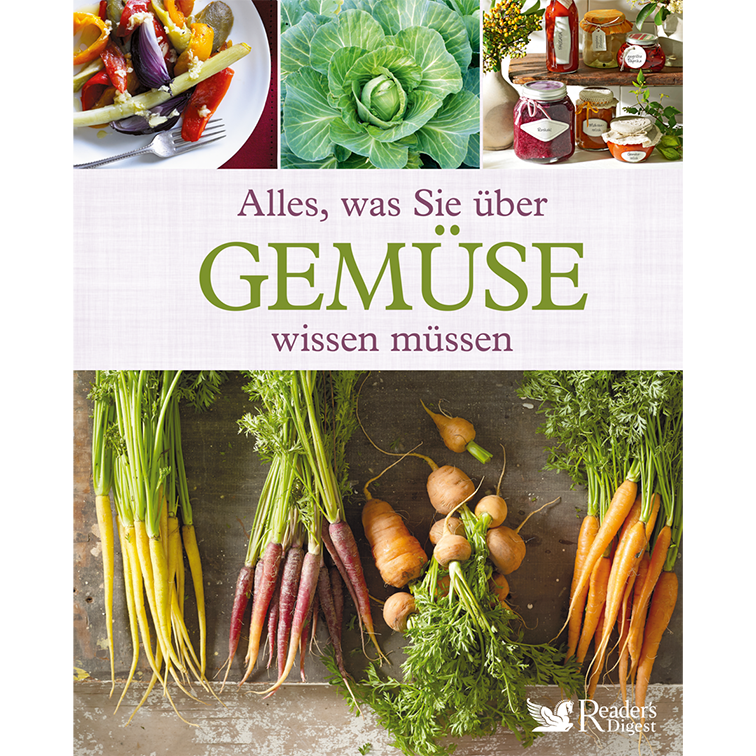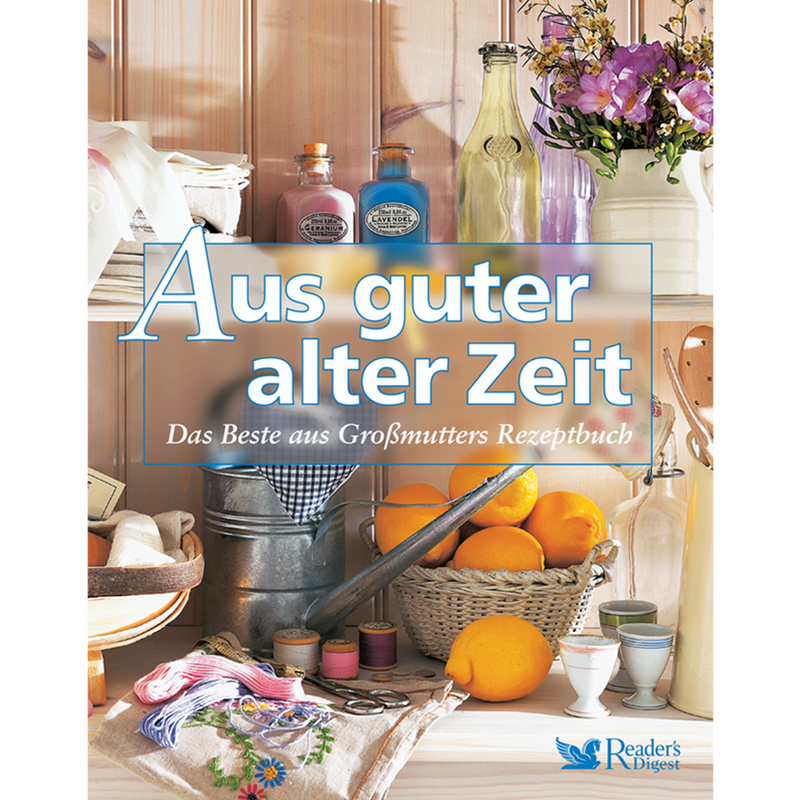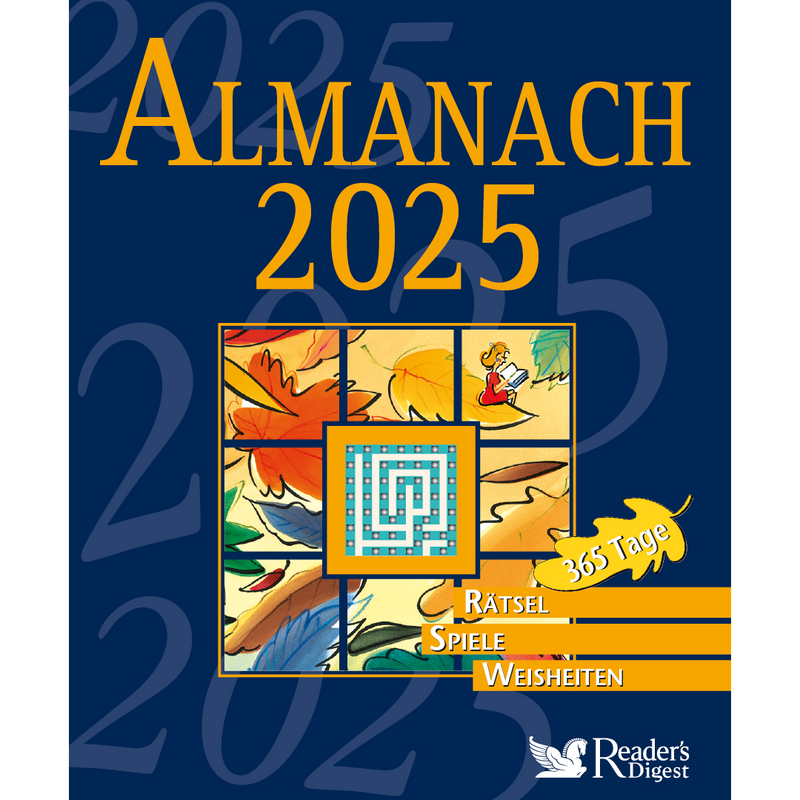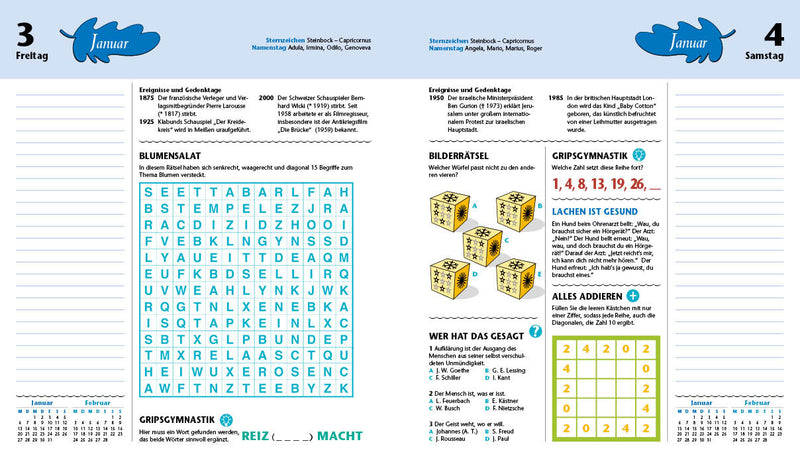Ist das wirklich ein Beruf?
Wasserrutschentester, Kuschel-Therapeutin, Zombie-Trainer - ja, diese Jobs gibt es wirklich! Erfahren Sie hier mehr darüber.

©
Der Wasserrutschentester
Das Schwimmbad in Melun bei Paris, Frankreich, musste wie viele andere während der Coronapandemie geschlossen werden. Der Rettungsschwimmer Guillaume Pop nahm deshalb Jobs in anderen Schwimmbädern an, die aber praktisch menschenleer waren. In einem davon gab es eine kleine Wasserrutsche, die den heute 22-jährigen ehemaligen Leistungsschwimmer auf eine Idee brachte: Er drehte ein Video und veröffentlichte es auf TikTok. Darin gab er sich als „professioneller Wasserrutschentester“ aus. Wie er mit Schutzhelm und Warnweste eine Rutsche hinunterrutschte oder mit cooler Sonnenbrille und winziger Badehose zu flotter Musik breit lächelte, kam gut an. So wurde Pop schnell zur Sensation in den sozialen Medien. Er wurde angeheuert, um Rutschen und andere Einrichtungen in Wasserparks, Schwimmbädern und auf Campingplätzen in ganz Frankreich zu testen.
Heute hat Pop mehr als eine halbe Million Fans auf TikTok – und ein eigenes Unternehmen gegründet, das Wasserrutschen prüft. Er arbeitet nicht mehr als Rettungsschwimmer, sondern reist durch das Land, um verschiedene Rutschen auszuprobieren und unterhaltsame Videos zu drehen.
„Zuerst prüfe ich sie ohne Wasser, um sicherzustellen, dass sie in einem guten Zustand sind“, erklärt Pop. Wenn er feststellt, dass eine Wasserrutsche repariert werden muss – zum Beispiel wegen Fugen, die Nutzer verletzen könnten –, zieht die Geschäftsleitung einen Fachmann hinzu. „Danach teste ich sie mit Wasser“, so Pop.
Er schätzt, dass er etwa 700 französische Wasserrutschen geprüft hat, und hat nun ein Auge auf Wasserparks im Ausland geworfen, etwa in der Schweiz, in Portugal und Spanien, wo er im Winter Rutschen getestet hat. „Es ist der beste Job der Welt“, findet der junge Mann, dessen Videos bereits 80 Millionen Mal aufgerufen wurden. „Ich sitze nicht hinter einem Schreibtisch. Ich bin aktiv und draußen in der Sonne. Und ich habe ein tolles Verhältnis zu den Kunden. Tatsächlich sagen mir alle Kinder, dass sie Wasserrutschentester werden wollen!“
Rentierzüchterin
In Lappland, im hohen Norden Europas, leben etwa 180 000 Menschen – und rund 200 000 Rentiere. Die Tiere bewegen sich frei, gehören aber Züchtern, was durch eine Ohrmarke dokumentiert wird. Anne Ollila, eine von 4000 Rentierzüchtenden, arbeitet mit ihrem Mann und ihren beiden erwachsenen Söhnen und deren Familien im finnischen Teil dieser rauen Region. Ollila gehört zur Volksgruppe der Samen, die Tiere vor allem wegen des Fleischs halten, das als gesund und ethisch vertretbar gilt. Aber auch der Rentiertourismus ist mittlerweile zu einer wichtigen Einnahmequelle geworden. „Meine Familie züchtet seit mindestens neun Generationen Rentiere“, sagt Ollila, 50. Sie begann schon als kleines Kind mitzuhelfen, und ihr Schwiegervater tat es bis zum Alter von 82 Jahren. Anne Ollila lebt etwa eine Stunde von Lapplands Hauptstadt Rovaniemi und sieben Kilometer von ihrem nächsten Nachbarn entfernt. Die Sommertage – wenn die Rentiere ihre Kälber gebären – sind lang, und im Juni geht die Sonne nie unter. Zu dieser Zeit schläft Ollila tagsüber und wandert nachts bei kühleren Temperaturen bis zu 20 Kilometer, muss aber unterwegs Schwärme von Stechmücken ertragen.
Im tiefsten Winter gibt es nur wenig Tageslicht, obwohl Ollila betont, dass es nicht ganz dunkel ist. „Der Schnee reflektiert das Sternenlicht“, sagt sie. Viele Weiden sind gefroren, und die Rentiere ziehen in den Wald, um sich vor Raubtieren wie Wölfen, Luchsen, Vielfraßen und Steinadlern zu schützen. „Das Leben hier ist nicht einfach, aber so funktioniert die Natur“, sagt die Züchterin. Im Winter trainiert sie Rentiere darauf, Schlitten zu ziehen.
Am meisten zu tun haben Rentierzüchter im Frühsommer, wenn das Markieren ansteht, und im Herbst, wenn sie die Tiere zusammentreiben, um sie zu impfen und einige für die Schlachtung auszuwählen. „Rentiere sind Teil des Ökosystems“, erklärt Ollila, die auch Vorsitzende der Züchtervereinigung ist. „Aber wenn es zu viele sind, gibt es nicht genug Nahrung für alle. Wir müssen die Herdengrößen stets kontrollieren.“
Anne Ollila und ihre Familie bieten Touristen Rentiererlebnisse an (reindeerjourney.fi): Besucher können die Tiere in freier Wildbahn oder auf der Farm aus nächster Nähe erleben, ihnen beim Training für das Ziehen von Schlitten zusehen oder eine Schlittenfahrt unternehmen. „Rentiere sind besonders kluge Tiere“, erklärt Ollila. „Sie haben unterschiedliche Persönlichkeiten, und einige sind total lustig.“ Einer ihrer Lieblinge ist Rocky, benannt nach dem Filmhelden. „Er ist sehr neugierig und steckt immer in Schwierigkeiten“, sagt sie. Rocky ist dafür bekannt, dass er mit dem Wäscheständer auf seinem Geweih davonläuft – mit der Wäsche seiner Besitzer daran.
Ollila gab 2010 ihren Job als Forscherin auf dem Gebiet der Soziologie an der Universität von Lappland auf, um sich ganz der Rentierzucht zu widmen. „Ich liebe die Umwelt, die Tiere und die Freiheit“, schwärmt sie. „Außerdem habe ich das Gefühl, zu etwas Größerem zu gehören, zur Kette des Lebens über die Generationen hinweg.“
Statuenankleider
Rund 160-mal im Jahr, bei Regen, Sonnenschein oder Frost, klettert Nicolas Edelman, 43, in Brüssel auf eine Leiter, um die berühmte Bronzestatue eines kleinen Jungen anzuziehen. Das 58 Zentimeter hohe Manneken-Pis („der pinkelnde Junge“), steht an der Ecke der Rue de l’Etuve und der Rue du Chêne und ist eine Touristenattraktion in der belgischen Hauptstadt. Edelman ist vermutlich der 13. offizielle Ankleider der Statue seit Beginn der Aufzeichnungen im 18. Jahrhundert. Manneken-Pis, das bis 2019 frisches Trinkwasser „gepinkelt“ hat, wurde bereits im 14. Jahrhundert als öffentlicher Trinkbrunnen erwähnt und soll den Widerstandsgeist der Brüsseler Bevölkerung repräsentieren. Eine Legende besagt, dass es einem Jungen nachempfunden ist, der auf eine brennende Lunte urinierte, um zu verhindern, dass Belagerer das Stadttor anzünden.
Die Statue wird zu besonderen Anlässen wie Nationalfeiertagen, internationalen Veranstaltungen, Jubiläen und sogar zu wichtigen Spielen der belgischen Fußballnationalmannschaft eingekleidet. Die Kostüme werden in einem Museum ausgestellt. Das älteste Exemplar ist ein blauer Anzug mit Brokatbesatz, bestickten Hosen und weißen Handschuhen – ein Geschenk des französischen Königs Ludwig XV. aus dem Jahr 1747. Er schenkte es der Stadt als Wiedergutmachung für den Diebstahl der Statue durch seine Soldaten.
„Die offizielle Sammlung umfasst derzeit 1129 Kostüme“, sagt Edelman, ein ehemaliger Koch, der seit 2014 als Ankleider tätig ist. Und die Sammlung wird immer größer: Ausländische Organisationen und Regierungen spenden speziell angefertigte Exemplare. „Etwa die Hälfte der Kleidung stammt aus dem Ausland“, erläutert Edelman. Wenn ein Land oder eine Institution ein Kostüm beisteuern möchte, muss es von einem offiziellen Ausschuss in Brüssel genehmigt werden. Nachdem das fertige Kleidungsstück geliefert wurde, wird es an einer Nachbildung der Statue anprobiert, und alle notwendigen Änderungen werden vorgenommen.
Im Rahmen einer feierlichen Zeremonie zieht Edelman die Statue hinter einem Vorhang an – natürlich mit ausgeschaltetem „Pipi“. Dann öffnet der Ankleider den Vorhang und präsentiert den Schaulustigen das neu eingekleidete Manneken-Pis. Zu Edelmans Lieblingskostümen gehört das, mit dem er die Statue am 6. Dezember, dem Nikolaustag, kleidet. „Stellen Sie sich einen Heiligen vor, der Pipi macht“, lacht er. „Meine Aufgabe ist es, die Menschen glücklich zu machen“, freut sich Edelman. „Manneken-Pis ist Teil der Brüsseler Volkstradition. Es ist eine große Ehre, dieses Symbol der Stadt, aus der ich stamme, zu kleiden und zu pflegen.“
Kuscheltherapeutin
Elisa Meyer studierte 2016 in Österreich Philosophie und Germanistik, als sie einen Artikel über eine neue Therapieform las. Bei der Kuscheltherapie werden platonische Berührungen eingesetzt, die laut Cuddle Professionals International, dem Verband für Kuscheltherapeuten, „Ängste und Stress reduzieren sowie das Selbstvertrauen und das Selbstwertgefühl verbessern können“. Meyer, die ursprünglich aus Luxemburg stammt, war fasziniert, da sie sich schon immer eine Karriere im therapeutischen Bereich vorstellen konnte. „Mein erster Gedanke war: ‚Wow, das ist der perfekte Job, weil ich mich dabei gleichzeitig selbst entspannen kann‘“, berichtet sie strahlend. Doch nach zwei Onlinekursen wurde Meyer klar, dass Kuscheltherapeut ein ernsthafter Beruf ist. Sie stellte zwei Seiten mit strengen Regeln zusammen – vor allem, dass die Kuscheltherapie keine sexuelle Komponente hat. Und obwohl ihr bewusst war, dass die Kuscheltherapie keine Medikamente oder psychologische Betreuung für Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen ersetzen kann, erkannte sie, dass sie als Ergänzung zu diesen Behandlungen Erfolge bringen kann.
Meyer begann ihre Praxis in Wien als Nebenbeschäftigung zu ihrem Promotionsstudium und ihrem Lehrauftrag an der Universität. Inzwischen ist sie hauptberufliche Kuscheltherapeutin in Leipzig. Die 37-Jährige empfängt Kunden in ihrem Studio, wo sie mit ihnen darüber spricht, was sie sich von der Sitzung erhoffen. Viele sind einsam, beispielsweise Männer mit sozialen Ängsten, die sich bei Frauen nicht wohlfühlen. Andere sind vielbeschäftigte Menschen, die einfach nur entspannen wollen. Der Rest der Sitzung wird auf dem Bett oder Sofa verbracht. In der Regel wechseln sie während der 50- bis 80-minütigen Kuschelsitzung ein- bis zweimal die Position. Beim Kuscheln wird im Körper Oxytocin freigesetzt, erklärt Meyer. „Der Körper fühlt sich sehr entspannt an. Die Menschen haben das Gefühl, dass alles in Ordnung ist und sein wird. Sie lächeln danach sehr viel. Oxytocin ist als ‚Liebeshormon‘ bekannt.“
Meyer erinnert sich an einen Kunden, der wegen eines Problems mit seinen Stimmbändern nicht sprechen konnte. Während einer Kuschelsitzung kam seine Stimme zurück. „Er war so glücklich“, sagt sie. Allein das Wissen, dass er seine Stimme nutzen konnte, um aus seiner Isolation auszubrechen, war für ihn etwas Wunderbares. Sie führt die Kuscheltherapie auch in einem Heim für Erwachsene mit Lern- und Körperbehinderungen durch. Viele Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen möchten gern über ihre Schmerzen sprechen. „Man muss Menschen mögen und eine vertrauensvolle und positive Person sein“, konstatiert Elisa Meyer. „Man muss die Körpersprache lesen und erkennen können, was die Leute wollen und die Art der Berührung entsprechend anpassen. Manchmal haben meine Kunden alle Freude am Leben verloren“, sagt sie. „Wenn ich sehe, dass sie wieder Hoffnung schöpfen, ist das die größte Belohnung für mich.“ Meyer hat zwei Bücher über die Kuscheltherapie geschrieben und bildet nun angehende Therapeuten aus.
Zombie-Trainer
Stevie Douglas schätzt, dass er in den vergangenen zehn Jahren mindestens 1000 „Zombies“ ausgebildet hat. Der 52-jährige Schotte hat Menschen gelehrt, sich wie Untote zu verhalten – wie Zombies in Filmen, beispielsweise Nacht der lebenden Toten. Glücklicherweise ist Douglas ebenso quicklebendig wie alle seine Schüler. Angefangen hat er als „Gruselschauspieler“, der Menschen in Geisterbahnen erschreckte. „Ehe ich mich versah, wurde ich engagiert, um Filmfiguren zu spielen, von Serienmördern bis hin zu Kettensägen schwingenden Verrückten“, lächelt Douglas. „Auch Zombies kamen häufig vor.“ Als großer Fan von Horrorfilmen fiel Douglas auf, dass die Zombies, die er in Filmen sah, oft nicht überzeugend waren. „Sie bewegten sich schlecht“, findet er. „Ich dachte, ich könnte es besser machen.“ Also gründete er mit einem Freund 2012 ein Unternehmen, um Zombies für Filme, Fernsehen und Veranstaltungen bereitzustellen. Ein Jahr später starteten sie ein Ausbildungsprogramm für angehende Zombies. Die Sache kam ins Rollen, als sie eine Anfrage für 300 Darsteller für The Generation of Z erhielten, eine interaktive Produktion, die drei Wochen lang in einer Tiefgarage auf dem weltberühmten Edinburgh Festival Fringe lief. Die Show war ein Hit.
Der Unterricht findet im obersten Stockwerk eines Theaters in Glasgow statt, wo Douglas die Schüler in verschiedenen Aspekten des Zombieseins unterrichtet. Er bittet sie beispielsweise, aufzustehen, ein Bein nach innen zu winkeln, dann den Kopf anzuheben, als wäre er an einer Schnur befestigt – und schon hat man einen Zombie. „Die Geräusche sind noch einfacher zu lernen“, erklärt Douglas. Zu den typischen Zombielauten gehören Schreien, Heulen und Keuchen.
Der Trainer weist seine Schüler darauf hin, wie wichtig es ist, auf die Sicherheit zu achten, wenn man Menschen erschreckt. Sie sollen ihnen beispielsweise in der Geisterbahn nicht zu nahe kommen und immer mindestens eine Armlänge Abstand einhalten. Zu den Absolventen der Akademie gehören einige Wrestler und ein kräftiger, 2,1 Meter großer Zombie. „Wenn Big Ross aus der Ecke kommt, kann man die Angst in den Augen der Leute sehen“, scherzt Douglas, der auch an Filmsets gearbeitet hat, um Schauspielern beizubringen, wie man Zombies spielt. Er betont, dass die Absolventen seiner Akademie keine Statisten sind, sondern Schauspieler.
Mit einem Schmunzeln erinnert sich Douglas an ein Ereignis in einem Park, als eine Frau bei der Begegnung mit einer Gruppe Zombies so erschrocken war, dass sie in einen Teich sprang. „Aber viele Menschen genießen es durchaus, erschreckt zu werden“, glaubt der Zombietrainer – und er ist gern bereit, ihnen dabei zu helfen.