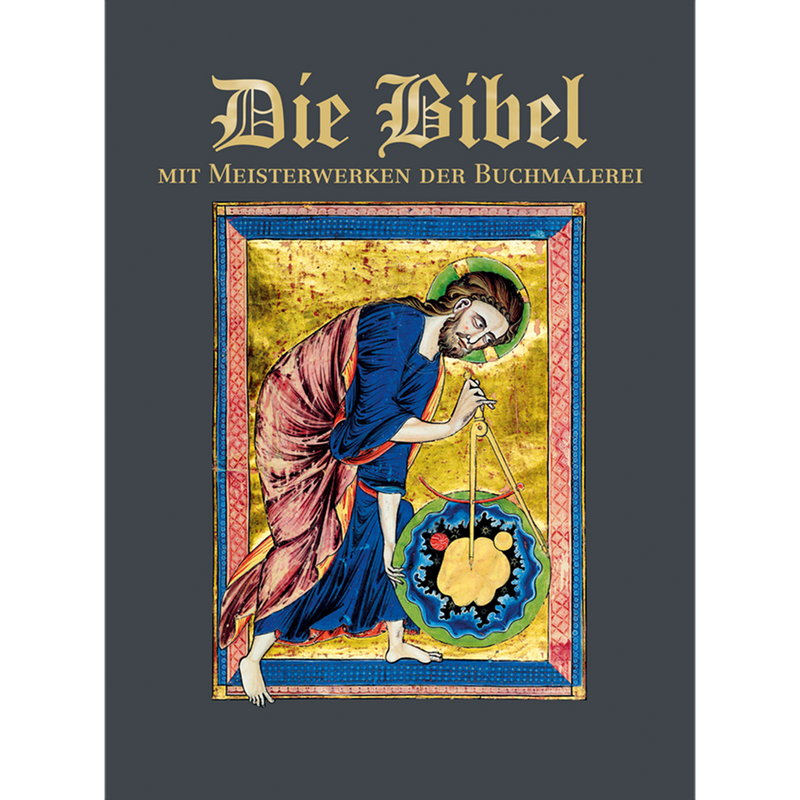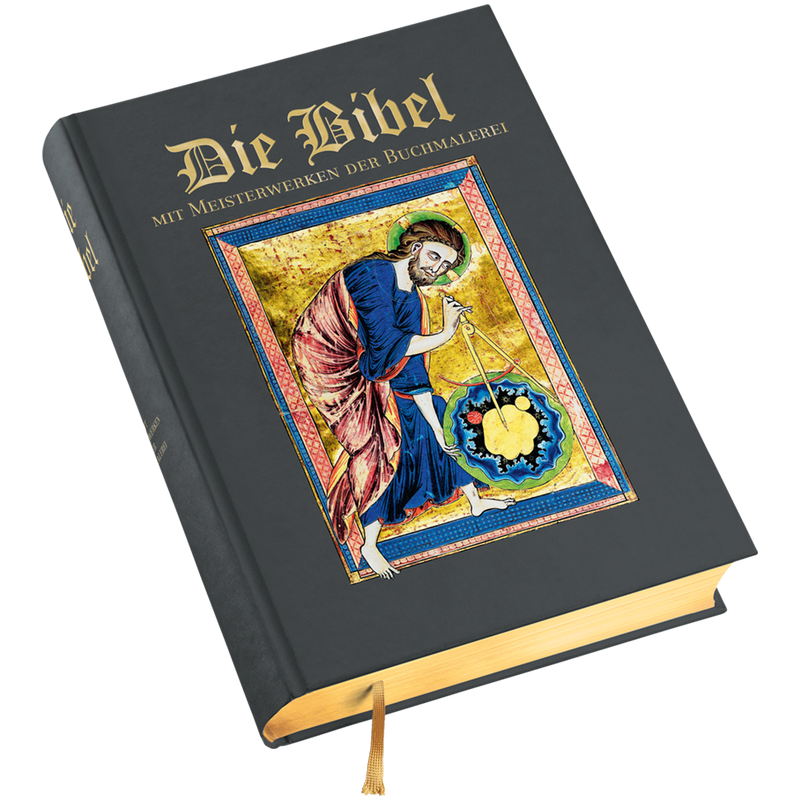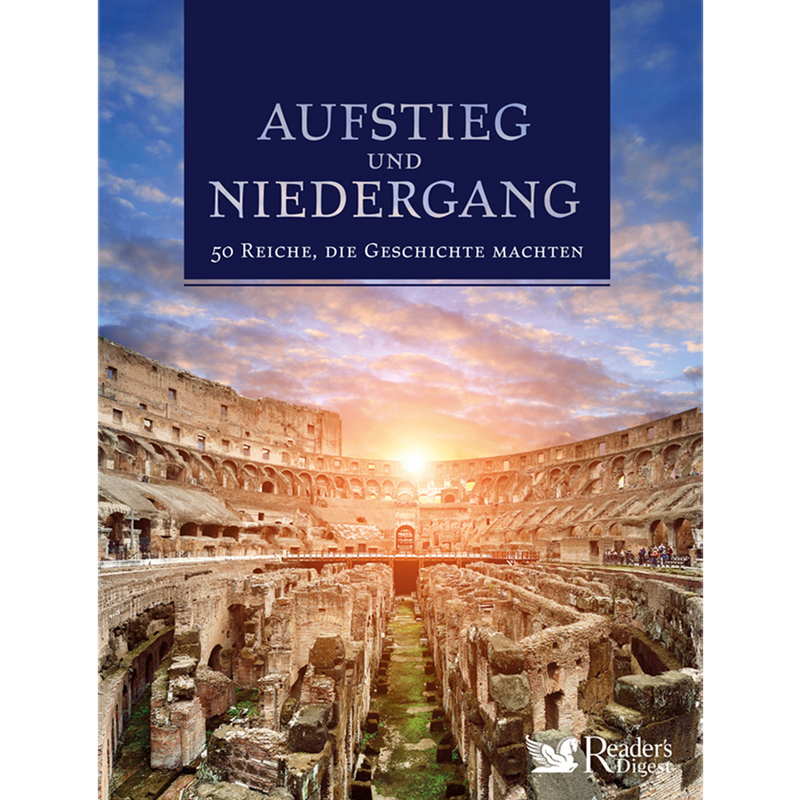Klosterbibliotheken, die Wissensspeicher des Mittelalters

©
Auch das Mittelalter hatte seine Speichermedien. Natürlich nicht die wenige Zentimeter großen Chips und Silberscheiben des 21. Jahrhunderts, sondern gebäudegroße Datenspeicher, bewohnt von emsigen Wissenssammlern in Mönchskutten. Es waren die Klosterbibliotheken, die nicht nur den Geist ihrer Zeit, sondern auch das Erbe der Antike für die Nachwelt bewahrten. Viele der ganz frühen Bibliotheken wie die von Alexandria überstanden den Übergang zum Mittelalter nicht. Was an Dokumenten und schriftlichen Zeugnissen Feuer und Zerstörungen überlebt hatte, war ein Schatz, den es zu hüten galt. Und zu verbreiten – die Klöster trieben untereinander regen Austausch der Dokumente.
Deshalb mussten die kostbaren Schriften kopiert werden, eine mühsame Handarbeit, der Umberto Eco in seinem Roman „Der Name der Rose“ ein literarisches Denkmal gesetzt hat. Im Skriptorium, der Schreibstube jedes Klosters, fand eine ganz eigene Art des Dienstes an Gott Ausdruck, nämlich in der anstrengenden Arbeit, die Bibel und andere religiöse Literatur zu kopieren.
Die Mönche schmückten die Texte mit Initialien
Und es entstand eine besondere Form der Kunst: Begabte Mönche versahen die Texte mit schmückenden Initialien und Miniaturen, deren Handschrift auch auf die Bibliothek hinwies, in der sie entstanden waren. Auf diese Weise wurden die Klöster zu Zentren des Wissens. Sie beherbergten nicht nur Sammlungen theologischer, sondern auch juristischer oder medizinischer Texte wie etwa die heilkundlichen Schriften Hildegard von Bingens, Universalgelehrte und heute wohl berühmteste Nonne des Mittelalters.Weil das Kopieren so mühsam und zeitraubend war, besaßen die Klöster lange Zeit nur wenige Kodizes, wie die Sammlungen von Handschriften genannt wurden. Aufbewahrt wurden sie in Truhen oder im Armarium, dem Bücherschrank. Erst eine Erfindung in der Mitte des 15. Jahrhunderts machte die Klosterbibliotheken zu riesigen Datenspeichern: der Buchdruck. Die Bestände wuchsen von Dutzenden und Hunderten auf mehrere Zehntausend Bände, und doch war den Klosterbibliotheken nur eine kurze Blütezeit vergönnt. In der Reformation, die Martin Luther 1517 in Gang setzte, wurden unzählige Klöster aufgelöst, ihre Buchbestände gingen in Universitäts- oder anderen Bibliotheken auf.
Die traumschönen Klosterbibliotheken, voller Glanz und mit verschwenderischer barocker Pracht ausgestattet, die wir heute vor allem im süddeutschen Raum finden, entstammen der Gegenreformation. Buch reiht sich hier an Buch, Papier, Pergament, und das Leder der Einbände verbinden sich zu einem ganz besonderen Duft, und in den mal kathedralenähnlich hohen, mal in warmen Holztönen gehaltenen Regallabyrinthen herrscht eine ganz besondere Atmosphäre. Es ist das Wissen von Jahrhunderten, das hier ganz greifbar zwischen Buchdeckeln schläft.
Berühmte und gut erhaltene Klosterbibliotheken
Geistliches Zentrum St. Peter
Nur in Rahmen von Führungen kann man das ehemalige Benediktinerkloster St. Peter auf dem Schwarzwald besuchen. Station auf dem Rundgang ist auch die Rokokobibliothek, für die der Baumeister Peter Thumb verantwortlich zeichnete. Über dem hellen Bibliothekssaal in St. Peter thronen allegorische Figuren, welche die verschiedenen Wissensbereiche darstellen. Sie stammen von Matthias Faller, dem „Herrgottschnitzer des Schwarzwalds“.
Klosterhof 2, 79271 St. Peter
www.geistliches-zentrum.org
Kloster Bad Schussenried
Bücher scheinen in der Bibliothek des Klosters Bad Schussenried im oberschwäbischen Landkreis Biberach eine Nebenrolle zu spielen. Nicht
nur, weil manche Buchrücken lediglich Attrappen sind. Sondern auch, weil der zweistöckige Saal so reich mit Malerei und Skulpturen verziert ist, dass er wie ein Festsaal wirkt –
in dem Wissen gefeiert wird.
Neues Kloster 1
88427 Bad Schussenried
www.kloster-schussenried.de
Kloster Maria Laach
So stellt man sich eine Bibliothek vor: Regale über Regale an jeder Wand, die Stockwerke verbunden durch gusseiserne Wendeltreppen. Eigentlich existiert die Klosterbibliothek seit 1063, aber nach der Säkularisierung und der Auflösung des Klosters 1802 blieb von der Sammlung nichts übrig. Heute umfasst sie wieder 260 000 Bände.
www.maria-laach.de/bibliothek
Kloster Metten
In dieser Barockbibliothek dominieren vielfarbige Fresken, dazu kommen zahlreiche Bilder und Statuen in einem Formenschatz und einer Bildsprache, die nicht ganz leicht zu dechiffrieren sind. Umso besser also, dass man die Bibliothek nur in Rahmen von Führungen besuchen kann. Bemerkenswert ist etwa ein Fresko, das die Kirche in Gestalt einer Frau mit Papstkrone darstellt, die gegen die Reformation ankämpft.
Abteistraße 3, 94526 Metten
www.kloster-metten.de
Kloster Waldsassen
In der Stiftsbibliothek des Klosters Waldsassen in der Oberpfalz dominiert Holz. Zehn wundervoll detailreiche, überlebensgroße Figuren des Holzschnitzers und Bildhauers Karl Stilp scheinen die Empore im Bibliothekssaal zu stützen. Über ihnen wölbt sich eine reich verzierte Decke mit vier großen Gemälden.
Basilikaplatz 2, 95652 Waldsassen
abtei-waldsassen.de
Kloster Wiblingen
„Alle Schätze der Weisheit und der Wissenschaft“ findet man, laut einer Inschrift, in der Bibliothek des Klosters Wiblingen. Der Saal erstrahlt in überbordender Rokoko-Pracht. Skulpturen und ein verschwenderisches Deckenfresko ergänzen dieses Bücherfest. Die Buchrücken waren weiß beklebt oder gestrichen, damit sie farblich in die Bibliothek passten.
Schlossstraße 38, 89079 Ulm-Wiblingen
www.kloster-wiblingen.de