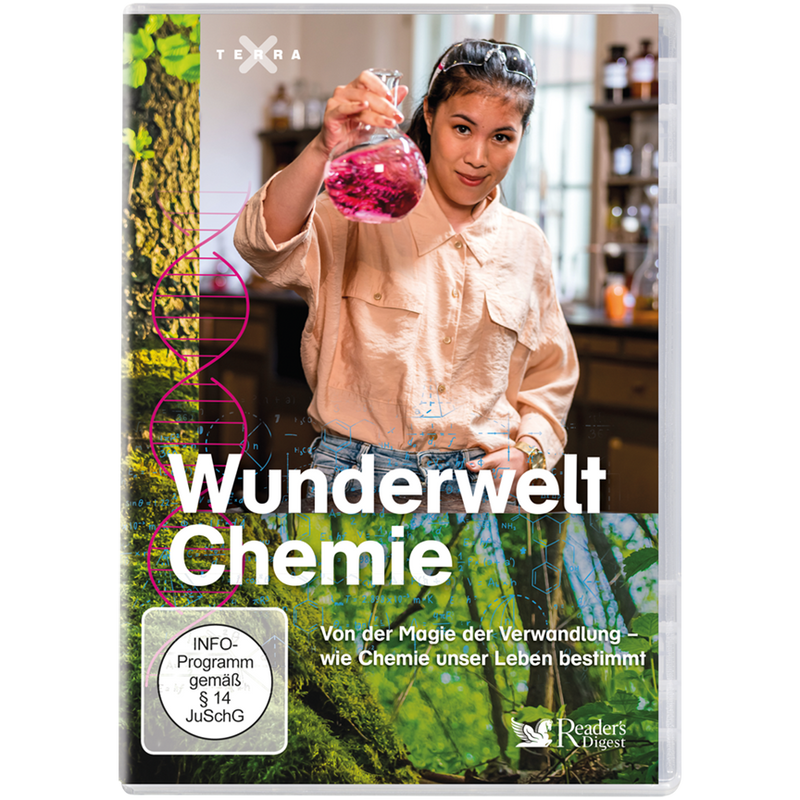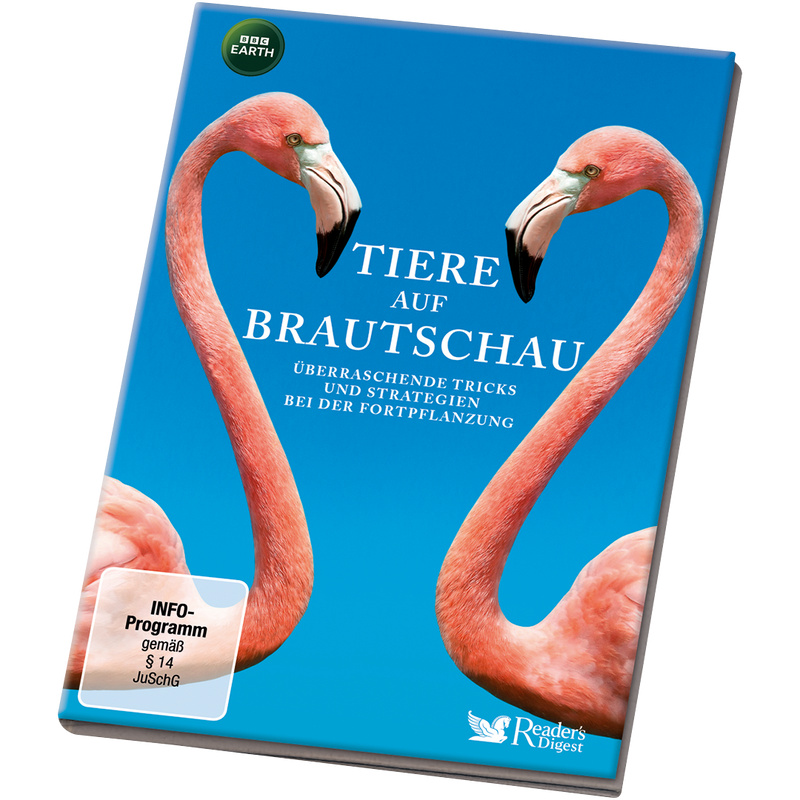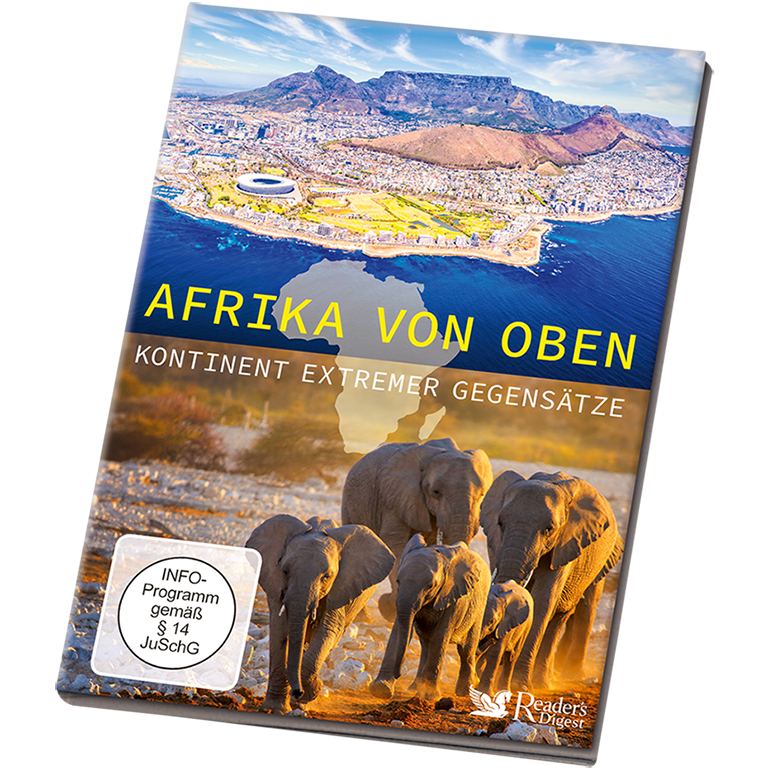Saubande: Leben in der Wildschwein-Rotte
Das Wildschwein fühlt sich in unseren Wäldern so richtig wohl und fügt ihnen keinen Schaden zu.

©
Die Keiler sind kampfeslustig. Aus ihren Mäulern trieft Schaum. Sie umkreisen sich, beharken sich mit den Hauern, wie die nach oben gebogenen, messerscharfen Eckzähne heißen. In der Paarungszeit im November und Dezember sind die männlichen Wildschweine außer Rand und Band. Erst wenn der Rivale klein beigibt und das Weite sucht, kehrt Ruhe ein. Dann kommt es zum Liebesspiel mit der Bache, dem Weibchen. Im Wildschweingehege von Karlheinz Kollmannsberger in Calw-Wimberg im Nordschwarzwald geht es weitaus friedlicher zu. Das liegt vor allem daran, dass es dort nur einen dominanten Alt-Keiler gibt. „Sonst hätten wir hier zu viel Stress“, sagt der Gehege-Leiter, der zugleich städtischer Revierförster ist. Die Schweine-Rotte hinter dem Zaun in Calw umfasst 19 Tiere: fünf Keiler, sechs Bachen, acht Jungtiere. Vier der fünf Keiler sind noch „Halbstarke“, wie Kollmannsberger anfügt, sie können Carlo, dem ausgewachsenen Männchen, nicht wirklich Konkurrenz machen.
Auch zutrauliche Schweine im Gehege bleiben Wildtiere
Carlo trottet gerne mit der ganzen Familie durch die 5,5 Hektar große Anlage. In freier Wildbahn wäre das nicht so, da sondern sich die Männchen ab und kommen nur in der Paarungszeit mit den Weibchen zusammen. Im Gehege ist alles ein bisschen anders. „Da werden sie oft so zutraulich wie Hunde“, erklärt Förster Kollmannsberger.
Der wild lebende Bestand wird deutschlandweit auf rund eine Million geschätzt, Tendenz steigend. Das liegt an der außerordentlichen Fruchtbarkeit, dem Fehlen von Raubtieren und dem sehr großen Nahrungsangebot, das die Wildschweine hierzulande finden: Als anpassungsfähige Allesfresser bedienen sie sich in Gärten und Feldern, vor allem der Mais hat es ihnen angetan. Das führt zu Konflikten mit Landwirten sowie Kleingartenbesitzern. Legendär sind die hohen Bestände in Berlin, wo Wildschweine selbst schon auf dem Alexanderplatz gesichtet wurden.
Carlo und seine Kolleginnen wühlen derweil den Schwarzwald durch. In ihrem Gehege stehen Tannen, Fichten, Kiefern, Buchen und einige Eichen. Die sind etwas ganz Wunderbares für Wildschweine, denn noch lieber als Mais mögen sie Eicheln, die von den Bäumen purzeln. Dann grunzen und quieken die Tiere mitunter vor Vergnügen. Ausgelassen geht es auch zu, wenn sie sich im Schlamm suhlen, als ob er eine Wellnesspackung wäre. Bei Wärme ist er überlebenswichtig für Wildschweine. Da sie keine Schweißdrüsen haben, benötigen sie ihn zur Abkühlung. Außerdem dient er als Schutzschicht gegen Parasiten. Diese rubbeln Wildschweine auch an sogenannten Malbäumen ab, ihr Hals ist zu kurz, als dass sie sich mit der Schnauze putzen könnten.
Um fünf Uhr am Abend stehen Carlo und seine Bande in Calw-Wimberg erwartungsvoll parat: Fütterungszeit! Dann spaziert Nicolas Achten, ehrenamtlicher Helfer, zwischen ihnen herum. „Anfassen ist kein Problem, aber streicheln sollte man sie nicht“, weiß er aus Erfahrung. Auch im Gehege bleiben die Bewohner Wildtiere, zu große Vertraulichkeiten sollte man nicht riskieren.
In der freien Natur laufen einem Wildschweine erstaunlich selten über den Weg, obwohl es so viele von ihnen gibt. Sie riechen den Menschen auf große Distanz und halten sich von ihm fern. Zudem sind die Tiere dämmerungs- und nachtaktiv. Autounfälle mit ihnen zählen zu den heikelsten Wildschweinbegegnungen für Menschen. „Bloß nicht aussteigen! Vor allem, wenn Frischlinge dabei sind, sonst greift die Bache an“, warnt Förster Kollmannsberger. Trifft man die Tiere einmal auf weiter Flur an, ist wegrennen eine denkbar schlechte Lösung: Wildschweine sind schneller als der Mensch. „Blickkontakt halten und langsam rückwärts gehen“, rät der Förster, als Zeichen dafür, dass man sich zurückzieht.
Die „Gärtner des Waldes“ fördern das Baumwachstum
Im Wildgehege bekommt man die Schweine öfter zu sehen, auch bei Tag – sehr zur Freude der Besucher. Die können in Calw über einem 25 Meter langen Schausteg einen Blick ins Wildschwein-Reich von Carlo und seiner Familie werfen: Die dösen sommers wie winters gerne unter Bäumen in kleinen Kuhlen. Den Rest der Zeit graben sie den Waldboden mit ihren keilförmigen Köpfen vollständig um, immer auf der Suche nach etwas Verwertbarem. Wurzeln, Würmer, Engerlinge, Gräser, Aas – fast alles landet in ihrem Schlund. Das Wühlen kommt dem Wald zugute, denn die Wildschweine vermengen dabei verschiedene Bodenschichten, was dazu führt, dass Keimlinge besser wachsen.
Wissen Nicolas Achten und Karlheinz Kollmannsberger einmal nicht, wo sich ihre Tiere gerade aufhalten, folgen sie einfach dem Duft von Maggi. Tatsächlich riecht das Borstenvieh ähnlich wie die bekannte Speisewürze – ein olfaktorischer Zufall, der immer wieder Staunen und Heiterkeit auslöst.
Ein besonders schönes Schauspiel bietet sich, wenn im Frühjahr die Frischlinge auf der Welt sind. Die kleinen Wildschwein-Babys haben ein samtweiches, hellgestreiftes Fell, das erst nach drei bis vier Monaten sein typisches Muster verliert. Mit dem ersten Winter wandeln sie sich dann zu jenen robusten Schwarzkitteln, die durch die Wälder streifen.
Und denen fügen sie übrigens keinen Schaden zu: Wildschweine fressen weder Tannen-, Fichten- noch Buchentriebe. „Für uns Förster“, sagt Revierleiter Karlheinz Kollmannsberger, „sind Wildschweine wirklich kein Problem.“ Ein Blick ins Gehege auf dem Wimberg bestätigt das: Das Wäldchen, welches sie bewohnen, ist buchstäblich in einem sauguten Zustand.