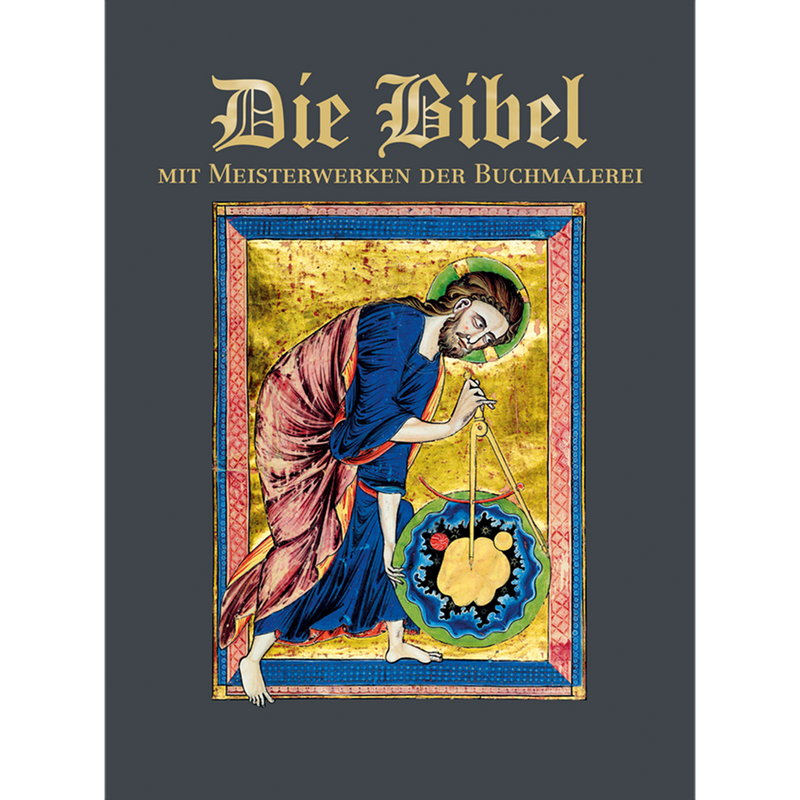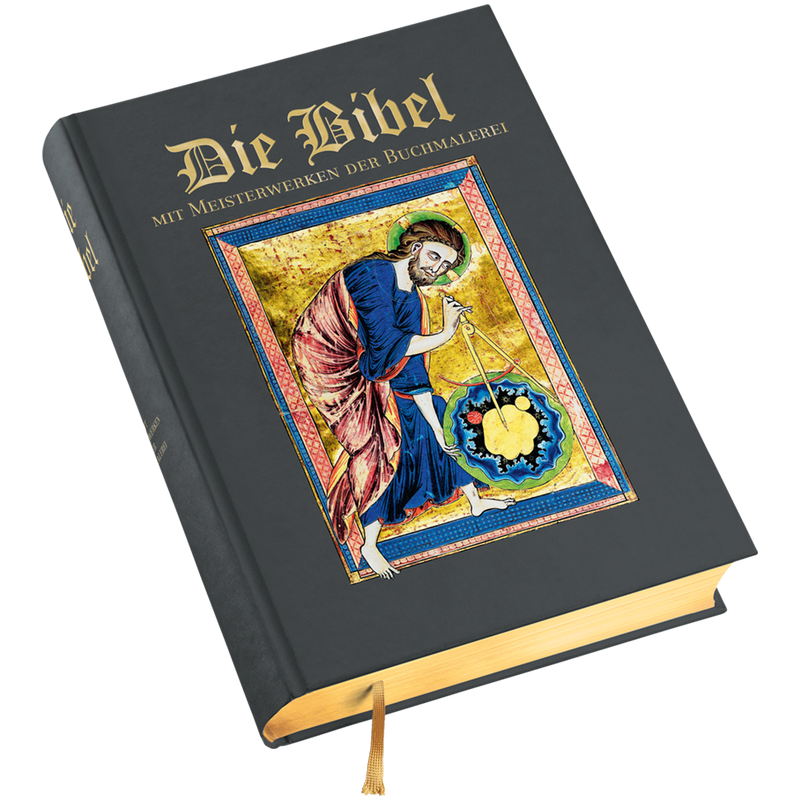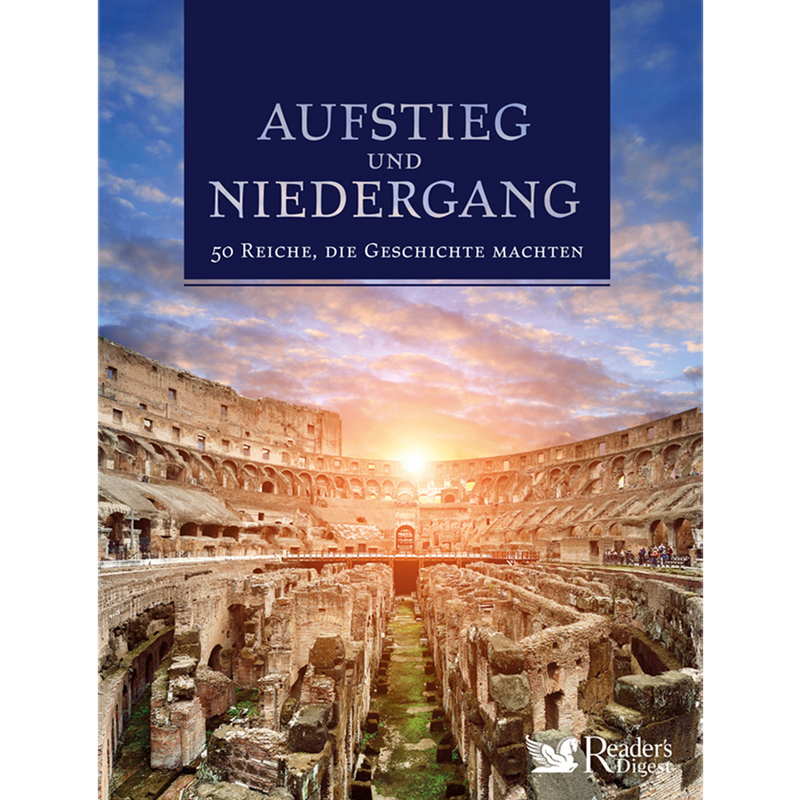Was ist Bionik?
Bionik untersucht natürliche Prozesse und versucht, die so aufgeklärten Prinzipien in technischen Anwendungen zu nutzen.

©
Wer gilt als der Begründer der Bionik?
Einer der ersten Bioniker war wohl Leonardo da Vinci. Er beobachtete bereits am Anfang des 16. Jh. den Vogelflug und entwickelte danach erste Flugmaschinen und Hubschrauber.
Hat der Fallschirm auch ein Vorbild in der Natur?
Bereits in den 1470er-Jahren zeigt das Manuskript eines unbekannten italienischen Autors einen ersten einfachen Fallschirm. Vielleicht dadurch angeregt skizzierte Leonardo da Vinci um 1485 einen deutlich verbesserten Fallschirm. Möglicherweise haben die Erfinder sich dabei von Löwenzahnsamen inspirieren lassen, die sich mit einem Schirm aus sehr leichten Härchen Hunderte von Metern weit tragen lassen. Den ersten Absprung mit einem Fallschirm wagte dann 1783 der Franzose Louis-Sébastien Lenormand vom Turm des Observatoriums in Montpellier.
Wie hat Otto Lilienthal das Flugzeug entwickelt?
Der Deutsche Otto Lilienthal gilt ebenfalls als Bioniker. Er beobachtete fliegende Störche und entwickelte aus der Analyse des Vogelflugs funktionierende Flugapparate. Mit diesen Geräten gelangen ihm am Ende des 19. Jh. erfolgreiche Gleitflüge.
Wo ist der Klettverschluss abgeschaut?
Auch der Klettverschluss hat ein Vorbild in der Natur: Der Schweizer Wissenschaftler Georges de Mestral fragte sich Mitte des 20. Jh., wie Kletten so hervorragend an Stoffoberflächen haften können, dass sie nur schwer wieder zu entfernen sind. Daraufhin untersuchte er die Früchte unter dem Mikroskop und entwickelte einen vergleichbaren künstlichen Haltemechanismus.
Ist es möglich, beim Tauchen nicht nass zu werden?
Die Wasserjagdspinne schafft es tatsächlich, beim Tauchen trocken zu bleiben. Feine Borsten auf ihrer Körperoberfläche schließen unzählige Luftbläschen ein, sodass ihr ganzer Körper von einer Lufthülle geschützt wird. Dieses Prinzip versuchen Bioniker für technische Anwendungen wie etwa Beschichtungen für Schiffsrümpfe nutzbar zu machen.
Was können Architekten aus der Natur lernen?
Filigrane und dennoch stabile Bauten fordern heute Architekten heraus. Für elegante Dachkonstruktionen wie z. B. beim Olympiapark in München liefern Spinnen ein natürliches Vorbild. Ihre Netze werden durch hauchdünne Quer- und Längsfäden gespannt und halten so enormen Druck- und Zugkräften stand. Selbst die Spinnenseide, die sehr leicht und gleichzeitig extrem stabil und dehnbar ist, versucht man im Labor nachzubauen.
Funktioniert eine künstliche Fotosynthese?
Solarzellen wandeln Sonnenlicht erheblich effektiver in nutzbare Energie in Form von Elektrizität um als die Fotosynthese. Allerdings benötigen grüne Pflanzen mit Wasser aus dem Boden und Kohlendioxid aus der Luft noch weitere Zutaten, um mit Sonnenlicht Biomoleküle herzustellen. Sie können also das Kohlendioxid wieder aus der Luft holen, das die Menschheit beim Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas bereits freigesetzt hat. Allerdings ist das recht langwierig. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Terrestrische Mikrobiologie in Marburg stellten daher 2021 eine künstliche Fotosynthese vor, die mit verschiedenen Enzymen aus Bodenbakterien, Purpurbakterien, Gänserauken und der menschlichen Leber arbeitet. Dieses Verfahren könnte in Baustoffen Kohlendioxid aus der Luft holen und so den Klimawandel wieder zurückdrehen. Allerdings liegt die praktische Anwendung noch weit in der Zukunft. Für die Energiewende kommen solche Methoden daher zu spät.
Sind Geckofüße Vorbilder für neue Klebstoffe?
Dank winziger Härchen an ihren Füßen können sich Geckos sicher auf spiegelglatten Flächen bewegen. Dieses Prinzip hat Stanislav Gorb von der Universität Kiel mit 29 000 Mikrostrukturen auf 1 cm2 einer Silikonfolie nachgebaut. Ganz ohne Klebstoff können mit dieser Folie sogar im Vakuum verschiedene Dinge fest miteinander verbunden werden.
Was kann die Technik vom Hai lernen?
Der Hai kann sehr weite Strecken mit geringem Energieaufwand zurücklegen. Ein Grund dafür liegt in seiner speziellen Haut, die nicht glatt ist, sondern viele feine Strukturen aufweist. Diese verringern durch Wirbel den Strömungswiderstand des Wassers. Heute gibt es bereits Schwimmanzüge, die ebenfalls solche Mikrostrukturen aufweisen. Und selbst bei Containerfrachtern wird mit ähnlichen Rumpfbeschichtungen experimentiert, um den Treibstoffverbrauch zu senken.
Gibt es einen schmutzabweisenden Anstrich?
Seit 1999 kann man die ersten Farben mit dem sogenannten Lotuseffekt kaufen. Der deutsche Botaniker Wilhelm Barthlott von der Universität Bonn entdeckte diesen Effekt bereits Mitte der 1970er-Jahre an der Lotospflanze. In der Natur gibt es auf der Oberfläche der Blätter winzig kleine Erhebungen, die dicht beieinanderstehen und von einer Schicht Pflanzenwachs bedeckt sind. Diese „Papillen“ verhindern einen Kontakt zwischen der eigentlichen, tiefer liegenden Blattoberfläche und einem Wassertropfen fast vollständig. Daher perlt Wasser rasch ab und spült dabei alle Schmutzpartikel weg. Diese Struktur ahmt die Lotusfarbe nach, mit der beispielsweise Hauswände gestrichen werden, die dann dauerhaft sauber bleiben.