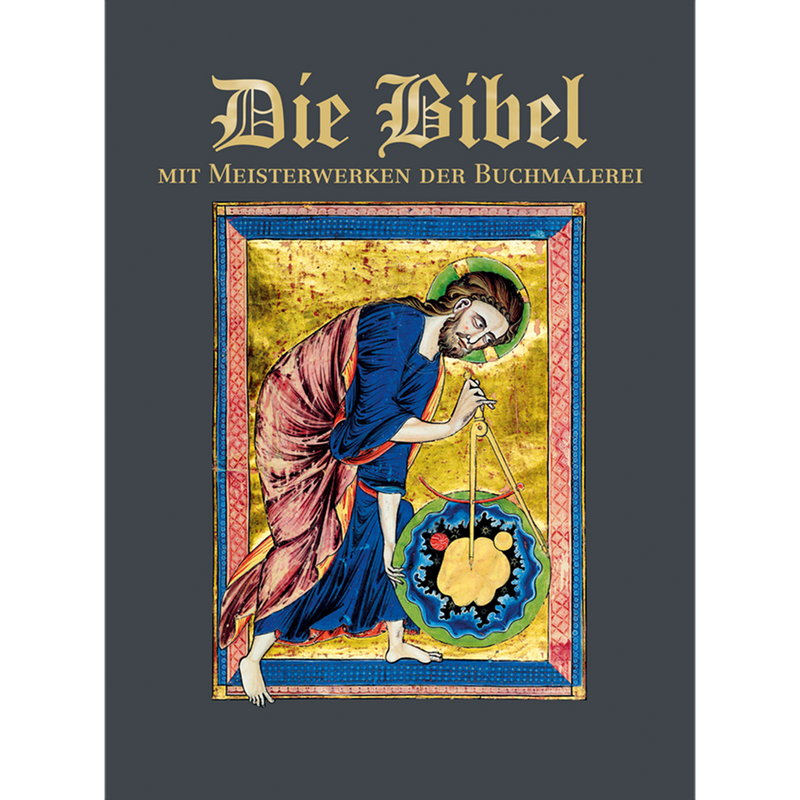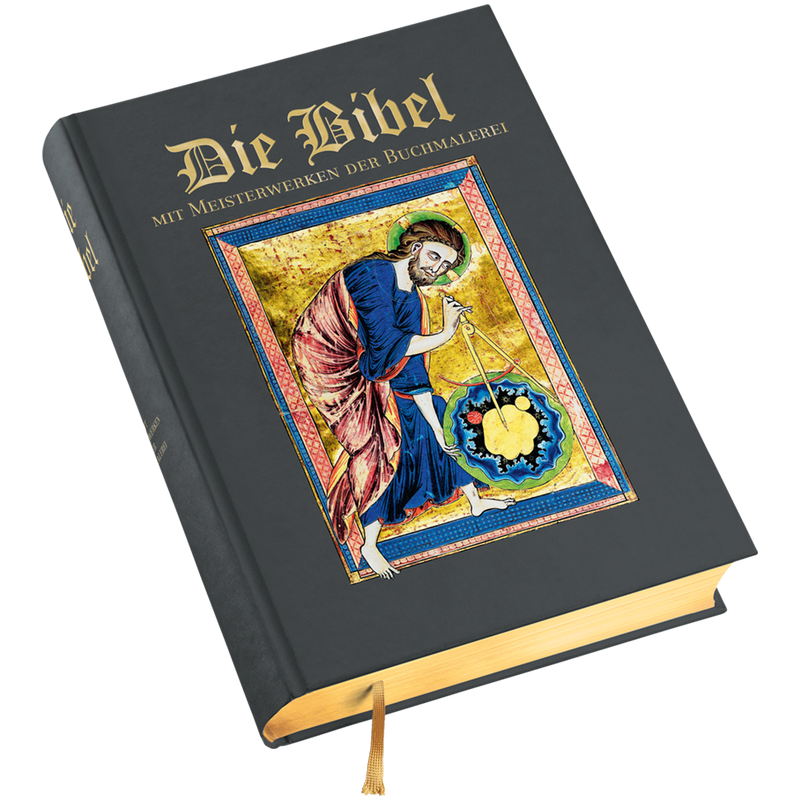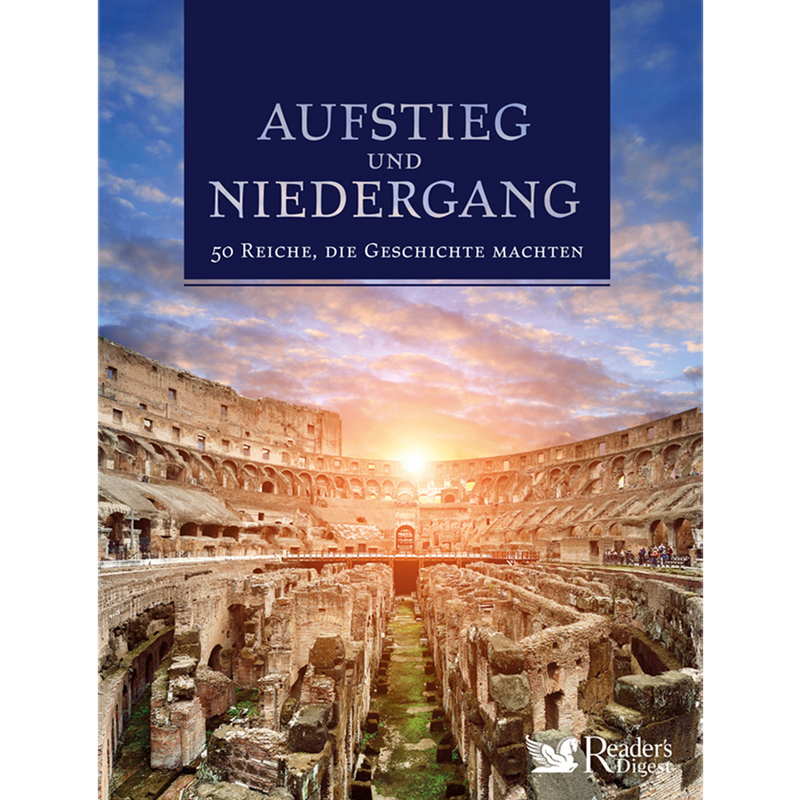Was passiert, wenn es blitzt?
Gewitter wecken menschliche Urängste. Wenn Blitze aus den Wolken zucken, werden unglaubliche Kräfte frei.

©
Wer einmal auf dem Gipfel eines Berges von einem Gewitter überrascht wurde, weiß, welch elementare Kräfte dabei freigesetzt werden. Neben dem Zerren und Schieben der Windböen, der plötzlich einsetzenden Düsternis, dem peitschenden Regen und dem unaufhörlichen Grollen des Donners sind es vor allem die Blitze, die Todesangst einflößen. Jetzt heißt es, Wasser sowie exponierte Punkte wie Gipfel, Grate, Felsvorsprünge oder Bäume meiden, sich auf den Rucksack hocken als Isolation gegen den Boden und Metall ablegen. Was man eben so tun sollte, wenn in der Atmosphäre über einem ein Naturphänomen tobt, das eine elektrische Spannung von bis zu 100 Millionen Volt und Hitze von mehreren 10.000 Grad erzeugen kann.
Von Blitz und Donner in den Bergen eingeholt zu werden, kann dramatisch sein. Aber selbst, wenn man im Flachland ein Dach über dem Kopf hat, während die Elemente toben, spürt man noch etwas von dieser Urangst des Menschen vor Gewittern. Sie sind keine Ausnahmesituationen wie Hochwasser oder Erdrutsche, sondern Teil des Alltags – vielleicht demonstrieren sie deshalb umso eindrücklicher die unberechenbare Kraft der Natur.
Im Wolken-Amboss herrschen Chaos und Tumult
Auch wenn Donnergrollen das Unbehagen drastisch untermalt, so ist es doch nur der akustische Ausdruck des eigentlichen Phänomens: Entlang des Blitzstrahls erhitzt sich die Luft in Sekundenbruchteilen auf bis zu 30 000 Grad und dehnt sich schlagartig aus. Die Explosion, die auf die grelle Energieentladung folgt, kündigt uns das Nahen des Gewitters an. Zu diesem Zeitpunkt ist das Unwetter aber längst sichtbar. Der kondensierende Wasserdampf innerhalb von aufsteigenden, warm-feuchten Luftmassen hat eine Cumuluswolke gebildet. Steigt die Luft weiter auf und kühlt dabei ab, wird der Cumulus zum Cumulonimbus. Stehen diese mächtigen, einem Amboss ähnlichen Wolkentürme am Horizont, ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis das Toben einsetzt. In der aufsteigenden Luft der Wolken herrscht bereits jetzt Chaos und Tumult, Winde zerren an Wassertröpfchen und Eiskristallen, lassen sie gegeneinander stoßen und zerstäuben. Auf diese Weise, vermuten Forscher, entstehen die unterschiedlichen elektrischen Ladungen der Teilchen: Die positiven wandern in der Wolke nach oben, die negativen nach unten. Diese unterschiedlichen Ladungen und ihre Trennung sind die Voraussetzung für Blitze.
Zeuge besonders vieler grell-weißer Himmelszacken wurden im Jahr 2021 die Menschen im oberbayerischen Landkreis Starnberg: 7,6 Blitzeinschläge pro Quadratkilometer hat BLIDS, der Blitz-Informationsdienst der Firma Siemens, dort verzeichnet. Augsburg und der Bodenseekreis landeten mit 5,9 auf Platz 2 und 3, während Bremen gerade mal von 0,3 Blitzeinschlägen heimgesucht wurde.
Ein riesiger Kurzschluss zuckt krachend in die Tiefe
Insgesamt 491 000 Mal hat es deutschlandweit 2021 eingeschlagen, so der BLIDS-Blitzatlas. Dass ein Blitz Menschen trifft, ist eher selten, da immer weniger in der freien Natur arbeiten. Im Schnitt gibt es 52 Blitzunfälle pro Jahr, durchschnittlich vier davon verlaufen tödlich. Die meisten Menschen werden nicht direkt getroffen, sondern stehen neben Bäumen oder Masten, von denen der Strom überspringt.
Physikalisch geschieht das immer auf die gleiche Weise: Die unterschiedlichen Ladungen der Teilchen in der Luft und auf der Erde erzeugen ein starkes elektrisches Spannungsfeld. Deshalb können Blitze auch innerhalb von Wolken entstehen – und als Wetterleuchten schaurig-schön den Horizont erhellen.
Dass der Blitz Richtung Erdoberfläche springt, liegt an der positiven Aufladung des Geländes unter dem Gewitter. Die Spannung zwischen der Erdoberfläche und der negativ geladenen Unterseite der Wolke erhöht sich bis … ja, bis der kritische Punkt überschritten ist und es zu einem riesigen Kurzschluss kommt: Der Blitz zuckt krachend in die Tiefe.
Mensch und Tier spüren diese Spannung in der Luft. Und manchmal kann man sie auch sehen: Für Seeleute war in früheren Zeiten das Elmsfeuer, das an den Mastspitzen bläulich loderte, Vorbote kommenden Unheils. Und tatsächlich zeigt diese elektrische Entladung, die Bergsteiger auch an ihren Eispickeln beobachtet haben, an, dass ein Blitz unmittelbar bevorsteht. Bei anderen Phänomenen wie dem Kugelblitz, einer Leuchterscheinung, die sich schwebend und scheinbar chaotisch in Bodennähe und manchmal sogar in geschlossenen Räumen bewegt, tappt die Wissenschaft noch im Dunkeln. Und nur wenige Menschen haben bisher jene Blitze gesehen, die sich ins Weltall entladen: Die Astronauten auf der Internationalen Raumstation ISS konnten „Blue Jets“ und rote „Elfen“ oberhalb großer Gewitterzellen aufzeichnen.
Bei all dieser Kraft: Wieso nutzen wir Blitze eigentlich nicht zur Energiegewinnung? Weil sie nun mal nicht vorhersehbar sind. Und weil sie ihre größte Leistung in Tausendstelsekunden freisetzen. Das macht sie unbrauchbar, destruktiv – und schöpferisch. Denn Blitze brachten den Steinzeitmenschen das Feuer. Und standen auf diese Weise ganz am Anfang der Zivilisation.