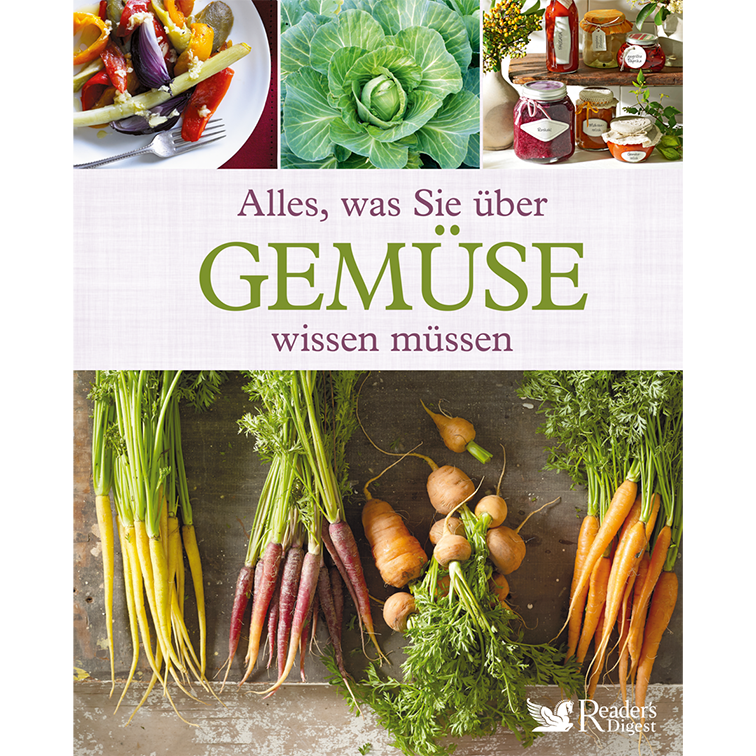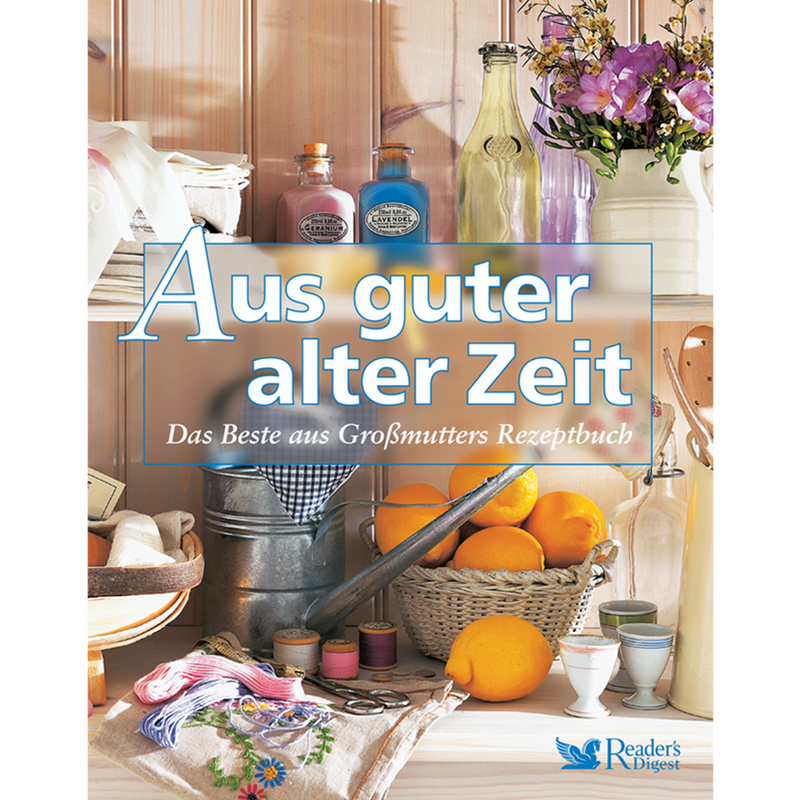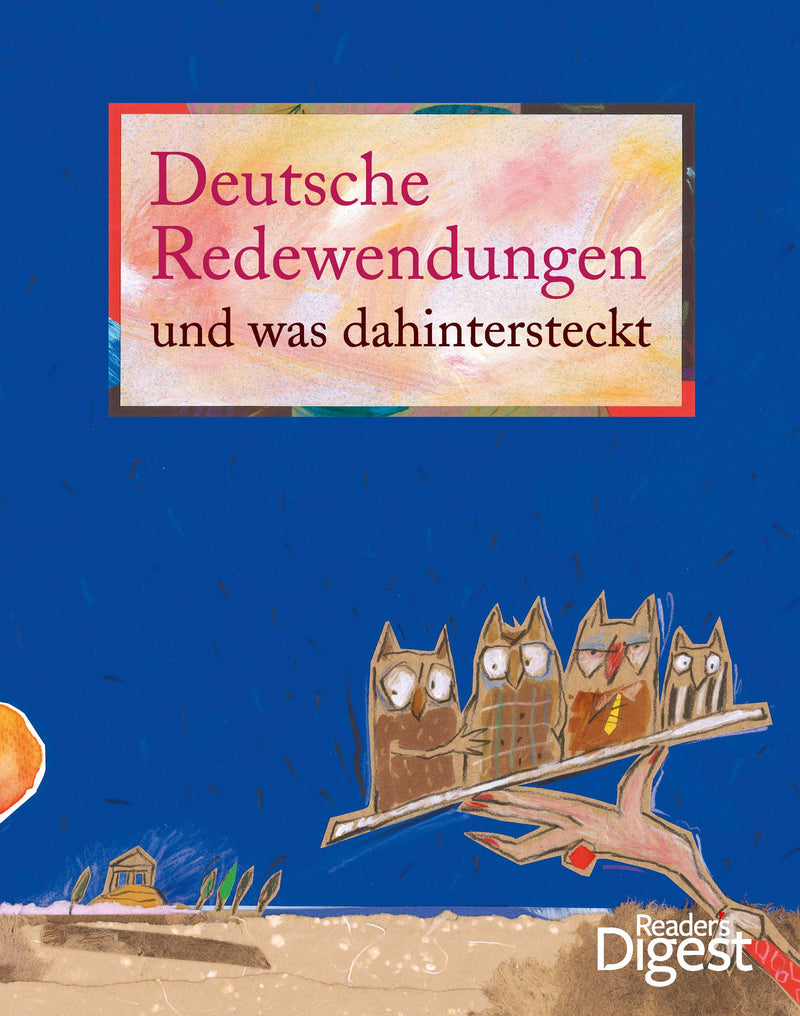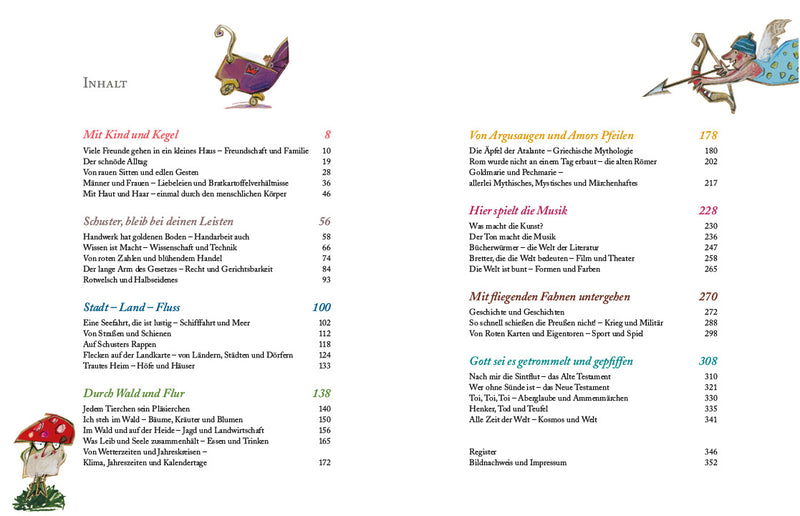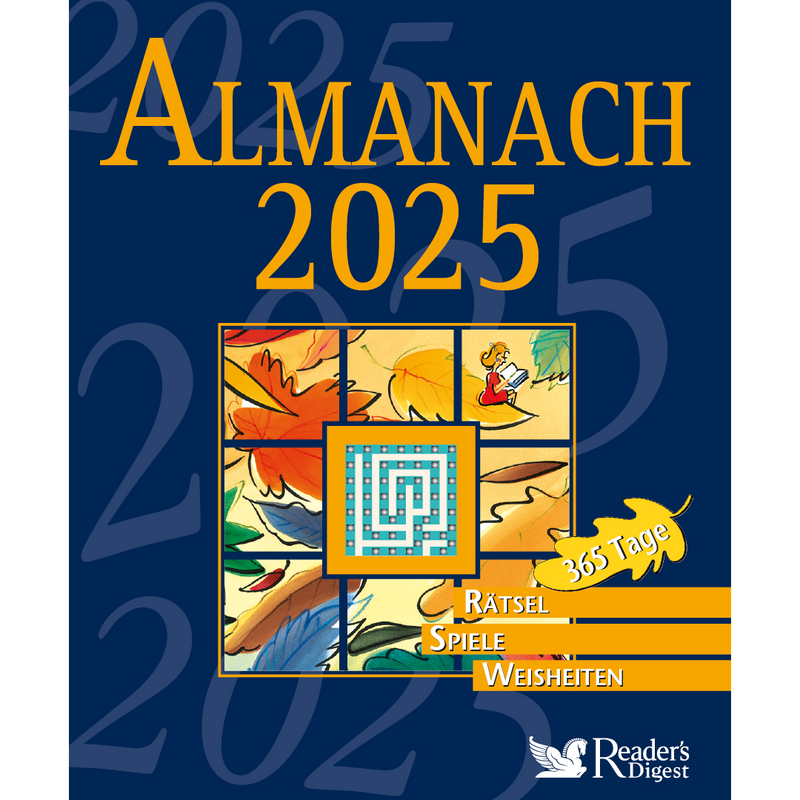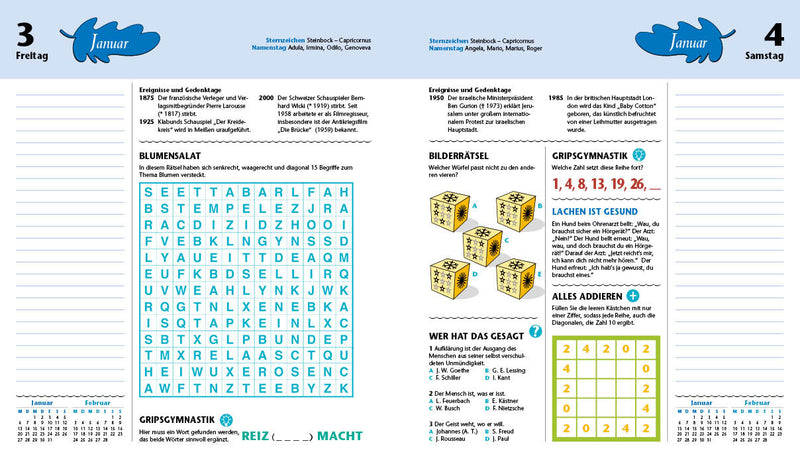Was wirklich hinter Star Trek und den Simpsons steckt
Von „Star Trek“ über die Simpsons und den „Der Graf von Monte Christo“ bis "Moby Dick" – wir verraten, was die Schöpfer von spannenden Geschichten und Erzählungen wirklich inspirierte.

©
Diesen Artikel gibt es auch als Audio-Datei 
Star Trek, 1966-1969 (Raumschiff Enterprise)
Die USS Enterprise war nicht das erste Schiff, das sich auf eine mehrjährige Mission begab, um Welten zu erforschen, „die nie ein Mensch zuvor gesehen hat“. Die Reise des Raumschiffs und ihres Kapitäns James Kirk ähnelt den Abenteuern von Kapitän James Cook, dem britischen Entdecker im
18. Jahrhundert. Sowohl Kirk als auch Cook wuchsen auf Bauernhöfen auf und zogen aus, um entlegene Regionen zu entdecken: Kirk im Weltraum an Bord der Enterprise und Cook im Pazifik an Bord der Endeavour.
Parallelen gab es ebenfalls bei ihren Begleitern – dem Enterprise-Offizier Spock und Joseph Banks, der als Wissenschaftler an Cooks Reisen teilnahm. Auch andere Details der US-amerikanischen TV-Serie Star Trek (Raumschiff Enterprise) und der Filme weisen Ähnlichkeiten zu Cooks Reisen auf. Laut dem US-amerikanischen Marinehistoriker D. K. Abbass wird bei Star Trek eine gewisse Inspiration durch Cooks Begegnung mit den Ureinwohnern Neuseelands sichtbar. „Cook traf die Maoris“, sagt Abbass, „und Kirk traf die Klingonen.“
John E. Fahey, ebenfalls Historiker, schreibt, dass die in der TV-Serie gezeigten Abenteuer „an das Goldene Zeitalter der Segelschifffahrt und die Entdeckungsreisen um die Jahrhundertwende erinnern“. Diese Unternehmungen blieben jeweils nicht ohne Folgen. Und die Historikerin Alice L. George weist darauf hin, dass Kirk sowohl als „tugendhafter Entdecker als auch unerwünschter Eindringling“ gilt, da die Zuschauer durch die Nennung der „Obersten Direktive“ der Sternenflotte oft daran erinnert werden, dass man sich nicht in die Entwicklung anderer Kulturen einmischen soll. Cook hatte wohl keine Direktive erhalten, denn er wurde bei einem Streit mit Eingeborenen auf Hawaii getötet.
Dog Day Afternoon (Hundstage), 1975
Am 22. August 1972 versuchte John Wojtowicz zusammen mit zwei Komplizen, eine Filiale der Chase Manhattan Bank in New York auszurauben. Der Überfall entwickelte sich zu einer Geiselnahme, bei der alles schiefging. Nicht nur, dass weniger Bargeld in der Bank war, als Wojtowicz erwartet hatte. Als die Klimaanlage im Gebäude ausfiel, schoss er sich beim erfolglosen Versuch, sie wieder in Gang zu bringen, fast in den Fuß.
Der Bankräuber trat öfter hinaus, um mit der Polizei zu verhandeln, und unterhielt sich auch mehrfach mit Reportern. Auf die Frage, warum er die Bank überfallen habe, sagte er, er wolle mit dem Geld seiner Partnerin eine geschlechtsangleichende Operation ermöglichen. Als die Polizei Pizza für die Geiseln lieferte, bestand Wojtowicz darauf, sie zu bezahlen, und warf ein Bündel Bargeld auf die Straße. Das ungewöhnliche Verhalten der Bankräuber sprach sich herum und eine Menschenmenge versammelte sich vor dem Gebäude.
Selbst die Geiseln konnten dem Ganzen etwas Positives abgewinnen. „Wir haben geweint, gelacht und gescherzt“, sagte eine später. Wie im Film endete die 14-stündige Belagerung erst, als den Räubern ein Flug ins Ausland versprochen wurde. Ein FBI-Agent fuhr sie und ihre Geiseln in einem Kleinbus zum Flughafen. Doch bei der Ankunft dort wurde einer der Bankräuber erschossen und Wojtowicz verhaftet. Die Geiseln kamen unversehrt frei.
The Simpsons, seit 1987
Die in den USA am längsten laufende TV-Serie ist vielleicht das, was einem nationalen Epos am nächsten kommt. Die Familie Simpson und ihre Nachbarn sind vielen US-Amerikanern sehr sympathisch, auch wenn die Comicfiguren manchmal – nun ja – sehr überzeichnet wirken.
Die Serie spielt in einem Ort namens Springfield. Während oft gerätselt wird, in welchem US-Bundesstaat er liegen könnte, gibt es zahlreiche Parallelen zur Heimatstadt und zur Familie des Comiczeichners Matt Groening: Portland in Oregon. Auch er wuchs in einer Straße namens Evergreen Terrace auf, und seine Eltern hießen Homer und Marge, seine Schwestern Lisa und Maggie. Und Bart – ein Anagramm für brat (Flegel) – dürfte Matt nach sich selbst gezeichnet haben.
In Portland gibt es zahlreiche Orte, die als Inspiration für die Namen von Figuren dienten: Northwest Quimby Street (Bürgermeister Quimby), North-west Lovejoy Street (Reverend Lovejoy), Montgomery Park (Montgomery Burns), North Van Houten Avenue (Milhouse Van Houten, Barts bester Freund), Northwest Flanders Street (Ned Flanders, der Nachbar der Simpsons).
Obwohl Groening darauf besteht, dass seine echte Familie nicht so streitlustig ist wie die Zeichentrickbrut, versteht er die große Anziehungskraft der Serie. „Es ist eine universelle Eigenschaft der Menschen, sich unverstanden zu fühlen“, sagte er in einem Interview mit der Zeitschrift Radio Times, „und eine der Botschaften der Simpsons ist: ‚Du bist nicht allein‘. Andere sind genauso verkorkst wie du, also lach darüber.“
Rocky, 1976
Am 24. März 1975 stieg der weitgehend unbekannte Boxer Chuck Wepner aus New Jersey, USA, gegen den Schwergewichtschampion Muhammad Ali in den Ring. Ali hatte gerade George Foreman in einem legendären Kampf (bekannt als „Rumble in the Jungle“) besiegt, der in Zaire stattfand und weltweit Aufmerksamkeit erregte.
Wepner war älter als Ali und trug den Spitznamen „Bayonne Bleeder“ (der Blutende aus Bayonne) – er hatte nämlich die Angewohnheit, seine Verteidigung zu vernachlässigen, während er schwerfällig auf seine Gegner losging. Viele hielten Wepner deshalb für eine Witzfigur. Aber er betrat den Ring, um ein Zeichen zu setzen. „Auch wenn ich nicht gewinne“, sagte er seiner Frau vor dem Kampf, „will ich beweisen, dass ich dort hingehöre.“
Was folgte, war einer der überraschendsten Boxkämpfe der Geschichte. Über 15 Runden tauschten die beiden Männer Schläge aus. Wepner verlor den Kampf letztlich durch technischen K.O., aber er verdiente sich einen Platz in der Boxgeschichte, weil er Ali in der neunten Runde auf die Bretter schickte. Es war erst das vierte Mal, dass der Champion in einem Kampf zu Boden gehen musste.
Der Zweikampf faszinierte viele Zuschauer, darunter auch einen jungen Schauspieler namens Sylvester Stallone. „In dieser Nacht ging ich nach Hause und hatte die Idee zu meiner Figur“, schrieb Stallone später. „Rocky Balboa, ein Mann von der Straße, eine Art wandelndes Klischee. Ein Mann voll Patriotismus.“
Stallone schrieb sein Drehbuch in dreieinhalb Tagen und setzte sich unermüdlich dafür ein, selbst die Hauptrolle spielen zu dürfen. Wie Chuck Wepner überwand der Film viele Widerstände – aber er gewann sogar! Insgesamt erhielt Rocky drei Oscars, darunter den für den besten Film, und setzte sich gegen „Schwergewichte“ der Filmgeschichte wie All the President’s Men (Die Unbestechlichen) und Taxi Driver durch.
A Nightmare on Elm Street, 1984
Die Filmfigur Freddy Krueger, der Serienmörder mit Hut, der Teenager in ihren Träumen tötet – was sie wiederum in der Realität das Leben kostet –, basiert auf zwei Personen, die den US-amerikanischen Regisseur Wes Craven in seiner Jugend heimsuchten. Der eine war ein Schulhof-Rüpel, der den zukünftigen Filmemacher oft verprügelte. Der andere war ein Fremder mit einem Filzhut, der vor dem Fenster des Jungen lauerte, bis Wes’ älterer Bruder den Mann verjagte.
Es ist schon schlimm genug, wenn man in seinem Leben zwei solche Fieslinge kennenlernt, aber Craven ließ es nicht dabei bewenden, wenn es darum ging, sich von Horrorgeschichten aus dem wirklichen Leben inspirieren zu lassen. In dem 2006 erschienenen Dokumentarfilm Never Sleep Again: The Making of A Nightmare on Elm Street (etwa: Nie wieder schlafen – wie A Nightmare on Elm Street entstand) verriet Craven, dass die Handlung seines Films auf Zeitungsartikeln basierte, die Anfang der 1970er-Jahre in der Los Angeles Times erschienen. Darin wurde über eine „mysteriöse tödliche Krankheit“ berichtet, an der Dutzende junger Menschen starben. Die Opfer waren Flüchtlinge aus Südostasien und starben nachts „unter Qualen“, offenbar während sie Albträume hatten. Die seltsame Krankheit verblüffte die Forscher und brachte Craven zu der Erkenntnis: „Darüber muss ich einen Film machen.“
Moby Dick, 1851
Herman Melvilles Roman Moby Dick bietet viel Dramatik und enthält eine Figur, deren Name heute eine globale Cafékette ziert: Starbuck’s – denn der Erste Maat an Bord der Pequod heißt Mr. Starbuck.
Der titelgebende weiße Wal im später verfilmten Roman basiert nicht auf einem, sondern auf zwei Tieren, die tatsächlich gelebt haben. Der erste war ein Albino-Pottwal, der im frühen 19. Jahrhundert vor der Küste Chiles mit mehr als 100 Schiffen zusammenstieß.
Laut dem Smithsonian Magazine war dieser riesige Wal, der den Spitznamen „Mocha Dick“ bekam, die Inspiration für Melville. 1839 wurde ein Bericht veröffentlicht, in dem beschrieben wurde, dass das Tier mit „nicht weniger als 20 Harpunen bedeckt war ... die verrosteten Andenken an viele verzweifelte Begegnungen“.
Eine weitere Inspiration für den Roman war der Untergang des Walfangschiffs Essex im Jahr 1820. Nachdem sie einige Schäden an ihrem Schiff repariert hatte, bemerkte die Besatzung einen ungewöhnlich großen Pottwal, der ihr Schiff umkreiste. Laut dem Ersten Offizier Owen Chase war die Kreatur „in den Schaum des Meeres gehüllt, den sein ständiges und heftiges Treiben im Wasser um ihn herum erzeugt hatte, und ich konnte deutlich sehen, wie er seine Kiefer zusammenschlug, als wäre er vor Wut außer sich“. Der riesige Wal rammte die Essex zweimal. Das Schiff sank, und die Besatzungsmitglieder waren gezwungen, etwa 2000 Meilen westlich von Südamerika in Rettungsboote zu steigen.
Nur acht der 20-köpfigen Besatzung des Schiffes überlebten die folgenden Ereignisse. Die Männer ertrugen drei Monate lang Hunger, Krankheit und sollen – als ihnen das Essen ausging – sogar Kannibalismus begangen haben.
Dieses Grauen hat Melville so stark beeinflusst, dass die Figur Ishmael, der Ich-Erzähler des Romans, in Kapitel 45 von Moby Dick behauptet, er habe
den Ersten Maat der Essex persönlich gekannt.
Der Graf von Monte Christo, 1844
Der Roman von Alexandre Dumas ist ein mitreißendes Epos über einen jungen Mann namens Edmond Dantès, der von eifersüchtigen Rivalen verraten und am Tag vor seiner Hochzeit ins Gefängnis gesteckt wird. Dort erfährt Dantès von einem Schatz, der auf der italienischen Insel Monte Cristo versteckt sei. Nach seiner Flucht findet er den Schatz und legt sich mehrere neue Identitäten zu, die nur einem Zweck dienen: Rache zu nehmen.
Der Graf von Monte Cristo ist eine packende Geschichte über Verwandlung und Ungerechtigkeit. Sie basiert auch darauf, was Alexandres Vater Thomas-Alexandre Dumas unter Napoleon Bonaparte erlebte. Laut der Biografie Der schwarze Graf diente dieser als General während der französischen Revolutionskriege in Europa und später in Ägypten. Obwohl er auf Haiti in die Sklaverei hineingeboren worden war, erhielt Thomas-Alexandre eine Ausbildung in Paris. Er trat der Légion Saint-Georges bei, wo er bald zum zweiten Kommandanten aufstieg. Im Alter von nur 31 Jahren wurde er zum General ernannt, weil er „Triumphe feierte, die viele für unmöglich hielten“.
Allerdings machte sich Thomas-Alexandre Dumas bald einen mächtigen Feind in Napoleon. „Alex war attraktiver und charismatischer, und er war der Idee der Republik wirklich zugetan“, heißt es in einer Dokumentation, die der TV-Sender Vox ausstrahlte. Nachdem die beiden Männer 1798 wegen Napoleons erfolglosem Feldzug in Ägypten aneinandergeraten waren, beschloss der zukünftige Kaiser, drastische Maßnahmen zu ergreifen. General Dumas war in Neapel in Kriegsgefangenschaft geraten. Anstatt über die Freilassung eines wertvollen Mitglieds seines Militärstabs zu verhandeln, ließ Napoleon Bonaparte ihn dort darben. Der Verrat setzte Thomas-Alexandre gesundheitlich schwer zu, fünf Jahre nach der Entlassung aus der Gefangenschaft starb er. Sein Sohn Alexandre wuchs mit den Erinnerungen seiner Mutter an den heldenhaften und verratenen Vater auf. Das Buch und vor allem sein Erfolg waren die verdiente Rache der Familie Dumas.