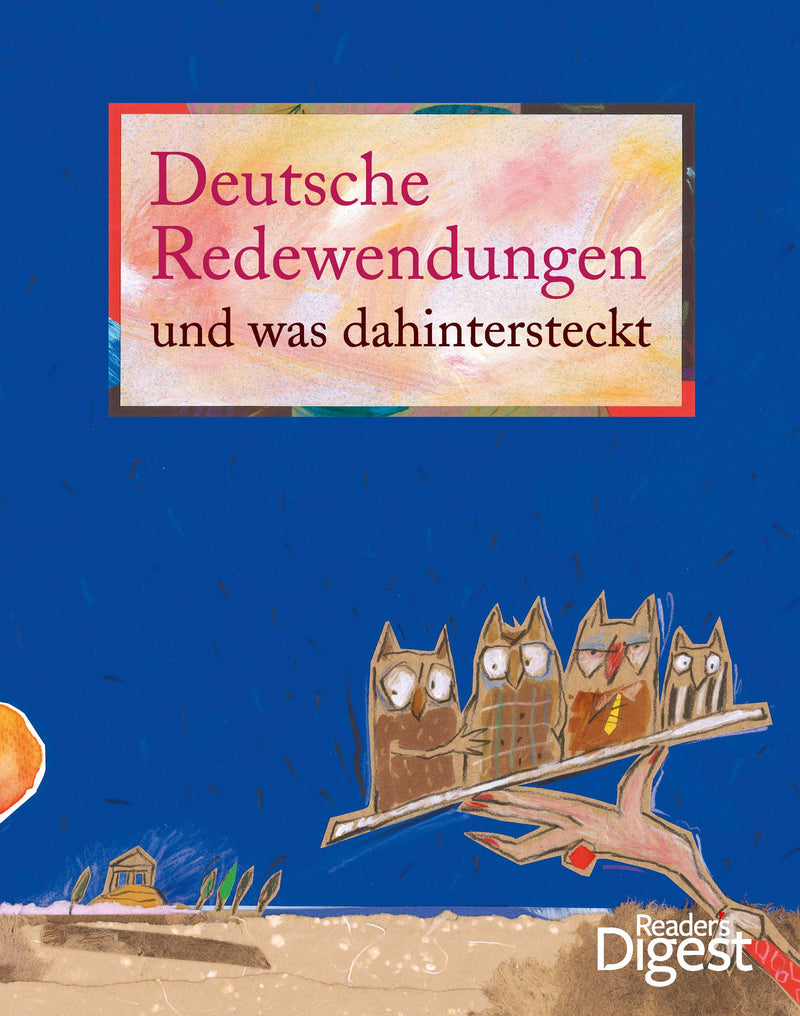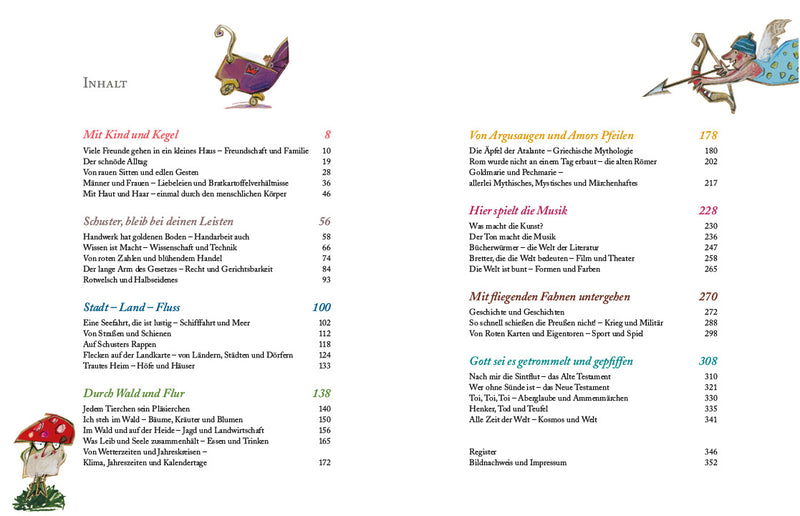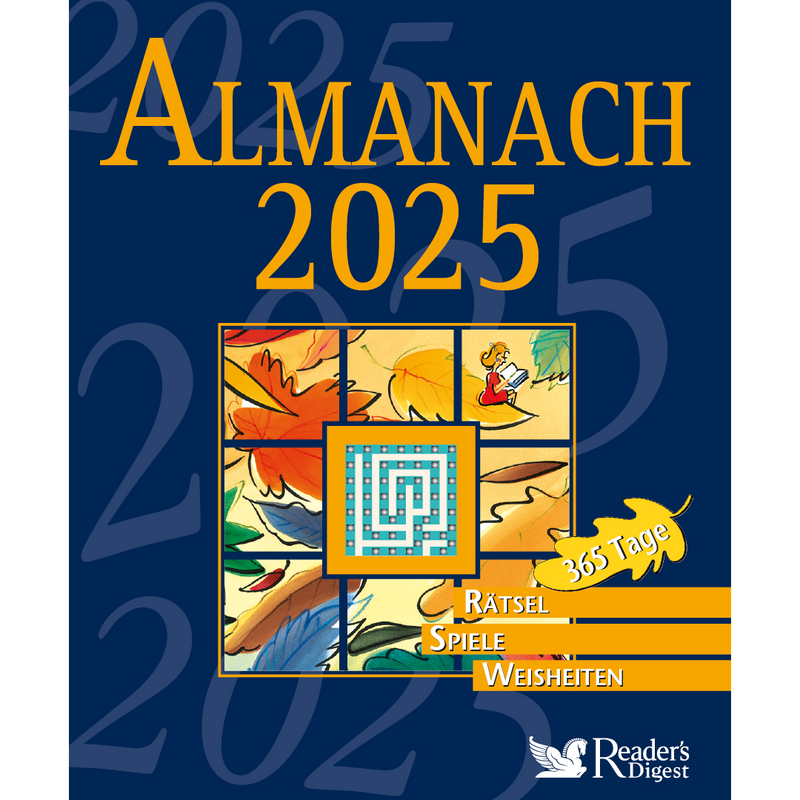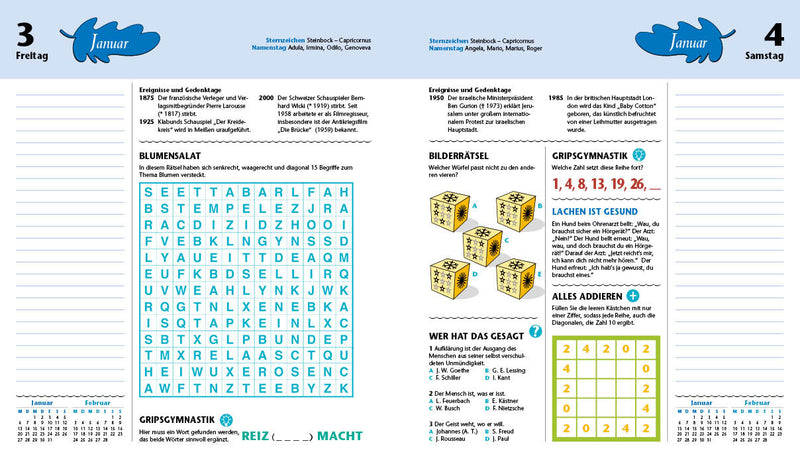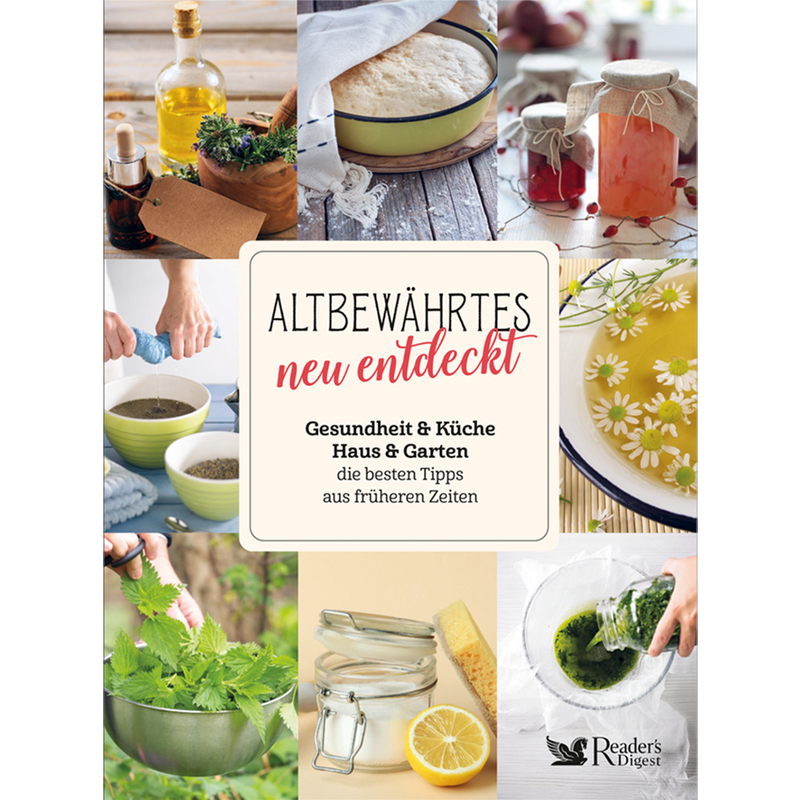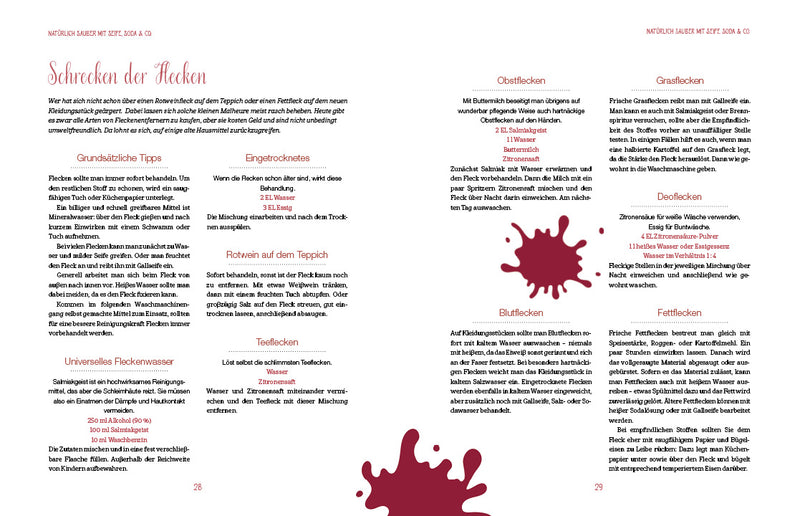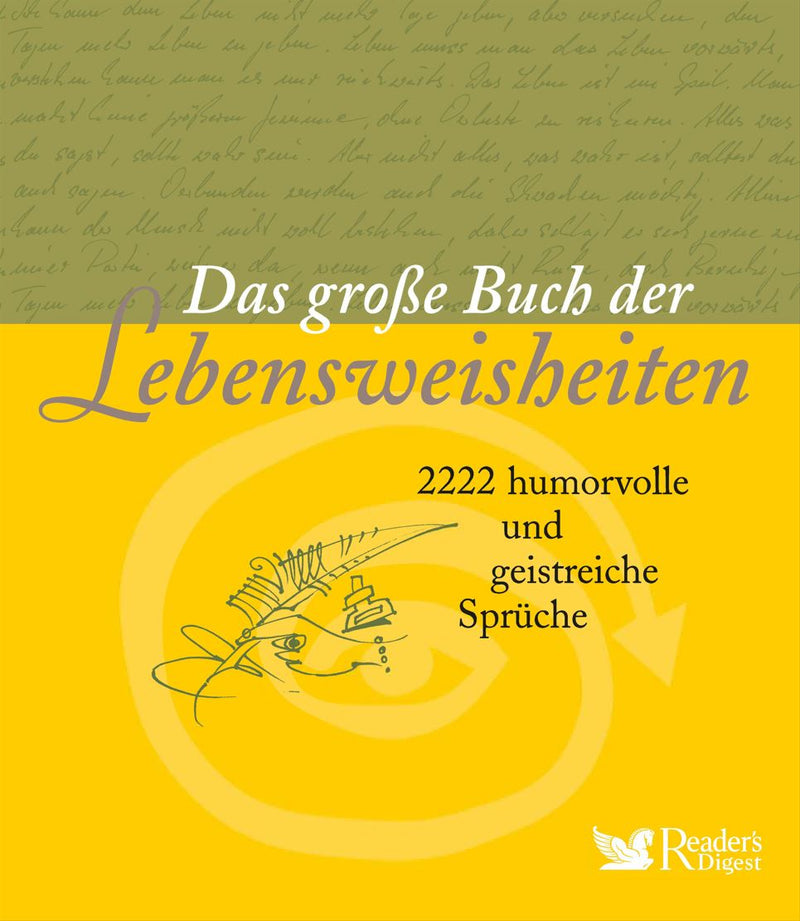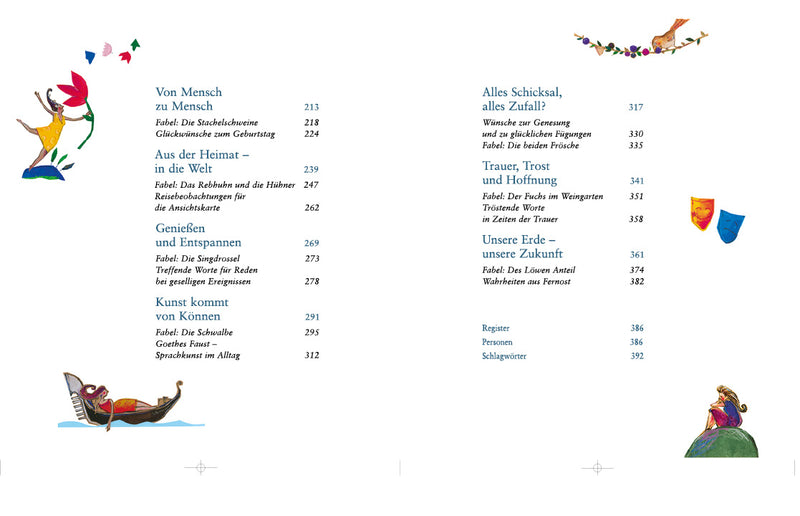Weshalb gibt es eine Energiewende?
Bereits vor dem Ende des 20. Jh. warnten Naturwissenschaftler vor einem von der modernen Zivilisation ausgelösten Klimawandel. Weil das beim Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas frei werdende Kohlendioxid vermehrt Sonnenstrahlung auf der Erde hält, die früher in den Weltraum zurückgeworfen wurde, steigen fast überall auf dem Globus die Temperaturen.

©
Wie funktioniert die Energiewende?
Die Umstellung von fossilen auf nachhaltige Energien gewann erst ab den 2000er-Jahren und besonders stark ab dem Ende der 2010er-Jahre an Fahrt: Damals erlebten viele Menschen in mehreren Weltregionen einschließlich Mitteleuropa erstmals unmittelbar die verheerenden Folgen des Klimawandels mit sehr vielen Toten und riesigen Sachschäden durch häufiger auftretende Hitzewellen, Dürren, Extremniederschläge und Stürme. Naturwissenschaftler wissen, dass die Folgen des Klimawandels spätestens bei einem durchschnittlichen weltweiten Temperaturanstieg von 2 °C unbeherrschbar werden können. Da bereits in den 2010er-Jahren weltweit schwere Schäden durch den Klimawandel auftraten, obwohl die Temperaturen nur 1 °C über den Werten vor der Industrialisierung lagen, sollte der Temperaturanstieg seither möglichst auf 1,5 °C begrenzt werden. Dazu müssen aber weltweit die mit Kohle, Erdöl oder Erdgas befeuerten Kraftwerke durch nachhaltige Kraftwerke ersetzt werden, die im Idealfall gar kein Kohlendioxid mehr freisetzen – und das so schnell wie möglich. Ähnlich müssen alle von fossilen Brennstoffen angetriebenen Verkehrsmittel und Herstellungsprozesse in der Industrie möglichst rasch nachhaltigen Alternativen weichen. Dieser Prozess dürfte sich bis weit in die 2040er-Jahre hinziehen, erfordert gewaltige Anstrengungen und kann nur klappen, wenn zugleich der Energieverbrauch sinkt, wo immer das durchführbar und sinnvoll ist.
Seit wann wir Windenergie an Land genutzt?
Windenergie nutzten bereits die Perser im 9. Jh. n. Chr., um damit Getreide zu mahlen oder Wasser zu schöpfen. Damals waren die Flügel dieser Windmühlen allerdings noch mit Segeltuch bespannt. Während dabei die Rotationsenergie auf ein Mahl- oder Schöpfwerk übertragen wurde, treibt sie in heutigen Windkraftanlagen einen Generator zur Stromerzeugung an.
Weshalb werden Windkraftanlagen immer größer?
Hatten Windkraftanlagen in Deutschland 1990 noch eine Nennleistung von wenig mehr als 0,1 MW, lag sie 2021 durchschnittlich bereits bei 4 MW – Offshore-Anlagen erreichen sogar bis zu 15 MW. Möglich wurde diese Steigerung vor allem durch immer größere Rotordurchmesser, die 2021 in Deutschland bei durchschnittlich 133 m lagen. Die Nabe einer solchen Anlage befindet sich 140 m über dem Boden, was ihre Gesamthöhe auf über 200 m bringt. Dieses Größenwachstum wird von einem schlichten Zusammenhang angetrieben: Je mehr Fläche die Rotoren dem Wind bieten, umso mehr Energie können sie nutzen und umso preiswerter wird der gewonnene Strom. Und während früher einzelne Windkraftanlagen auf die Felder oder an die Küste gebaut wurden, errichtet man längst erheblich preiswertere große Windparks mit etlichen Einzelanlagen. Dabei gewinnen Offshore-Anlagen weit vor den Küsten zunehmend an Bedeutung, weil sie dort Mensch und Natur deutlich weniger stören als an Land. Was sind Vertikalrotoren? Die persischen Windkraftanlagen im 9. Jh. funktionierten nach einem anderen Prinzip als die meisten Windräder von heute. Allerdings wird dieses Prinzip – die Energiegewinnung mit Vertikalrotoren – seit Anfang der 2020er-Jahre vom Schweizer Unternehmen Agile Wind Power AG wieder aufgegriffen. Bei diesen Rotoren ist eine Nabe senkrecht auf einem Gittermast 78 m über dem Erdboden montiert. Von ihr ragen drei Speichen waagrecht nach außen, an deren Enden jeweils ein 54 m hohes Rotorblatt so montiert ist, dass deren eine, mit rot-weißer Warnfarbe gekennzeichnete Hälfte senkrecht in den Himmel hinaufzeigt. Da Elektromotoren die Rotoren kontinuierlich optimal in den Wind stellen, können sie langsamer laufen und sind daher erheblich leiser als herkömmliche Anlagen. Zudem sind die Anlagen kleiner und werfen weniger Schatten. Dank dieser Eigenschaften können Vertikalrotoren näher an Siedlungen errichtet werden. Allerdings haben sie auch einen deutlich geringeren Wirkungsgrad und eignen sich daher vor allem für Standorte, an denen herkömmliche Horizontalanlagen nicht genehmigt werden oder nicht erwünscht sind.
Wie funktioniert eine Solarzelle?
Neben der Windenergie ist die Fotovoltaik das zweite wichtige Standbein der nachhaltigen Energieversorgung in Mitteleuropa. In einer Solarzelle hebt das Sonnenlicht Elektronen aus den Atomen der Zelle heraus. Das elektrisch negativ geladene Elektron und der positiv geladene Rest des Atoms können sich dann innerhalb der Kristalle in der Zelle unabhängig voneinander bewegen. Das ist im Prinzip bereits ein Stromfluss, der nur noch aus der Zelle herausbefördert werden muss, um als Elektrizität z. B. eine Energiesparlampe zum Leuchten anzuregen oder einen Computer zu betreiben.
Wie wichtig ist Wasserkraft?
Mit nur 18,4 Mrd. kWh steuerte Wasserkraft im Jahr 2020 gerade einmal 3,8 % zum deutschen Strommix bei. In Zukunft dürfte die Bedeutung der Wasserkraft in Mitteleuropa auch kaum zunehmen, weil ihr Potenzial bereits weitgehend ausgeschöpft ist. Experten gehen eher von einem Rückgang aus, weil Staudämme Flüsse und Bäche in Seen verwandeln und so den Lebensraum der Arten zerstören, die in solchen fließenden Gewässern leben. Um Fische, Muscheln und wandernde Arten wie Lachse und Aale wieder in mitteleuropäische Gewässer zurückzuholen, sollen Flüsse und Bäche daher in der Europäischen Union renaturiert werden. Dazu müssten auch Staudämme rückgebaut werden, was z. B. in Frankreich bereits geschehen ist.
Wozu braucht man Pumpspeicherkraftwerke?
Sehr wichtig sind dagegen die Pumpspeicherkraftwerke, die Schwankungen beim Stromverbrauch ausgleichen: Schalten beispielsweise morgens sehr viele Menschen vor der Arbeit gleichzeitig Kaffeemaschine, Toaster und Haarföhn an, können diese Wasserkraftwerke in solchen Spitzenzeiten rasch die zusätzlich benötigte Elektrizität liefern. Produzieren Fotovoltaik- und Windkraftanlagen dann in der Mittagszeit mehr Strom, als gerade benötigt wird, treibt dieser Überschuss Pumpen an, die Wasser zurück in ein hoch gelegenes Speicherbecken befördern. Kochen die Menschen später ihr Abendessen auf Elektroherden und schalten Fernseher sowie andere Geräte an, steigt der Stromverbrauch erneut deutlich an. Jetzt fließt im Pumpspeicherkraftwerk das Wasser wieder nach unten, erzeugt dabei Elektrizität und stopft so die Stromlücke, bevor sie überhaupt entstehen kann. In der Nacht wird dann wieder viel weniger Strom verbraucht, während Windkraftanlagen weiterlaufen und der Überschuss auch nun genutzt wird, um Wasser in das hoch gelegene Speicherbecken zu pumpen. Brauchen wir große Batteriespeicher? Zusammen mit Pumpspeicherkraftwerken, deren Kapazität in Mitteleuropa kaum vergrößert werden kann, können Batteriespeicher Schwankungen im Elektrizitätsnetz ausgleichen. Bis 2030 sollten dafür Batterien mit einer Kapazität von rund 80 Mio kWh Energie bereitstehen, die blitzschnell Strom ins Netz speisen oder von dort aufnehmen können. Wie funktionieren dezentrale Stromspeicher? Die Batterien von Großabnehmern wie der kräftig wachsenden Flotte von Elektroautos können beispielsweise vor allem an Wochenenden geladen werden, an denen normalerweise weniger Strom verbraucht wird. Da Windkraft und Fotovoltaik aber auch dann ihre übliche Strommengen liefern, lassen sich so Speicherkapazitäten zu denen von stationären Batterien und Pumpspeicherkraftwerken hinzufügen. Umgekehrt können Elektroautos in Spitzenzeiten des Stromverbrauchs zusätzlichen Strom ins Netz liefern. Natürlich verhindert in diesem Fall eine Automatik das Unterschreiten eines minimalen Ladezustands, der beispielsweise eine Reichweite von 50 oder 100 km garantiert. Zudem werden die Autobesitzer für den gelieferten Strom gut bezahlt oder bekommen ihren Ladestrom zum Dauer-Schnäppchenpreis.
Wozu brauchen wir Geothermiekraftwerke?
Geothermiekraftwerke nutzen die im Untergrund meist in einigen Hundert bis wenigen Tausend Metern Tiefe vorhandene Wärme und können so gleichmäßig Strom und Wärme zum Heizen liefern. Damit eignet sich diese Energiequelle als Ersatz für die auslaufenden Kohleund Kernkraftwerke und könnte daher einen weiteren Beitrag zum Strommix der Zukunft leisten. Allerdings können Geothermiekraftwerke Erdbeben und massive Hebungen und Senkungen auslösen. Solche Risiken lassen sich durch sorgfältige Analyse des Untergrunds und Planung minimieren. Könnte Geothermie die Energiewende zusätzlich vorantreiben? Im Oberrheingraben im Südwesten Deutschlands sind in dem warmen Wasser, das tief im Untergrund zu finden ist, jede Menge Salze und vor allem Lithium gelöst. Da sich diese Region hierzulande besonders gut für Geothermiekraftwerke eignet, könnten aus dem für diese Anlagen benötigten Tiefenwasser neben Energie auch noch jedes Jahr mehrere Tausend Tonnen Lithium gewonnen werden. Ein Verfahren dazu hat ein Team des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) bereits entwickelt. Benötigt wird das so gewonnene Lithium für die Herstellung von Batterien, die Elektroautos antreiben oder überschüssigen Sonnen- und Windstrom für Spitzenverbrauchszeiten speichern. Bisher importiert die Europäische Union das dafür benötigte Lithium aus den südamerikanischen Anden und aus Australien. Geothermiekraftwerke im Oberrheingraben könnten also die Energiewende gleich doppelt antreiben.
Wie funktioniert eine Wärmepumpenheizung?
Eine Wärmepumpenheizung entzieht der Umgebung Wärme, die dann von einer Wärmepumpe auf ein höheres Temperaturniveau gehoben wird. Da so normalerweise eher niedrige Heiztemperaturen erreicht werden, kombiniert man das System mit einer Flächenheizung, die den Fußboden, die Decke oder die Wände heizt und so mit geringeren Temperaturen auskommt. Wärmepumpen sind besonders effektiv, wenn die Ausgangstemperatur möglichst hoch ist. Am besten geeignet ist also eine Wärmepumpe, die das meist um 8 °C warme Grundwasser nutzt, während eine Luftwärmepumpe, die die Außenluft zur Energiegewinnung einsetzt, in der Bilanz deutlich schlechter abschneidet. Zudem können die Laufgeräusche einer Luftwärmepumpe störend sein. Hinzu kommt außerdem noch, dass zwar die Anschaffungskosten einer Luftwärmepumpe deutlich niedriger sind, aber der laufende Betrieb teurer ist als der einer Erdwärmeheizung. Weshalb sollten Gebäude mit Wärmepumpenheizung gut gegen Kälte isoliert sein? Wärmepumpen ersetzen Öl- und Gasheizungen am besten in Kombination mit einer Flächenheizung, die bei deutlich niedrigeren Temperaturen als die bis in die 2010er-Jahre vorherrschenden Heizkörper arbeitet. Solche Flächenheizungen können Räume daher nur dann gut warmhalten, wenn wenig Energie verloren geht. Deshalb müssen Wände, Fenster, Türen, Böden, Decken und Dächer vor dem Einbau einer Wärmepumpen-Flächenheizung gut isoliert werden.
Welche Rolle spielt Wasserstoff bei der Energiewende?
Entsteht aus den Elementen Wasserstoff und Sauerstoff Wasser, wird sehr viel Energie frei. Daher kann Wasserstoff als Energieträger in der Energiewende oft genau dort eingesetzt werden, wo elektrischer Strom aus Sonnen- oder Windenergie nicht hinkommt oder wo sich sein Einsatz nicht rechnet. So können beispielsweise Langstreckenflugzeuge in der Luft und Containerschiffe auf den Weltmeeren natürlich nicht durch Oberleitungen mit Strom versorgt werden und Batterien sind für solche Einsätze schlicht zu schwer. Zudem sind viele Prozesse in der chemischen Industrie auf Wasserstoff angewiesen und grüner Stahl (siehe S. 285) lässt sich am besten mit Wasserstoff herstellen. Was ist grüner Wasserstoff? Wasserstoff selbst kommt auf der Erde natürlicherweise kaum vor. Der in den 2010er-Jahren benötigte Wasserstoff wurde daher meist aus Erdgas hergestellt, wodurch große Mengen des Treibhausgases Kohlendioxid freigesetzt wurden. Wasserstoff kann aber auch in einer bereits seit 1800 bekannten Elektrolysereaktion gewonnen werden. Dabei zerlegt elektrischer Strom Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Stammt der dazu benötigte Strom aus Windkraftanlagen, Solarzellen oder anderen nachhaltigen Quellen, gilt der so erzeugte Wasserstoff als „grün“. Nach Kalkulationen der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie (IEG) in Cottbus und des Fraunhofer- Instituts für Solare Energiesysteme (ISE) in Freiburg benötigt Deutschland im Jahr 2050 etwa 250 – 800 TWh Energie aus Wasserstoff. Diese Menge entspricht ungefähr der gesamten Stromproduktion Deutschlands, die im Jahr 2019 bei etwas mehr als 600 TWh lag. Da Windkraftanlagen und Solarzellen in Deutschland diese zusätzlichen Strommengen kaum werden liefern können, ist Deutschland wohl auch in Zukunft auf Energieimporte angewiesen. Woher könnte Mitteleuropa grünen Wasserstoff beziehen? Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) erforscht seit 2017 im Süden Spaniens eine neuartige Methode für die Wasserstoffproduktion. Dort bündeln 200 jeweils 6 m lange und ebenso hohe Spiegel das Sonnenlicht auf einen Reaktor, der in der Kuppel eines Turms sitzt. Eingeleiteter Wasserdampf wird dort bei Temperaturen von 800 – 1000 °C an einer Keramik aus Nickel-Ferrit oder Ceroxid in Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt. Ist die Entwicklung derartiger Reaktoren abgeschlossen, können sie in sonnenreichen Gegenden wie im Süden Spaniens, in Nordafrika oder auf der Arabischen Halbinsel Wasserstoff produzieren, der anschließend über Pipelines in andere Länder geleitet werden kann. Solche Wasserstoffpipelines sind erheblich preiswerter und umweltverträglicher als verflüssigter Wasserstoff, der in Spezialschiffen transportiert wird. Aus diesen Regionen könnte natürlich auch Wasserstoff importiert werden, der aus Wasser mithilfe von sogenannten Elektrolyseuren erzeugt wird, die mit Sonnen- oder Windstrom betrieben werden. Wozu benötigen wir grünen Wasserstoff? Wasserstoff wird äußerst vielfältig eingesetzt, z. B. zur nachhaltigen Produktion von Stahl, bei vielen Prozessen in der chemischen Industrie, aber auch bei der Produktion von Düngemitteln. Hinzu kommen der Flug-, der internationale Schiffs- sowie der Lkw-Fernverkehr. Und wenn diese Transportvehikel für große Strecken mit synthetischen Treibstoffen nachhaltig betrieben werden sollen, stellt man diese am besten mithilfe von Wasserstoff her. Wasserstoff lässt sich direkt zur Stromproduktion in Gaskraftwerken oder Brennstoffzellen einsetzen. Da sich einmal hergestellter Wasserstoff gut speichern lässt, kann man ihn auch zu Zeiten verstromen, in denen das Angebot aus Solar- und Windkraftwerken nicht ausreicht – somit dient Wasserstoff auch als Speicher für elektrischen Strom. Und da beim Verstromen von Wasserstoff nur das Wasser wieder entsteht, aus dem der Energieträger einst gewonnen wurde, produzieren mit grünem Wasserstoff betriebene Gaskraftwerke ihren Strom komplett nachhaltig. Fahren im Jahr 2050 Autos nur noch mit Wasserstoff? Für den Antrieb von Autos und kleinen Nutzfahrzeugen oder zur Heizung von Ein- oder Zweifamilienhäusern wird grüner Wasserstoff in der Energiewende wohl kaum eingesetzt werden: Direkte Antriebe mit Elektromotoren und Speicherbatterien oder eine mit grünem Strom betriebene Wärmepumpe sind für solche Zwecke nämlich einfach günstiger.