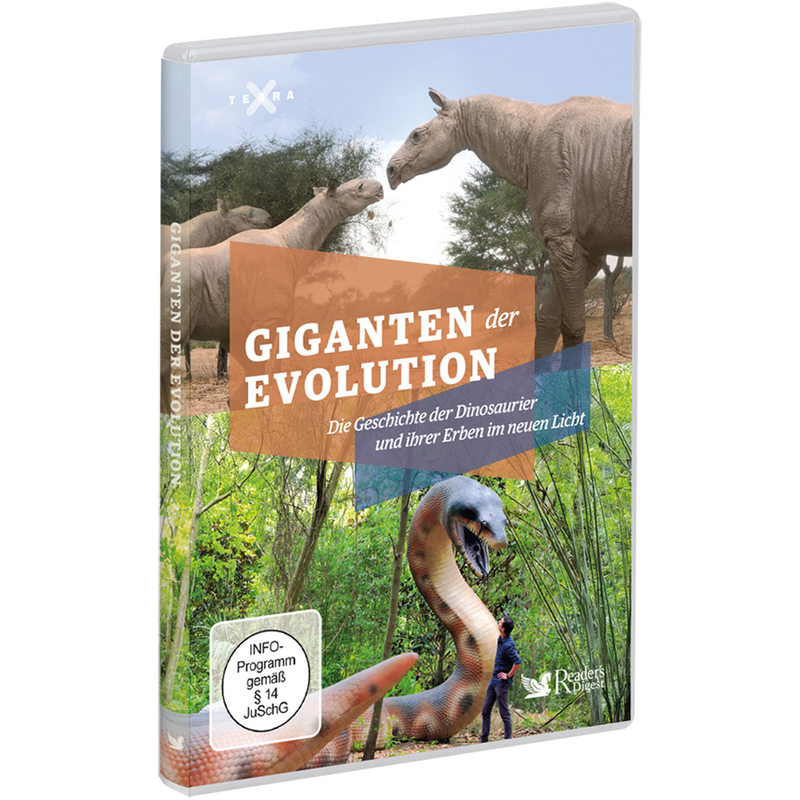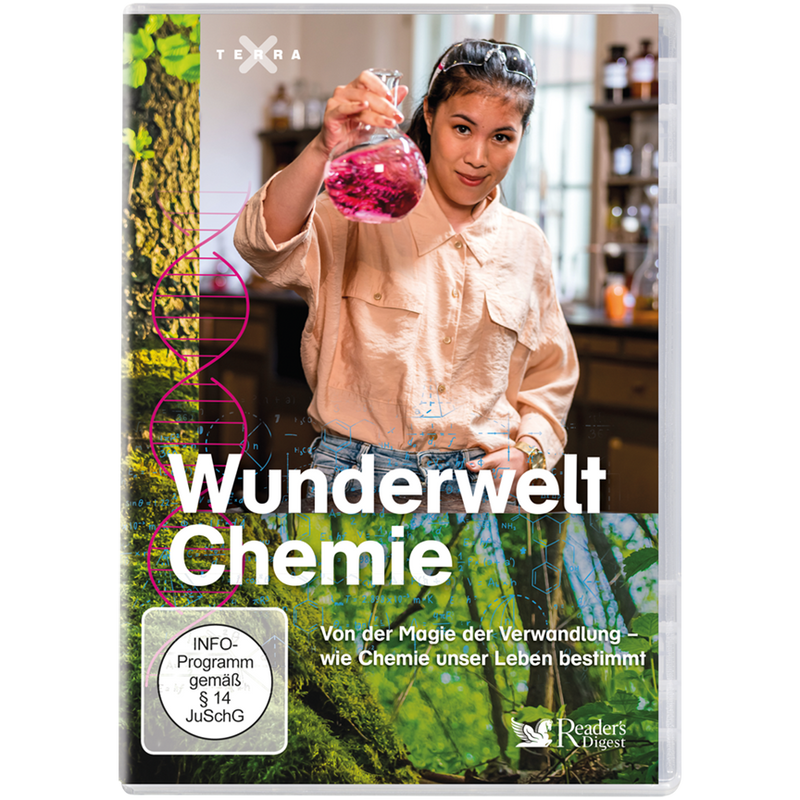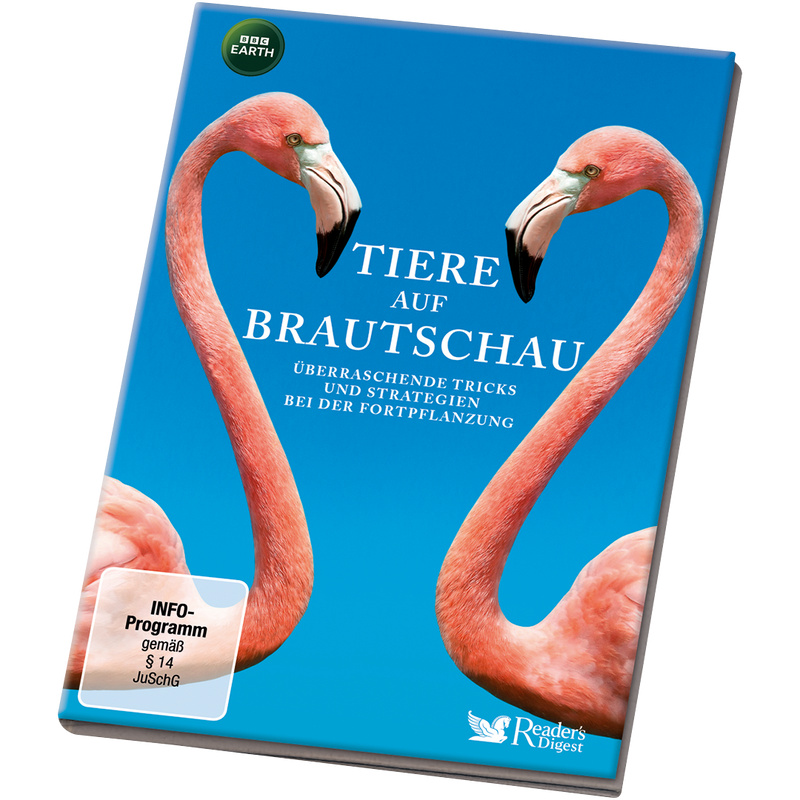Wilde Freunde
Erstaunliche Geschichten über die Beziehung zwischen Mensch und Tier.

©
Diesen Artikel gibt es auch als Audio-Datei
Der gnadenlose Räuber überlegt sich’s anders
erzählt von Manfred Weindl, Salzweg bei Passau
Der Uhu war offenbar illegal aufgezogen worden, hatte die Natur nie kennengelernt und war behördlich sichergestellt worden; und weil man mich beim Landratsamt kannte – ich habe ja immer wieder Tiere gehabt, die dort meldepflichtig waren –, ist er letztendlich bei mir gelandet. Schon ausgewachsen. Er war ein Terzel. So nennt man bei Greifvögeln das Männchen, weil es eine Terz, also ein Drittel, kleiner ist als das Weibchen. Er hatte aber immer noch 1,7 Meter Spannweite.
In der Natur wird der Uhu von anderen Tieren gefürchtet, weil er ein unglaublicher Räuber ist. Er ist stark, er ist gnadenlos und vor allem: Er ist lautlos. Und wenn der Uhu mal was gepackt hat, dann ist’s vorbei. Er hat eine irrsinnige Kraft und scheut auch vor nichts zurück. Nicht einmal vor Tieren in Fuchsgröße oder vor anderen Greifvögeln. Der Uhu frisst zum Beispiel auch große Mäusebussarde. Denn wenn die in der Nacht schlafen, können sie nicht fliehen.
Deswegen, wenn irgendwelche anderen Tiere einen Eulenvogel sehen, hauptsächlich einen Uhu, drehen die vollkommen am Rad. Die machen ein Geschrei, ein Getue ...! Wegen dieser Angewohnheit anderer Tiere, Lärm zu machen, sobald ein Uhu in der Nähe ist, habe ich, wenn der Uhu mir mal ausgekommen war, eigentlich immer sagen können, wo er gerade ist. Einmal war er zwei Wochen weg. Aber ich habe immer gewusst: Der ist unten im Wald. Denn da haben die Krähen abends eine echte Gaudi gemacht! Richtig schlimm.
Nach zweieinhalb Wochen sagt meine Frau in der Früh um sechs: „Du, ich hör da draußen irgendwas. Ich glaub, ich hab den Uhu gehört.“ Da ist er beim Nachbarn im Baum gesessen. Den ganzen Tag lang. Aber wie ich am Abend schauen will, wo er ist, sehe ich ihn nicht mehr. Denk ich mir: „Na super, jetzt ist er weg!“ Im nächsten Moment höre ich: „U-hu!“ Sitzt er fünf Meter von mir entfernt am Zaun. Ich habe den Arm ausgestreckt – und er fliegt mir direkt auf die Faust.
Dieser Uhu war überhaupt ein ganz besonderer Vogel. Wenn du ihn auf dem Falknerhandschuh – „auf der Faust“, wie man sagt – sitzen hattest, hat er seinen Flügel um dich rumgelegt. Als ob er dich umarmen täte! Und hat dann immer so an meinem Hals rumgetan und dazu „Uhu-hu, uhu-hu“ gemacht. Ganz verrückt. Ein Adler oder ein Habicht – die schreien ja fürchterlich. Das hältst du nicht aus. Aber der Uhu – so richtig warm und tief: „Uh-hu!“ Wirklich angenehm!
Ich hätte ihn natürlich gern ausgewildert. Nur war er vom Vorbesitzer offenbar „auf die Faust“ abgerichtet. Und da verlieren die Vögel ihre angeborene Scheu vorm Menschen – was für ein Wildtier ja absolut ungünstig ist. Deswegen hat er bei mir im Garten an einer sogenannten Flugdrahtanlage gesessen. Das ist ein Haus, an einer Seite offen, am Boden ein Pflock und in einiger Entfernung im Garten wieder ein Pflock. Zwischen diesen Pflöcken ist ein Draht gespannt und an diesem Draht entlang läuft ein Metallring, an den der Uhu mit einem Strick gebunden ist, sodass er hin- und herfliegen kann. Bei mir waren das 15 Meter. Und wenn du ihm dabei zugeschaut hast: Der hat fliegen können, dass der Ring nicht einmal geklingelt hat! So perfekt hat der die Höhe einschätzen können.
Und, na ja, eines Tages bekam ich dazu noch einen Turmfalken. Den habe ich zunächst in eine ausrangierte Papageienvoliere im Garten gesperrt; weil, wenn die klein sind, können sie ja nicht fliegen. Turmfalke und Uhu kannten sich also vom Sehen. Wenn auch nur aus größerer Entfernung. Wie dann der Turmfalke alt genug war, habe ich ihn freigelassen. Denn: Sogar wenn sie von Hand aufgezogen werden, kann man Turmfalken auswildern. Sie kommen draußen zurecht, sie können sich ernähren. Trotzdem ist dieser Turmfalke jeden Abend um Punkt 17 Uhr, wenn’s Futter gegeben hat, beim Nachbarn am Hausdach gesessen. Und hat gewartet, bis es bei mir herüben losgeht. Und da ist folgende Geschichte passiert: Ich hatte in der Mitte der Drahtanlage für den Uhu eine Wasserschüssel aufgestellt und einen Pflock angebracht, damit er sich zwischendurch hinsetzen kann. Und in diesem Moment – ich komm gerade in den Garten – kommt der Falke angeflogen und setzt sich auf den Pflock vom Uhu; der kleine Wahnsinnige!
Ich sehe gerade noch, wie der Uhu ganz große Augen kriegt. Und im nächsten Moment schießt er aus seinem Haus, stürzt sich auf den Falken, drückt ihn runter auf den Boden, mit den Krallen. Ich habe nicht mal mehr was sagen können. Ich habe nur gedacht: „Jetzt bringt er mir den Falken um!“ Wenn der Uhu einmal zudrückt. Der hat eine Druckkraft von fast 100 Kilogramm. Und Krallen hat der, die sind so lang! Aber auf einmal sehe ich, wie er mich anschaut und ich habe das Gefühl, er denkt sich: „Ooooooh! Ich glaub, ich mach gerade einen Scheiß!“ Und im nächsten Moment macht er die Krallen auf, lässt den Falken los und fliegt wieder ins Haus.
Zu dem Zeitpunkt war ich mir sicher, dass der Falke nicht überlebt hat. Weil ich gedacht hab, der Uhu hat gleich richtig zugedrückt. Hat er aber offenbar nicht. Der Falke springt auf, schaut, fliegt die paar Meter dahin, wo der Uhu sitzt; setzt sich ungefähr 30 Zentimeter entfernt von ihm hin und schaut ihn an. Und der Uhu schaut ihn an ... Und von da ab ist nie mehr was passiert. Der Falke hat sich jeden Tag, sobald er gekommen ist, neben den Uhu gesetzt – und hat mit ihm auf die Fütterung gewartet.
Unser Sommer mit Murmele
Erzählt von Elisabeth Rietzler, Wiggensbach/Oberallgäu
1997 waren Reinhold, mein Mann, und ich den fünften Sommer als Hirten auf der Horneralp. Da war unser Johannes eineinhalb und unsere Anna fünf oder sechs. Die Horneralp ist eine reine Jungvieh-Alp. 90 Stück Vieh. Dazu hatten wir drei Esel, zwei Kälber, zwei Schafe, vier Hennen und unsere Katze, Stumpi.
Anfang Juli war Reinhold draußen beim Vieh – es war schlechtes Wetter, trüb und regnerisch; auf einmal sieht er zwischen den Steinen und Haselnusssträuchern ein kleines Etwas sitzen. Ein junges Murmele, ein Murmeltier. Murmeltiere sind eigentlich scheu. Es gibt zwar Wandergebiete, da bleiben sie bis auf 20 Meter vor einem sitzen. Aber bei uns – wir waren da eineinhalb Stunden Fußmarsch auf unwegsamem Gelände vom Dorf entfernt –, da hast du die normal bloß aus der Entfernung gesehen. Dieses Murmeltier saß aber einfach nur vor Reinhold und schaute ihn an. Murmeltiere sind selten allein unterwegs. Deshalb wusste Reinhold zuerst auch gar nicht: Soll er das Tier mitnehmen, soll er es alleine sitzen lassen? Aber dann hatte er immer mehr das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. Dass vielleicht den Eltern was passiert ist. Dass zum Beispiel der Adler sie geholt hat.
Also hat Reinhold es in seine Jacke gepackt und mitgenommen. Auf einmal hatten wir also einen Mitbewohner in unserer Hütte. Und nachdem es nicht krank ausgeschaut hat, war natürlich die erste Frage: Was geben wir ihm zu fressen? Ich habe angefangen, es mit Kälbchenmilch zu füttern. Die kannst du mit Wasser anrühren. Habe das in eine Plastikspritze rein und ihm alle drei Stunden ein bissel was gegeben. Und da hat es dann genuckelt. Es war nur so groß wie ein Meerschweinchen, aber es hatte richtig Hunger!
Außerdem war uns natürlich klar: Es braucht Wärme. Unsere Alphütte war ja sehr alt und primitiv, ganz aus Stein gebaut, mit einer einfachen Holzschalung und einem Blechdach. Und auf dieser Höhe, noch dazu bei schlechtem Wetter, war’s eben auch, vor allem nachts, ziemlich kalt. Also haben wir unsere Esel ganz fest gestriegelt, haben Stroh gehackt und versucht, in einer alten Obstkiste mit dem Stroh-Haar-Gemisch und einem alten Kissen als Deckel eine gemütliche Höhle für den Kerle zu bauen; haben drunter noch einen vorgewärmten Schamottstein gelegt, dachten zwar: „Klar, das kommt jetzt einem Murmelebau nicht wirklich nahe“, aber haben es halt über Nacht da reingelegt.
Das wollte es aber offenbar nicht! In der Früh war es nicht mehr drin. Wir dachten zuerst, es ist weg, aber dann machten wir mehr Licht und da lag es schön zusammengerollt im Federkissen auf dem Kanapee. Das war ab dem Zeitpunkt immer sein Platz. Das Kissen. Auf dem Kanapee. Als Nächstes haben wir’s natürlich auch dem zuständigen Wildhüter gemeldet. Denn normal darf man ja keine Wildtiere halten. Der hat das dann geregelt, dass das Murmele offiziell bei uns leben darf – auch wenn wir am Anfang wenig Hoffnung hatten, dass es überhaupt durchkommt. Viele haben gesagt: „Ihr dürft nicht traurig sein, wenn es euch nach einer Woche stirbt.“
Aber das war eigentlich gar nie Thema, sondern es ist gewachsen und wurde so zahm wie eine Katze. Wie ein Familientier. Wenn sein Napf leer war, hat es dich bei den Beinen gepackt und diese typischen Schnalzlaute von sich gegeben: „Jetzt will ich was!“ Und die Kinder haben es genauso auf den Arm genommen und gestreichelt und mit ihm gespielt wie mit Stumpi.
Und ähnlich wie eine kleine Katze will ja auch so ein Murmelkind ganz viel Aufmerksamkeit. Wir hatten von den Kindern noch einen Plüschbären, so eine Fingerpuppe. Die war sein Sparringspartner. Klar, der Kerle war ja selber ein Kind! Der wollte spielen und kämpfen! Aber natürlich haben wir Murmele nicht nur drinnen gehalten. Es hat sich nach und nach auch mit unseren anderen Tieren arrangiert. Stumpi hat es zwar nicht so mögen – die ist immer gegangen, wenn es gekommen ist; es war ihr zu wild. Aber mit den Kühen und mit den Schafen hat es Freundschaft geschlossen. Hat sich überall frei bewegt. Und wenn du beim Vieh warst und du hast gerufen – „Murmel!“, dann ist es gekommen.
Manchmal hast du auch wirklich die Tür zumachen müssen. Gerade wenn du k. o. warst vom Schaffen und dich aufs Kanapee gelegt hast – das ist ja die ganze Zeit hergekommen und hat dich irgendwo abgeschleckt. Vor allem am Hals, wo man oft schwitzig und ein bissel salzig war. Am Anfang war das, wegen seiner langen Zähne, schon ein mulmiges Gefühl. Aber es hat uns nie wirklich fest gebissen.
Und dann hat sich das halt immer weiter rumgesprochen, dass wir ein zahmes Murmele haben. Ich glaub, so viel Besuch hatten wir die Jahre zuvor nie. Da sind Jäger vom Dorf raufgekommen. Und sogar Schulklassen. Jeder wollte unsere Murmele sehen und streicheln. Wenn du dir Murmeltiere so anschaust, meinst du ja, die sind ganz schön struppig. Aber das sind sie nicht. Klar, sie haben schon ein festes Fell, aber die Füße sind ganz fein, die Haut, die Pfoten; ganz weich ist das alles.
Oft hast du dich bei der Gelegenheit natürlich auch unterhalten: „Was machen wir mit ihm, wenn der Sommer vorbei ist?“ Reinhold und ich, wir haben beide gewusst: Mitnehmen kannst du so ein Wildtier nicht. Der ein oder andere hat sich zwar angeboten: „Ja, dann nehm halt ich ihn.“ Sag ich: „Und was willst du mit ihm machen? Das braucht sein halbes Jahr Winterschlaf. Du kannst es ja nicht einfrieren!“
Murmeltiere sind den ganzen Sommer damit beschäftigt, sich ein Winterquartier zu bauen. Unser Murmele hat das schon die ganze Zeit auf seine Weise gemacht. Das hat wirklich alles brauchen können. Von kleinen Kindersocken über Stoffwindeln, Unterhosen, sämtliche Kleidungsstücke, sogar einen kleinen Teppich. Unser Kanapee bestand aus einer alten Matratze auf Dielen; darunter war nur eine Handbreit Platz – und Murmele war am Schluss an die 40 Zentimeter. Aber irgendwie hat’s es geschafft, da alles drunterzuziehen. Wahrscheinlich aus so einem Instinkt heraus: „Ich muss mir ein Häusle bauen.“
Am 20. September war dann unser Alpabtrieb. Und wir haben immer noch keine Lösung gehabt. Unser Wildhüter hat überall versucht – in Wildparks und so –, ob jemand unser Murmele aufnimmt. Aber da war nix zu machen.
Als es losging mit dem Alpabtrieb, sind wir mit dem Jungvieh und den Kühen in der Früh runter ins Tal. Die Hennen waren noch oben. Auch die Esel ... Auf dem Weg zurück haben wir uns dann arbeitstechnisch getrennt: Reinhold hat Johannes auf den Rücken genommen und ist mit ihm weiter unten Zäune ablegen gegangen. Und ich bin mit unserer Anna wieder rauf. Und dann ruf ich „Murmel“, aber es kommt nicht! Denk ich:„Das ist aber komisch; das kommt doch immer, wenn ich es rufe“, weil ich eigentlich die Hauptperson für es war. Und eineinhalb Wochen vorher war die Jagd losgegangen. Da gab’s zwei italienischsprachige Jäger, die waren schon seit Tagen auf eine Hirschkuh aus, soviel ich wusste. Sonst war an dem Tag niemand unterwegs. Und da hab ich gedacht: „Die werden doch nicht ...!“
Hinter der Hütte war ein großer Stall. Da ist unser Murmele gern gehockt und hat sich gesonnt. Es hat ja keine Angst gehabt vor Menschen. Ich denk, die hätten sich einen Meter entfernt hinstellen und es in aller Ruhe abknallen können. Und dann hab ich schon gesehen, dass sie es dort an die Wand hingeballert haben. Dann habe ich die zwei entdeckt – die waren inzwischen schon 200 Höhenmeter weiter oben – und bin mit Anna im Schlepptau rauf. Ich habe wahrscheinlich mehr geweint und geplärrt, als mich verständlich ausgedrückt. Aber die haben schon gewusst, was ich will.
Tja, und dann war das Problem auf traurige Art und Weise gelöst. Aber so blöd es sich anhört: Vielleicht war’s so sogar das Beste. Weil, auf sich allein gestellt hätte es wahrscheinlich keine zwei Tage überlebt. So aber hatten wir alle zumindest noch einen schönen Sommer, an den wir immer noch zurückdenken. Von unserem Johannes gibt’s in der Gegend dort sogar heute noch eine Postkarte mit unserem Murmele.
Der Seehasenritt
Erzählt von Michael Schrödl, München
Als Meeresschneckenforscher taucht man immer wieder in Umgebungen, die erst mal nicht sonderlich interessant aussehen. In Peru war ich zum Beispiel mal im Hafenbecken eines Fischereihafens, wo’s wirklich nur wabernde Grünalgenschleier zu geben schien. Aber auf einmal saß da ein großer Schwarzer Seehase vor mir.
Seehasen sind fast schalenlose Schnecken, die bis zu einem halben Meter groß werden, mit zwei Tentakelpaaren, von denen das obere wie das Löffelpaar eines Hasen aussieht. Also wirklich putzig. Wobei es vor Peru eine knallschwarze Art gibt, die ich vorher noch nie gesehen hatte und von der ich wusste, dass von ihr noch kein einziges Exemplar in einem Museum existiert. Und genau so ein Seehase saß da jetzt direkt vor mir in den Grünalgen. Da habe ich mir gedacht: „Hm, eigentlich würde ich dich schon gern mitnehmen und hernach in ein Glas stecken!“
Das ist immer ein echtes Dilemma, in dem wir Forscher uns befinden. Ich gönne allen Tieren ihr Leben und ihre Freiheit. Aber wenn es von einer bestimmten Art noch kein einziges Exemplar für die Wissenschaft gibt: Das geht dann auch wieder nicht. Denn um zu wissen, was man schützen will, muss man ja erst mal wissen, was vorhanden ist. Und das muss man erforschen und beweisen können. Dafür existieren zoologische Sammlungen. Deshalb war mein erster Impuls: mitnehmen! Ich bin kein Seehasen-Streichler. Ich bin Forscher. Und zwar ein leidenschaftlicher.
Jetzt hatte ich aber gerade keine Tüte dabei, die groß genug gewesen wäre. Ich habe gedacht: „Wenn ich den nicht gleich mitnehme, finde ich ihn in all dem Algenschlonz nie wieder.“ Also habe ich ihn genommen und einfach auf meinen Oberarm gesetzt. Seehasen sind nicht sehr schreckhaft. Vielleicht auch deshalb, weil sie wegen ihrer chemischen Schutzsubstanzen kaum natürliche Feinde haben.
Ein anderer Abwehrmechanismus besteht darin, sich fallen zu lassen und mit der Strömung in Richtung Boden zu schweben. Auf diese Weise ist die Schnecke ruckzuck weg und außer Gefahr. Oder sie schwimmt weg. Das wäre auch noch eine Option für meinen Seehasen gewesen. Hat er aber nicht gemacht. Sondern saß da seelenruhig auf meinem Arm. Dann bin ich langsam losgeschwommen; habe drauf geachtet, dass er sich nicht doch noch fallen lässt, dann aber gemerkt: Okay, der hat seinen Vorderkörper mit den Tentakeln aufgestellt und schnuppert so richtig in den „Fahrtwind“.
Anscheinend fand er das alles gar nicht so unangenehm, sondern genoss es sogar, von mir durchs Wasser geschippert zu werden. So etwa: „Wow! So schnell war ich noch nie unterwegs!“ Genau so fühlte sich das an. Dabei war der restliche Tauchgang gar nicht so kurz. Wir haben fast eine halbe Stunde bis zum Einstieg gebraucht. Aber er saß da die ganze Zeit in seiner entspannten Habachtstellung auf meinem Arm und hat sich überhaupt nicht wegbewegt.
Und als wir dann angekommen waren – tja, ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, ihn in eine Tüte zu stopfen und dann einzuschnapsen, wie wir sagen; das heißt, in ein Glas einzumotten und mit Alkohol zu übergießen. Das konnte ich meinem Tauch-Spezi dann nicht mehr antun. Also habe ich ihn da wieder zwischen die Algen gesetzt und weitermümmeln lassen.
Geißenland
Erzählt von Maria Anna Müller, Pfyn/Schweiz
Mein Mann Rolf und ich sind jeden Sommer zu zweit auf der Alp. Sie liegt zwischen 2300 und 2700 Metern. Ein sehr großes, weitläufiges Gelände. Neben den Schafen haben wir immer auch ein paar Geißen dabei, weil wir die Milch für unseren eigenen Bedarf brauchen. Und Geißen sind halt ganz anders als Schafe. Sie sind pfiffig und frech. Auch sehr eigen. Von Rolf habe ich in einem Jahr zu Weihnachten eine besondere Geiß gekriegt – Anna. Sie war damals ein gutes halbes Jahr alt. Also noch ein Gitzi, ein etwas größeres Jungtier. Von der Rasse her eine Bündner Strahlengeiß. Schwarz und weiß die Zeichnung. Ein ausgesprochen schönes Tier. Ich habe gleich gesagt: „Du bist meine Zirkusgeiß!“, weil ihr immer noch irgendwas eingefallen ist, was sie anstellen kann.
Wir gehen meistens um den 20. Juni auf die Alp. Und dort gehen die Geißen jeden Morgen ihrer Wege, kommen aber in der Regel von selber wieder
zurück in den Stall. Wenn sie bis am Abend nicht da sind, suche ich sie. Und an einem Abend Anfang Juli sind alle anderen gekommen – nur Anna war nicht dabei. Ich habe sie gesucht, bis es dunkel geworden ist. Nicht gefunden. Am nächsten Tag habe ich dann das ganze „Geißenland“ abgesucht. Ich sage zu dem Gelände, wo sie sich gern aufhalten, Geißenland. Ich habe gerufen – keine Antwort. Auch kein Glöckle gehört. Unsere Tiere haben immer kleine Glocken um, damit wir wissen, wo sie sind. Aber wieder: nix!
Am Abend sind die anderen Geißen heimgekommen. Wieder ohne Anna. Da war ich schon am Verzweifeln. Am nächsten Tag habe ich gesagt: „Ich geh zur unteren Hütte.“ Dorthin gehe ich meistens nur, wenn ich Post hole oder Müll runtertrage. Allerdings gibt es da einen Punkt, von dem aus ich die ganze Felswand gut einsehen kann. Ich losgezogen mit Fernglas, Verbandmaterial, falls sie verletzt gewesen wäre; was zum Schienen hab ich mitgenommen, Strick hatte ich dabei. Und dann bin ich da unten gestanden und hab eine dreiviertel Stunde lang mit dem Feldstecher gespiegelt, wie’s auf Schweizerdeutsch heißt. Auf einmal: „Da ist sie! Tatsächlich, da ist sie.“
Daraufhin bin ich den ganzen Weg rauf, dann quer gegangen – es gibt da einige Felsbänder, die sich waagrecht durchziehen –, war letztendlich an der fraglichen Stelle – keine Geiß! Also habe ich mich in der Nähe der Stelle, wo ich sie vermutete, ins Gras gesetzt und
immer wieder gerufen. Der Lockruf ist: »Gitz-Gitz-Gitz-Gitz-Gitz! Giiiitz-Gitz-Gitz-Gitz-Gitz! Anna!« Auf einmal hat sie geantwortet! Aber ganz schwach.
Ich dachte: „Oh nein, die ist total verzweifelt. Die steht ja schon zwei Tage irgendwo. Hat nix zum Fressen ...“
Ich bin an eine überhängende Kante gekrochen – zuerst auf allen vieren, dann auf dem Bauch gerobbt, und habe mich runtergebeugt. Da war die Geiß auf einem ganz kleinen Felsabsatz! Zwar nur eineinhalb, zwei Meter unter mir, aber so weit bin ich nicht runtergekommen, es hätte sich jemand abseilen müssen, und sie dann mit raufziehen.
Also habe ich mich noch mal runtergebeugt und gesagt: „Anna, tut mir leid, ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich bring dich da nicht allein raus, du musst noch ausharren. Ich hol den Rolf.“ Denn in den Bergen hat oberste Priorität, dass man sich nicht selber in Gefahr bringt. Dann habe ich den Rucksack aufgeschnallt und bin gegangen.
Und in dem Moment hat die Geiß – wahrscheinlich mit dem panischen Gedanken: „Jetzt geht die Maria Anna wieder weg und lässt mich allein“ –
ihren ganzen Lebensmut zusammengenommen und ist irgendwie, keine Ahnung wie, über den Überhang hochgehupft und zu mir gekommen.
Ich wollte sie natürlich gleich streicheln und umarmen. Aber das war alles nicht wichtig. Das Gras war wichtig. Sie hat sich erst mal den Bauch vollgeschlagen. Es hat gedauert, bis ich mit ihr heimlaufen konnte. Wobei sie am Anfang noch sehr gestresst war. Das siehst du in den Augen. Aber dann hast du gemerkt – je näher wir zur Hütte gekommen sind –, wie sie sich gefreut hat und rumgehüpft ist. Und als am Abend die anderen Geißen wiedergekommen sind und Anna die Glöckle gehört hat, hat sie gerufen und ist ihnen entgegengegangen – man konnte richtig sehen, wie zufrieden sie ist, wieder in der Herde zu sein.
Seitdem ist das ein spezielles Verhältnis zwischen Anna und mir. Auch wenn sie nie so eine richtig anhängliche Geiß geworden ist. Sie ist einfach gern für sich. Und sie hat sich auch immer wieder verstiegen. Ich glaub, jeden Alpsommer einmal. Einfach vor lauter Übermut und Ausprobieren. Mittlerweile weiß ich aber: Meistens kommt sie schon irgendwie wieder raus.
Der Pinguin, der immer nieste
Erzählt von Heide Schulz-Vogt, Warnemünde
1996 habe ich, zusammen mit einer anderen deutschen Doktorandin, für ein gutes Jahr in einem kleinen chilenischen Fischer- und Badeort gewohnt, wo auch eine kleine meeresbiologische Station ist. Und weil wir mitten unter den Fischern gelebt haben, kannten die uns alle und brachten eines Tages einen jungen Pinguin vorbei, der am Bauch einen Ölfleck hatte und vollkommen entkräftet war.
Dass Schiffe ein bisschen Öl verlieren oder es auch absichtlich ablassen, passiert dauernd. Das ist für die Vögel ein großes Problem, denn sie pflegen ihr Gefieder sehr. Sobald sie dreckig sind, fangen sie an, sich zu putzen. Dadurch fressen sie quasi dieses Öl, das sich anschließend um die Magenwände legt, sodass sie verhungern.
Alexander – so nannte ich den Pinguin, weil er wahrscheinlich ein Humboldtpinguin war; genau konnte ich das nicht sagen, weil er noch nicht ausgefärbt war – war ganz abgemagert. Du konntest die Rippen fühlen. Er konnte nicht mehr stehen, er lag nur noch. Noch dazu war er ordentlich erkältet. Hat immerzu geniest. Weil er eben seine Fettschicht verloren hatte, die die Pinguine schützt.
Ich habe dann erst mal das Öl entfernt. Dabei hat er mir wirklich schlimm in die Arme gehackt. Pinguine haben eine ganz fiese Spitze vorn am Schnabel. Ich war überfordert mit der Situation. Deswegen habe ich den Direktor vom „Zoo am Meer“ in Bremerhaven angerufen. Der konnte mir zum Glück ein paar Hinweise geben. Vor allem, dass ich dem Pinguin Maiskeimöl geben soll – sozusagen als Abführmittel –, damit das Erdöl rausgespült wird. Er sagte mir auch, welches Gewicht der Pinguin haben muss, bevor ich ihn wieder aussetzen darf.
Ich bin dann, auf seinen Rat hin, zum Tierarzt in die nächstgrößere Stadt gefahren, der dem Pinguin gleich Vitaminspritzen verpasst hat. Was ich da wirklich rührend fand: Der Tierarzt, der bestimmt nicht viel verdient hat, hat es abgelehnt, von mir Geld für die Behandlung zu nehmen. Er sagte, das sei ja ein Wildtier, und dafür müsse ich doch nicht bezahlen. Und schließlich habe ich von ihm noch den Trick gelernt, ein bisschen Klebeband an die Spitze vom Schnabel zu machen; damit der Pinguin den Schnabel nicht mehr aufkriegt und mich nicht hackt.
Obwohl ich sagen muss: Alexander ist schon am Tag, nachdem ich ihn aufgenommen hab, ganz zahm geworden. Er hat sofort verstanden, dass ich ihm nichts Böses will. Er hat auch gleich Futter angenommen. Aus der Hand. Ich habe ihm immer einzelne Fische gegeben ... Die durften nur nicht zu groß sein. Die Fischer haben uns die ganze Zeit kostenlos mit Fischen versorgt. Mit Sardinen hauptsächlich. Die habe ich in Portionen eingefroren. Und dann hat er so zwei, drei Beutel davon pro Tag gegessen. Was manchmal ein bisschen eklig war, denn wenn du Sardinen wieder auftaust, halten die nicht mehr so gut zusammen. Und Alexander hat, wenn er satt war, die letzte Sardine oft in den Schnabel genommen und dann den Kopf geschüttelt. Sodass ich überall Sardinenteile hatte.
Pinguine sind ungeheuer soziale Tiere. Und sehr intelligent. Sobald Alexander ein bisschen mobiler war, ist er immer auf meine Füße gekrochen und hat sich da draufgelegt, wenn ich mikroskopiert habe; und hat sich mit mir unterhalten. Ich musste natürlich lernen, seine Laute nachzuahmen. Aber offenbar hat er meinen Akzent hingenommen. Er hat schon verstanden, dass ich ihn meine.
Er war ungeheuer neugierig. Pinguine sind auch sehr, sehr mutig. Absolute Draufgänger. Alexander hat wirklich alles erkundet, ist überall hochgeklettert, ist runtergefallen, hat sich irgendwie durchgearbeitet, hat ständig gesucht: Was findet er noch Interessantes? Und wenn er mich nicht mehr sehen konnte, hat er mich gerufen. Erst leise und dann immer lauter. Aber nicht hilflos. Eher anlehnungsbedürftig. Und wenn ich geantwortet hab, ist er schnell angelaufen gekommen.
Aber das Witzigste war, dass er immer nieste. Man glaubt es kaum, wie niedlich so ein kleiner Vogel im Frack ist, wenn er mit ausgebreiteten Armen auf einen zugelaufen kommt und „Tschi!“ macht. „Tschi! Tschi!“ Als er wieder richtig stark war, habe ich mit ihm täglich Spaziergänge gemacht. Die Station war ja direkt am Strand. Ich hatte am Anfang Angst vor den vielen streunenden Hunden, die’s da gibt. Aber die legen sich nicht mit Pinguinen an, wie sich rausgestellt hat. Weil Pinguine so fies sind – die lassen die Hunde erst ganz nah ran, und dann hacken sie ihnen in die Nase. Das haben die alle gelernt.
Aber abgehauen ist er nicht. Wenn er zu direkt aufs Meer zugestrebt ist, habe ich ihn zurückgerufen. Das hat gereicht. Es war dann zwar schon Sommer, aber ich wollte ihn lieber weiter hochpäppeln, damit er noch etwas dicker wird. Denn je dicker, desto geringer die Gefahr, dass er im Wasser auskühlt. Es hat erstaunlich lange gedauert, bis er sich vollkommen erholt hatte. Was mir noch mal die Grausamkeit von Ölteppichen klargemacht hat.
Irgendwann ist er auch mal ins Wasser. Ich dachte, er ist weg. Aber er ist wieder zurückgekommen. Im Lauf der Zeit ist er immer länger schwimmen gegangen. Was genau das war, was ich wollte. Ich wollte ihn ja nicht als Haustier behalten. Und eines Tages ist er halt nicht mehr zurückgekommen. Er hat mich allerdings noch mal besucht – ein paar Wochen später. Da stand er dann zwar nicht an der Tür und hat auf mich gewartet; aber er hat sich am Strand rumgetrieben, hat mich auch erkannt, ist auf mich zugelaufen ... Ich konnte ihn sogar anfassen, kraulen – was du mit einem fremden Pinguin lieber nicht machen solltest; aber danach ist er halt wieder los. Das ist so bei Vögeln. Das machen sie mit ihren Eltern genauso. Ich denke, er ist gut klargekommen.