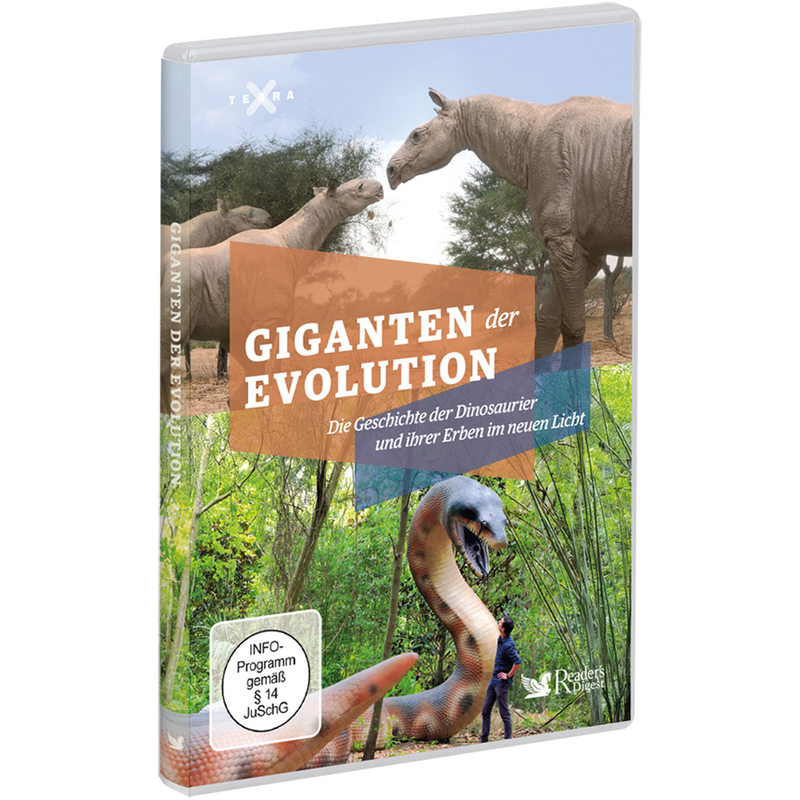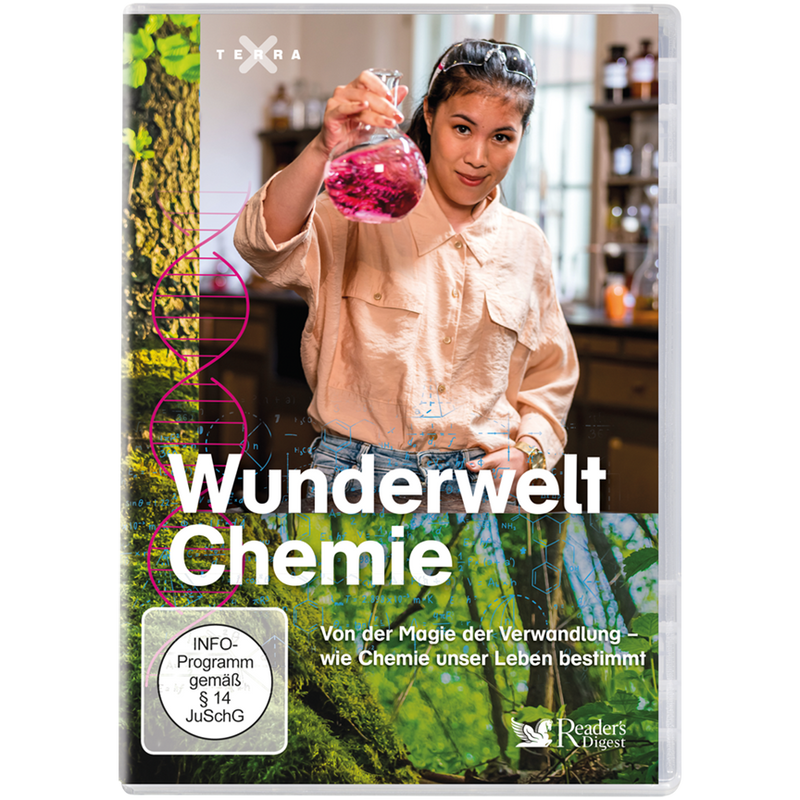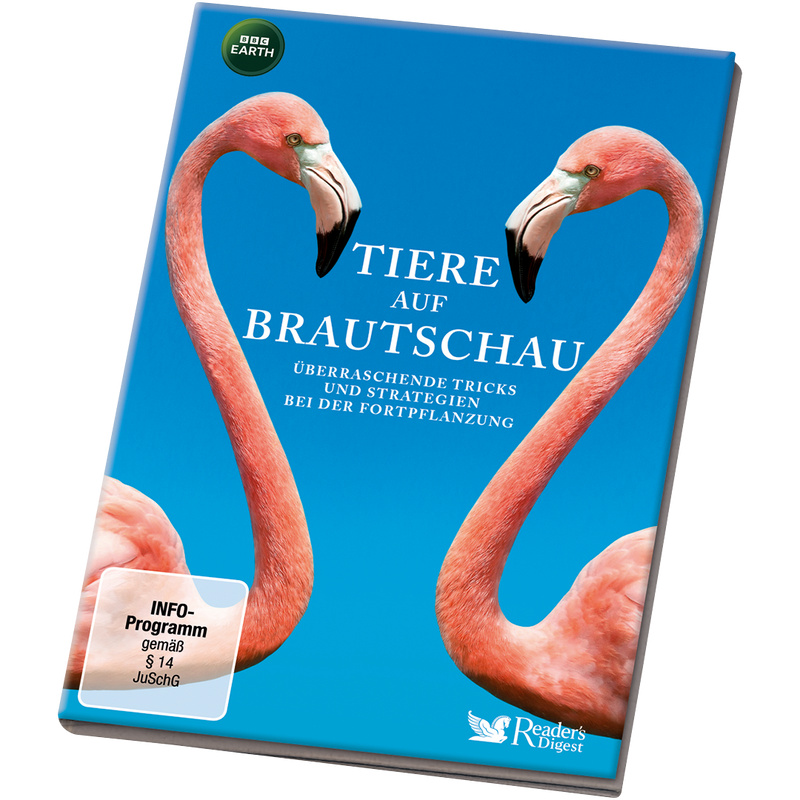Wo Bienen in Bäumen wohnen
In einem russischen Naturreservat betreiben Imker ihr Handwerk wie vor Hunderten von Jahren.

©
Diesen Artikel gibt es auch als Audio-Datei
Sein Arbeitsmaterial: ein kniehohes Fass aus Lindenholz, ein Lederriemen, zwei Äxte und ein etwa armlanges, schmales Brett. Anis Dilmuchametow bindet all diese Gegenstände zu einem Bündel zusammen und zieht los. Sein Ziel: ein Baum, in dem Bienen wohnen. Anis Dilmuchametow ist ein Waldimker, Zeidler genannt. Sein Beruf ist ein Handwerk aus der Vergangenheit – das aber auch die Zukunft sein könnte, ein Vorbild für die Bienenhaltung in ganz Europa. Denn die Zeidler betreiben eine naturnahe Imkerei, die in Westeuropa längst vergessen wurde. Und es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass die Bienen der Zeidler stärker sind und widerstandsfähiger gegen Krankheiten, die Bienenvölker auf der ganzen Welt bedrohen.
Anis Dilmuchametow lebt und arbeitet in der russischen Republik Baschkortostan, dem letzten Zipfel des europäischen Russlands. Hinter dem Wald beginnt das Uralgebirge, im Süden liegt Kasachstan. Ein Landstrich mit Hunderten Flüssen, Tausenden Seen. Von den Hügelkuppen aus betrachtet sehen die Holzhäuser der Dörfer aus, als habe ein Riese bunte Schokolinsen ausgestreut. Hier scheint der russische Krieg gegen die Ukraine weit weg, und doch schlagen täglich Raketen ein.
In Baschkortostan ernteten die Menschen schon lange vor diesem Krieg einen besonderen Honig. Der Zeidler Dilmuchametow geht immer tiefer hinein in den Wald. Kurz bleibt er stehen und schaut sich suchend um. Er war zuletzt vor vielen Monaten an diesem Ort. Dann schlägt er eine Richtung ein, als führe ihn ein unsichtbares Band zu seinen Bienen. Schließlich stoppt er vor einer Fichte. Der Imker legt sein Bündel zu Boden. Angekommen. Einige Minuten später zieht er sich die Schuhe aus. „Auf Socken klettert es sich besser“, sagt Dilmuchametow. Er schlingt den speckigen Lederriemen, ein Erbstück seines Vaters, um den Baumstamm und verknotet ihn hinter seinem Rücken. Jetzt schiebt er gleichzeitig den Riemen nach oben und klettert mit schnellen Schritten senkrecht die Fichte empor. Nach wenigen Sekunden hängt er etwa acht Meter über dem Erdboden am Baum. Aus einem Holzbrett und einem Seil konstruiert er eine Fußstütze.
Den Auf- und Abstieg von den Bäumen haben die Waldimker bereits als Jugendliche gelernt. Dennoch bleibt das Werkeln in der Höhe gefährlich. Die Zeidler gehen deshalb niemals allein in den Wald. Einige nehmen ihre Söhne mit, wenn diese alt genug sind. Dilmuchametow wird von einem Freund begleitet. Er kann Hilfe holen, sollte der Waldimker sich durch einen Sturz verletzen.
Dicke Honigwaben kleben am Holzdeckel
Der Zeidler hat vor einer Öffnung im Baumstamm gestoppt. Sie reicht ihm etwa vom Hals bis zur Hüfte und ist mit einem Stück Maschendraht, einer Schicht getrocknetem Farn sowie einer Holzplatte verschlossen. Vorsichtig löst Dilmuchametow die Schichten. Er stößt einen überraschten Ruf aus: „Eieiei.“ Die Honigwaben im hohlen Stamm sind so dick und breit, dass sie von innen am Holzdeckel kleben. Sie sehen aus wie übergroße Tropfen. Leises Summen dringt aus der Öffnung.
Schon Steinzeitvölker aßen den Honig wilder Bienen. Die Zeidler im frühen Mittelalter waren die Ersten, die in Europa gewerbsmäßig den Honig der Bienen ernteten. Sie hieben in alte Bäume künstliche Höhlen, Beuten genannt, und warteten darauf, dass ein Volk die neue Behausung bezog. Die Zeidlerei war zu jener Zeit ein gutes Geschäft. Außer Honig gab es in Europa noch kein anderes Süßungsmittel, das Wachs benötigte man für Kerzen, und die Ärzte nutzten Honig sowie das entzündungshemmende und wundheilungsfördernde Bienenharz Propolis für ihre Patienten. Die Wälder im Fichtelgebirge, in der Mark Brandenburg, in Pommern und um Nürnberg waren voll von Baumbeuten – und Bienenvölkern. Erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde aus der Biene ein Nutztier, ein Tier also, das Menschen halten, um Ertrag zu erwirtschaften.
Im russischen Baschkortostan wird dagegen eine Art der Imkerei betrieben, die Hunderte Jahre alt ist. Männer wie Anis Dilmuchametow können nachvollziehen, wie das Handwerk über Generationen vom Vater an die Söhne weitergegeben wurde.
Dilmuchametows Bienen sind klein und schmal, dunkel und beinahe ohne Härchen auf dem Leib, Gattung Apis mellifera mellifera. Man sagt, sie seien aggressiver als ihre westeuropäischen Verwandten. Aber davon ist nichts zu merken, als Dilmuchametow die Baumbeute öffnet. Trotzdem lenkt er die Tiere nun mit Rauch aus einem gusseisernen Kännchen ab. Darin schwelt etwas trockener Farn. Der Rauch wird von Bienen als Bedrohung empfunden. Sie bereiten ihre Flucht vor, füllen ihre Mägen mit Honig und sind deshalb abgelenkt.
Anis‘ Ernte von nur einem Bienenvolk: sechs Kilo Honig
Anis Dilmuchametow ist ein großer Mann mit Spitzbubenlächeln, 42 Jahre alt. Zum Frühstück isst er Suppe mit Hammelfleisch, er glaubt nicht an Gott, aber an göttliche Fügung. Er kennt die Bären, die im Frühjahr geboren wurden, und den Biber, der den Fluss umgeleitet hat. Er spricht über die Bienen wie über ferne Freunde, die er selten, aber gern sieht. „Sie sind frei, aber sie gehören zu mir.“
Halb hängend, halb stehend am Baumstamm beginnt Anis Dilmuchametow die Honigernte. Im Zeitlupentempo schneidet er Stücke von den Waben und legt sie in seinen geschnitzten Eimer aus Lindenholz, den er an der Hüfte festgebunden hat. Er spricht mit den Bienen: „Schhhhh, es ist ja gleich geschafft, gleich bin ich wieder weg.“ Er entnimmt etwa ein Viertel der Waben. Als er fertig ist, verschließt er die Öffnung im Stamm als Schutz vor den hungrigen Bären. Wieder am Boden schaut der Zeidler prüfend in sein Fass. Er hat etwa sechs Kilogramm Honig geerntet.
Die Waldimker sind gleichzeitig Rager des Biosphärenreservats
Die meisten baschkirischen Baumbeuten befinden sich im Biosphärenreservat Schulgan-Tasch. Es sind etwa 700 an der Zahl, aber nicht alle Beuten sind bewohnt. Die Reservatsverwaltung will die Tradition der Zeidlerei erhalten: 14 Waldimker sind im Reservat angestellt und gleichzeitig Ranger, einer von ihnen ist Anis Dilmuchametow. Etwa drei Tonnen Honig ernten die Zeidler von Schulgan-Tasch in jedem Spätsommer – ein geringerer Ertrag als bei der kommerziellen Imkerei.
Bei der Zeidlerei gehen die Imker auf Abstand zu den Bienen, die Zeidler selbst sprechen von „wesensgerechter Haltung“, die sich an den natürlichen Bedürfnissen des Bienenvolkes orientiere. Bei seiner Ernte entnimmt Dilmuchametow nur so viel Honig, dass das Bienenvolk gut über den Winter kommt. Die Bienenkönigin darf mit ihrem Volk ausschwärmen und neue Behausungen suchen, wann und wohin sie möchte. Es gibt keine Züchtung auf bestimmte Merkmale hin.
Die Waldimker von Baschkortostan besuchen „ihre“ Völker auch nur zwei- bis dreimal im Jahr, ein letztes Mal im September, wenn die Honigernte ansteht. Danach verschließen sie die Bauten winterfest und schauen erst im Frühjahr wieder danach.
Inwieweit diese Haltung den Bienen guttut, ist bislang nur ansatzweise untersucht worden. Erste Forschungen weisen aber darauf hin, dass die Bienen in den Baumbeuten gesünder leben. Dilmuchametow schickt regelmäßig einige der Insekten an die Universität der Regionalhauptstadt Ufa. Dort wird untersucht, ob die Bienen der Waldimker besser gerüstet sind gegen die Varroamilbe. Diese soll in Deutschland und vielen anderen Ländern der Erde für den Tod von 10 bis 15 Prozent der Bienenvölker verantwortlich sein.
Laut den Studien des bekanntesten Honigbienenforschers, des US-Amerikaners Thomas Seeley, haben freilebende Bienenvölker eine höhere Schwarmintelligenz und eine erhöhte Toleranz gegen die tödlichen Milben. Anis Dilmuchametow braucht keine Wissenschaftler, um zu sehen, wie es seinen Tieren geht. Er meint: „Bienen, die acht Meter hochfliegen, können gar nicht schwach sein.“
Naturnahe Bienenhaltung auch in Polen
Seit einigen Jahren versuchen Imker, die naturnahe Bienenhaltung auch in anderen Teilen Europas wieder populär zu machen. Der Biologe Przemyslaw Nawrocki vom WWF (World Wildlife Fund) Polen war der Erste, der die traditionelle Zeidlerei am Ural studierte und in sein Heimatland und später in andere Teile Europas zurückbrachte. Inzwischen stehen über ganz Polen verteilt 100 Baumbeuten.
In Deutschland gibt es mehrere Zeidlerinitiativen, die Veranstaltungen planen und Wissen weitergeben. Deutsche Waldimker haben in der Nähe von Frankfurt am Main, Berlin und Dortmund Baumbeuten errichtet.
In Polen hat die staatliche Forstbehörde vor einiger Zeit verkündet, in den kommenden Jahren im ganzen Land 1000 neue Häuser für wilde Bienenvölker zu errichten. Trotzdem fällt das Fazit von Przemyslaw Nawrocki über die Wiederbelebung der Zeidlerei verhalten aus. „In einem Wald mit 20 Baumbeuten haben wir in den vergangenen 14 Jahren insgesamt ein Kilogramm Honig geerntet, also nichts“, bedauert er. Die Überlebensrate der wilden Völker sei gering. Der Grund: Die Bienen hungern. Den Tieren fehlten vor allem die Frühblüher im Frühjahr und die Lindenblüten in der zweiten Sommerhälfte, erklärt Nawrocki. In den Wäldern Polens und auch Deutschlands finden wilde Bienen inzwischen viel zu wenig unterschiedliche Blütenpflanzen. „Es nutzt nichts, den Bienen schöne Häuser herzurichten, wenn wir nicht für mehr Biodiversität in den Wäldern sorgen“, sagt der WWF-Experte. Die Bienen bräuchten Vielfalt im Wald wie in den vergangenen Jahrhunderten mit Ahorn, Weiden und Lichtungen, auf denen Heidekräuter blühten. Nawrocki sieht die Baumbeuten in Polen inzwischen auch als Beitrag zum Aufbau einer neuen Diversität in den Wäldern – und empfiehlt, zunächst einmal auf neues Waldmanagement zu setzen.
Honig-Imbiss auf der Waldlichtung
Der russische Zeidler Anis Dilmuchametow hat inzwischen eine Waldlichtung mit einem Rastplatz erreicht. Auerhähne stolzieren vorbei. Schwindsüchtig wirkende Birken lehnen sich aneinander. Die Wolken hängen so tief, als wollten sie die Erde berühren. Es ist ein idyllisches Bild von der russischen Provinz. Die Baschkiren sind verliebt in ihre Heimat, von der außerhalb Russlands kaum jemand etwas weiß. Am Fuß des Uralgebirges gibt es kaum Zäune um die Häuser. Hunde, Schafe, Pferde, Kühe und Ziegen ziehen frei umher – und finden am Abend doch nach Hause zurück. Mit einem ähnlichen Gefühl für Freiheit und Heimat leben auch die Menschen dort. Sie wissen sehr genau, wo sie hingehören.
Anis Dilmuchametow füllt den Honig aus seinem Lindenfass in eine Plastikbox. Im Lager von Schulgan-Tasch kommt die Ernte dann am nächsten Tag in Gläser, und schon ist der Honig fertig zum Verkauf. Die Einheimischen am Ural nennen ihn „baschkirisches Gold“.
Dilmuchametow deckt den Tisch am Rastplatz mit frisch gebackenem Brot und hausgemachtem Schmand. Dazu noch der Honig. Handgroße Waben, von denen der Nektar dunkel und zäh tropft. Anis Dilmuchametow legt die Wabenstücke direkt auf das Brot und beißt hinein, schließt die Augen. Der baschkirische Waldhonig schmeckt anders als gewöhnlicher Honig, würzig und süß – nach Wald.