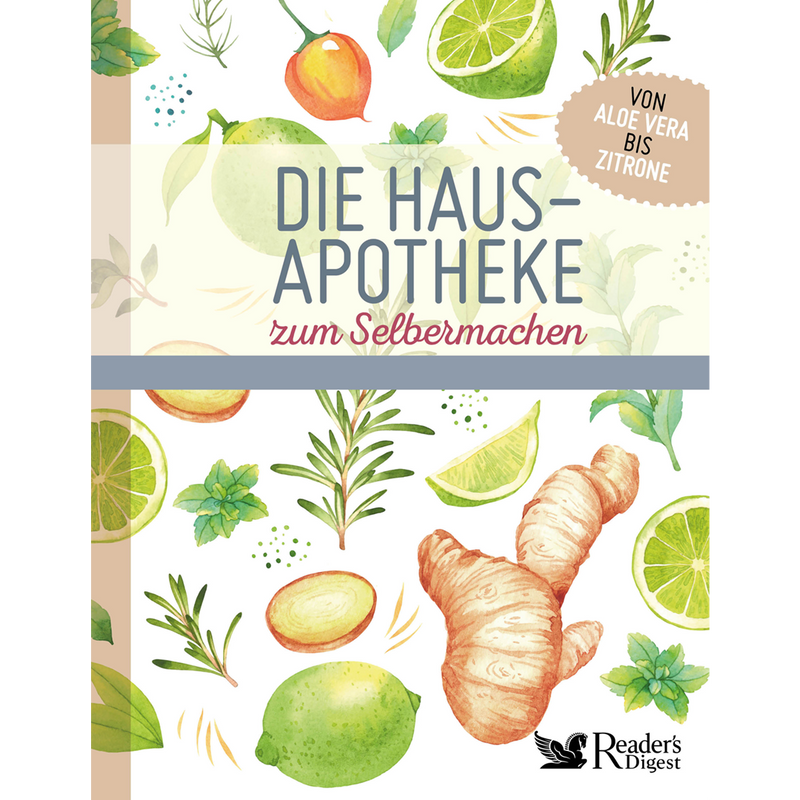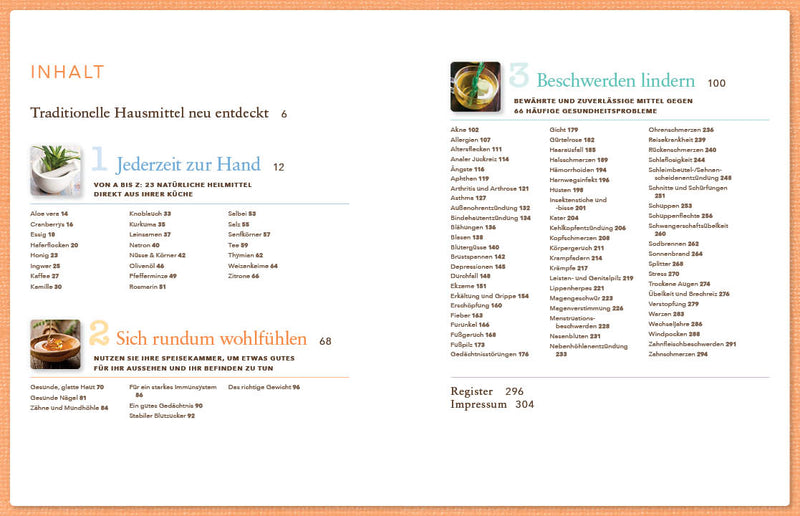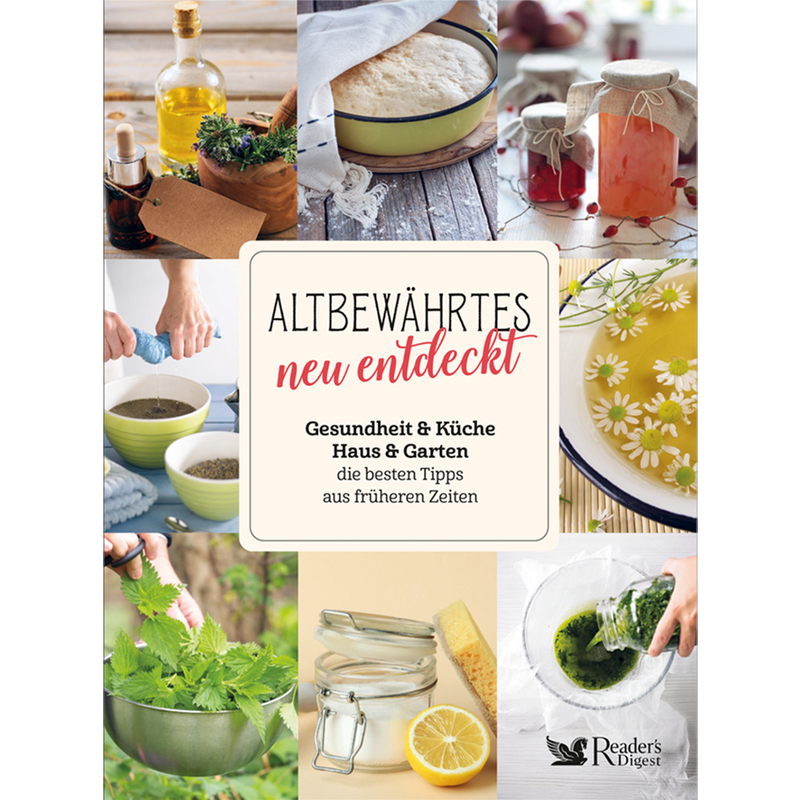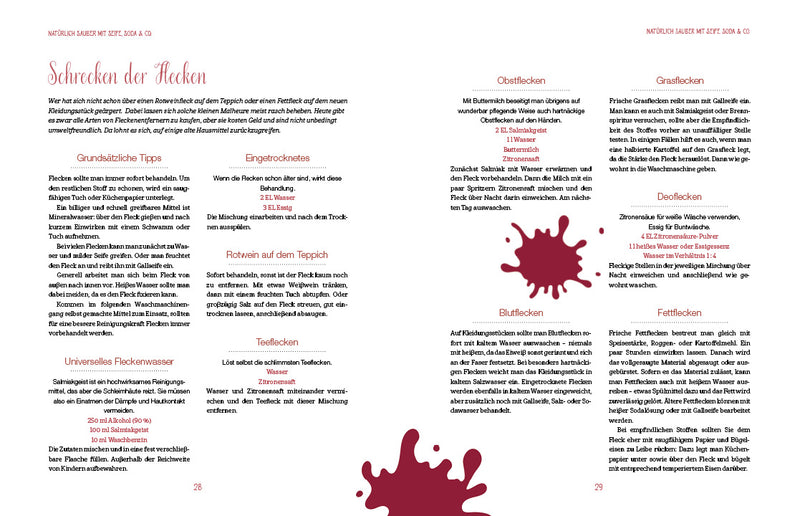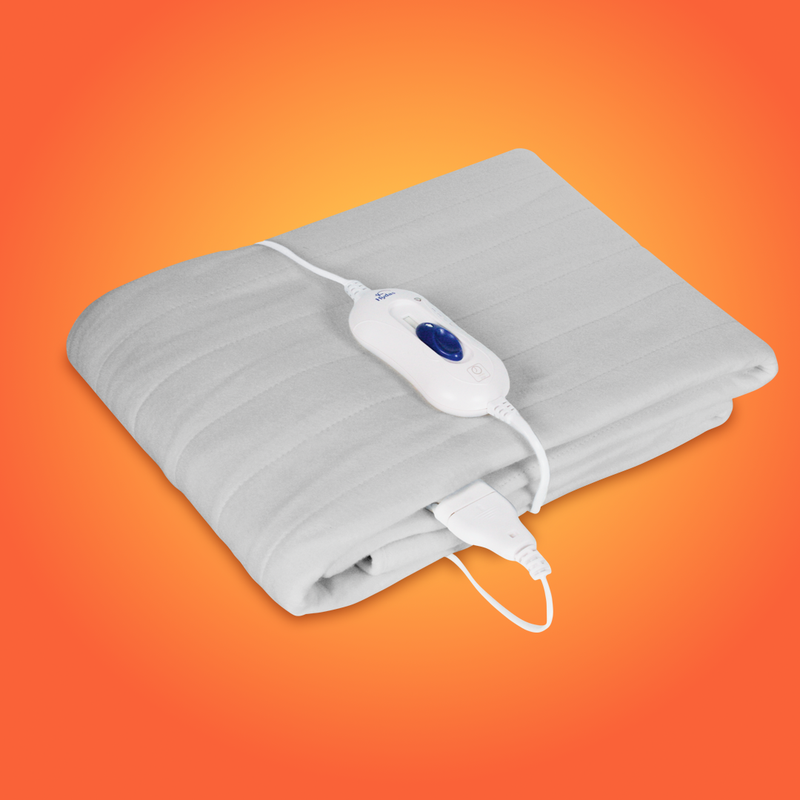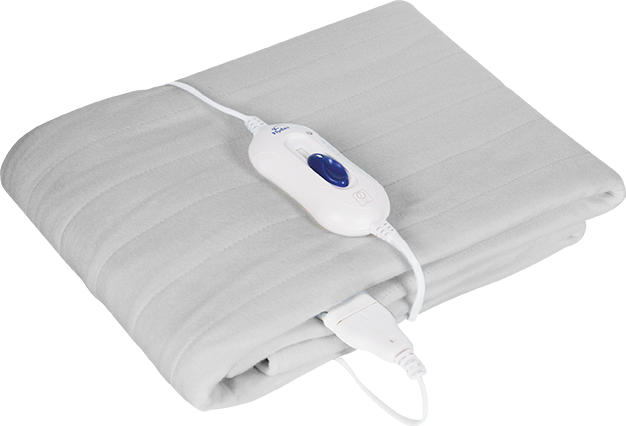Wieviel Flüssigkeit sollen wir täglich trinken - und was?
Unser Körper besteht zu etwa 60 Prozent aus Wasser. Wenn wir nicht genug trinken, kann eine Dehydrierung Schwindel, Müdigkeit und Kopfschmerzen verursachen.

©
Ihren Wasserhaushalt können Sie über die Farbe Ihres Urins und die Häufigkeit des Wasserlassens beurteilen. „Der Urin muss nicht immer klar sein, aber sollte hell wie Limonade und nicht dunkel wie Apfelsaft sein“, so Isabel Maples, Diätassistentin und Sprecherin der Academy of Nutrition and Dietetics in Washington, USA. „Bedenken Sie, dass auch einige Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel die Farbe des Urins beeinflussen können.“
Der Flüssigkeitsbedarf variiert von Tag zu Tag und von Person zu Person, so Maples. Im Durchschnitt benötigen Männer etwa drei und Frauen etwas mehr als zwei Liter pro Tag. Faktoren wie Temperatur, Höhenlage, körperliche Betätigung und Medikamenteneinahme können den Bedarf steigern. Schätzungsweise 20 Prozent der benötigten Flüssigkeit beziehen wir über die Nahrungsaufnahme, der Rest wird durch Wasser und andere Getränke gedeckt. Hier nehmen wir einige von ihnen unter die Lupe:
Kaffee
Koffeinhaltige Getränke haben zwar leicht harntreibende Eigenschaften, jedoch gibt es keine Beweise dafür, dass sie zu Dehydrierung führen. „Kaffee und Tee können die Harnausscheidung kurzfristig erhöhen, aber die Flüssigkeitsaufnahme gleicht diesen Verlust aus“, sagt der in Toronto ansässige Diätassistent Drew Hemler. Eine britische Studie aus dem Jahr 2014, erschienen in der Zeitschrift PLOS One, maß das Körperwasser von Probanden in zwei Gruppen: Eine Gruppe trank 800 Milliliter Kaffee pro Tag, die andere die gleiche Menge Wasser. Nach Kontrolle der Nahrungsaufnahme und der körperlichen Betätigung fanden die Forscher keinen signifikanten Unterschied im Wasserhaushalt der Probanden. „Es gibt keinen Grund, warum koffeinhaltige Getränke nicht auf die tägliche Flüssigkeitsmenge angerechnet werden können“, sagt Maples. „Fünf 250-Milliliter-Tassen Kaffee am Tag sind übertrieben, aber bis zu vier Tassen liegen im gesunden Bereich, sofern man sich an das Koffein gewöhnt hat.“
%%%contend-ad-gesundheit%%%
Tee
Schwarzer und grüner Tee wirken sich ungefähr wie Kaffee auf unseren Wasserhaushalt aus. Sie beinhalten zudem herzschützende Antioxidantien. Beruhigende Kräuter- oder Blütenaufgüsse dagegen sind koffeinfrei. Ihr Geschmack kann Sie dazu anregen, mehr zu trinken. „Vor allem Hibiskus ist vollgepackt mit Antioxidantien und Flavonoiden“, sagt Hemler. Diese enthält er aufgrund der entzündungshemmenden Pigmentmoleküle, die dem Hibiskus seine leuchtend rote Farbe verleihen.
Milch
In einer 2015 im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlichten Studie fanden britische Forscher heraus, dass Kuhmilch (sowohl Vollfett- als auch Magermilch) zu einer höheren Wasseraufnahme führt als einfaches Wasser. Das liegt daran, dass die Verdauung von Kuhmilch länger dauert als die von Wasser, weshalb der Körper mehr Flüssigkeit aufnehmen kann. In der Studie produzierten die Probanden, die Milch tranken, vier Stunden lang weniger Urin als diejenigen, die die gleiche Menge anderer Flüssigkeiten zu sich nahmen. Sie wiesen auch einen höheren Flüssigkeitsgehalt im Blut auf. Milch liefert drei Nährstoffe, welche die meisten von uns in größerer Menge benötigen: Kalium, Vitamin D und Kalzium.
Pflanzendrinks
Die meisten pflanzlichen Alternativen zu Kuhmilch sind umweltfreundlicher als diese und kalorien- sowie cholesterinärmer. Dazu zählen etwa Soja-, Mandel-, Hafer- und Kokosnussdrinks. „Einige Pflanzenmilchen sind mit Kalzium und den Vitaminen A, D und B12 sowie anderen Nährstoffen angereichert, die Kuhmilch enthält“, sagt Hemler. „Den Produkten fehlt es jedoch an Eiweiß.“ Nur Sojadrinks kommen mit sechs Gramm pro Tasse an die acht Gramm von Kuhmilch heran. Die Pflanzendrinks sind sehr wasserhaltig: Mandeldrinks zum Beispiel bestehen zu 97 Prozent aus Wasser, (Kuhmilch zu 87 bis 90 Prozent). Aufgrund der geringen Eiweiß- und Kohlenhydratmengen passieren sie das Verdauungssystem schneller als Kuh-milch und sind mit der Flüssigkeitszufuhr von Wasser vergleichbar.
Sportgetränke
Die in diversen Geschmacksrichtungen erhältlichen Drinks sind häufig reich an Kohlenhydraten. Eine 600-Milliliter-Flasche enthält bis zu 35 Gramm Zucker (acht Teelöffel), es gibt aber auch zuckerarme oder -freie Varianten. Sportgetränke liefern Elektrolyte – Mineralien, welche die Flüssigkeitszufuhr und die Muskelfunktion unterstützen. Sie können bei der Erholung nach intensiver körperlicher Betätigung, die länger als eine Stunde dauert, hilfreich sein. Die Getränke können zudem die Rehydrierung nach schwerem Durchfall oder Erbrechen unterstützen.
Säfte
Laut einer britischen Studie von 2015, bei der die Urinausscheidung von Probanden nach dem Konsum verschiedener Getränke gemessen wurde, führt Orangensaft zu einer etwas besseren Wasseraufnahme als Wasser. Obst- und Gemüsesäfte ohne Zuckerzusatz enthalten neben Vitaminen und Mineralstoffen jedoch hohe Mengen an Fruktose. Diese lässt den Blutzuckerspiegel zwar nicht so stark ansteigen wie Glukose, wirkt sich aber dennoch negativ aus, etwa die der Leber. Säfte sollte man darum am besten im Verhältnis 1:3 mit Wasser mischen.
Kokoswasser
Diese klare, leicht süße Flüssigkeit ist eigentlich ein Fruchtsaft und enthält Elektrolyte, die den Wasserhaushalt unterstützen: Natrium, Magnesium und Kalium. 250 Milliliter enthalten mehr Kalium als eine Banane. Zwar wird Kokoswasser als natürliches Regenerationsgetränk vermarktet, aber eine 2012 im Journal of the International Society of Sports Nutrition veröffentlichte Studie fand zwischen Kokoswasser, Sportgetränken und Wasser keinen signifikanten Unterschied in der Flüssigkeitsaufnahme. Wenn Sie Süßgetränke mögen, kann Kokoswasser mit sechs Gramm Zucker pro 250 Milliliter eine Alternative zu zuckerhaltigeren Sportgetränken sein.
Aloe vera
Das Gel der Aloe-Pflanze ist wegen seiner feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften als Hautsalbe bekannt. Es kann aber auch mit Wasser gemischt werden, um ein erfrischendes Getränk herzustellen. Aloe ist reich an Polyphenolen, einer Art von Antioxidantien. Eine 2016 in der Zeitschrift Nutrients veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass sie helfen kann, den Blutzucker zu kontrollieren. Am besten ist es, in Flaschen abgefüllten Aloe-Saft zu kaufen, da der klebrige Latex im Inneren des Aloe-Blattes zu Magenverstimmungen führen kann, wenn er nicht sorgfältig entfernt wird.
Brühe
Diese wird durch das mehrstündige Kochen von Hühner- oder Rinderknochen und -knorpeln mit Gemüse hergestellt. Dank der aus dem Kollagen gewonnenen Aminosäuren ist sie als beruhigendes Getränk mit entzündungshemmenden Eigenschaften in Mode gekommen. Mit zugesetztem Salz kann sie auch die Elektrolyte wieder auffüllen, und das hilft dem Körper, Flüssigkeit zu speichern. Zu viel Natrium belastet jedoch Gefäße und Herz. „Der empfohlene Grenzwert für die Natriumzufuhr liegt bei 2300 Milligramm pro Tag. 500 Milliliter Knochenbrühe können ein Viertel davon enthalten“, sagt Hemler. Wenn Sie Knochenbrühe kaufen, sind natriumarme Versionen am besten, oder Sie können sie selbst zubereiten und das Salz reduzieren oder weglassen.