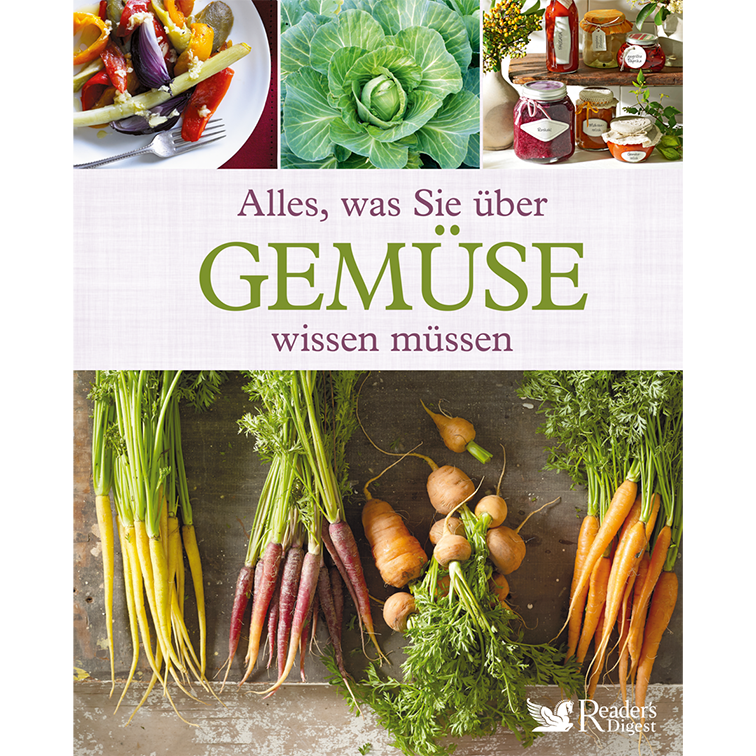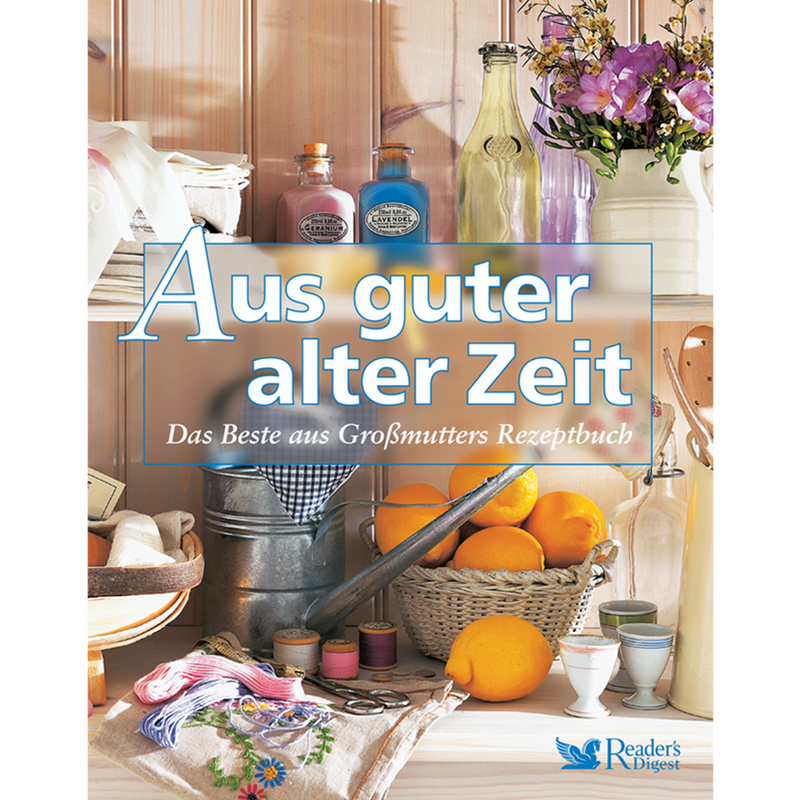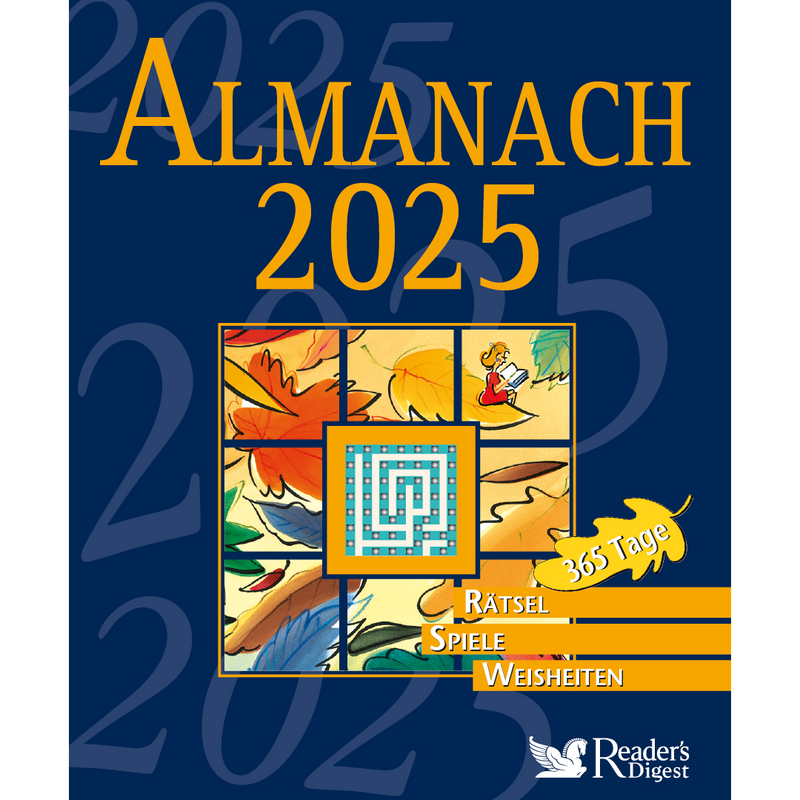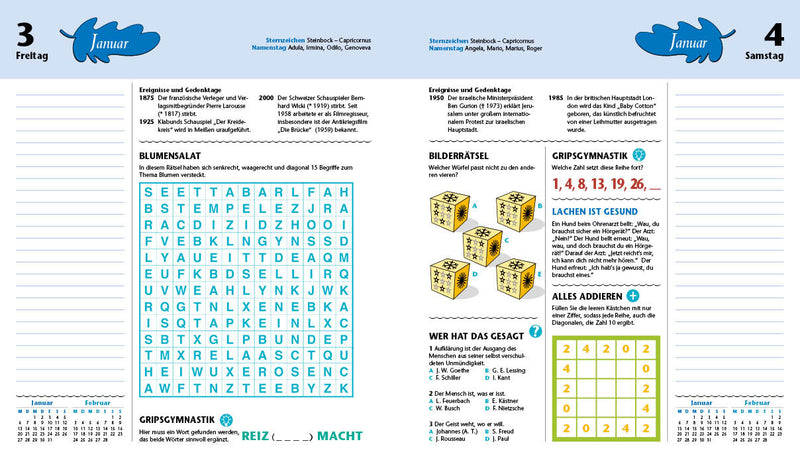Die Geschichte hinter dem Wort, Teil 2
Fremdwörter bereichern die deutsche Sprache seit jeher. Woher sie kommen? Wir erklären Ihnen die Herkunft der gängigsten Fremdwörter.

©
Dass das Deutsche Wörter aus anderen Sprachen übernimmt, hat nichts mit Überfremdung zu tun und ist auch kein Phänomen unserer Zeit. Schon Goethe wusste: „Die Gewalt einer Sprache ist nicht, dass sie das Fremde abweist, sondern dass sie es verschlingt.“
Banause
Heute will niemand ein Banause sein, also ein ungebildeter Mensch ohne Verständnis für die Kunst. Das griechische Wort banausos bedeutete ursprünglich „der am Ofen Arbeitende“, wurde jedoch bald für Handwerker allgemein verwendet. Allerdings: Die antike Gesellschaft blickte auf alle herab, die mit ihrer Hände Arbeit ihr Brot verdienten. Bereits Aristoteles sah in den banausoi die Banausen.
Damast
So nennt sich Stoff mit einem gleichfarbigen eingewebten Muster. Früher wurde er hauptsächlich aus Seide gefertigt. Heute verleiht auch merzerisierte Baumwolle Geweben dieser Art ihren typischen Glanz. Das lateinische damascenus bedeutet „aus Damaskus stammend“. Die syrische Hauptstadt war zur Zeit der Kreuzzüge das Zentrum der orientalischen Seidenherstellung.
Derby
Dieses aus England stammende Wort begann seine Karriere als Pferderennen, bevor es seine Bedeutung generell auf als Wettbewerb ausgetragene Sportereignisse ausdehnte. Benannt ist es nach Edward Smith Stanley, dem 12. Earl of Derby, der 1780 ein Pferderennen für die besten dreijährigen Vollblüter ins Leben rief. Das Derby fand allerdings nicht in Derby, sondern in Epsom in der Grafschaft Surrey statt – wo es noch heute ausgetragen wird.
Eclair
Leckermäulern läuft schon beim Gedanken an dieses Gebäck das Wasser im Mund zusammen. Einer Erklärung zufolge verdankt es seinen Namen seiner Form. Für ein Eclair wird der Teig aufs Backblech gespritzt. Das süße Teilchen ähnelt mit seinen Zacken einem Blitz – und der heißt auf Französisch éclair.
Fiasko
Dieses Wort leitet sich vom italienischen far fiasco ab. Wörtlich übersetzt bedeutet dies „eine Flasche machen“ und steht für einen Misserfolg. Einer – allerdings umstrittenen – Erklärung zufolge stammt die Redewendung aus der Glasbläserei: Gelang es dem Handwerker nicht, das heiße Glas in die gewünschte Form zu blasen, entstand ein eher unansehnlicher Hohlköper aus Glas, eben eine Art Flasche.
Husar
Nur wenige deutsche Wörter stammen aus dem Ungarischen. Der Begriff für ein Mitglied der leichten Kavallerie jedoch tut es. In seiner Heimat ist er enger gefasst, dort bezeichnet der huszar einen Angehörigen der ungarischen Reiterei.
Insekt
Ältere Semester kennen vielleicht noch das Wort Kerbtier für diese Gattung. Es beschreibt ein hervorstechendes Merkmal der so bezeichneten Tiere, auf das sich auch das aus dem Lateinischen stammende Insekt bezieht. Insectum bedeutet nämlich „eingeschnitten“. Besonders gut sind die namensgebenden Einschnitte oder Kerben zwischen Kopf, Brust und Hinterleib bei Ameisen und Wespen zu sehen.
Kiosk
Vielleicht haben Sie diese Ausgabe von Reader’s Digest am Kiosk, also einem Verkaufsstand, erworben? Dass Kiosk früher ein orientalisches Gartenhäuschen oder einen Erker eines orientalischen Palastes bezeichnete, ist heute fast (in Vergessenheit geraten. Die europäischen Herrscher des 18. Jahrhunderts hatten für beides eine Schwäche und ließen fleißig Kioske errichten. Der Begriff geht aufs persische kusk zurück, welches „Galerie, Balkon, Empfangssaal“ bedeutet.
Mansarde
Sowohl das Dachzimmer als auch der ausgebaute Dachstuhl trägt einen französischen Namen – und dies in mehr als einer Hinsicht. François Mansart war ein französischer Architekt, der im 17. Jahrhundert diese Bauform populär gemacht hat.
Picobello
Ist nach der Party wieder aufgeräumt, ist alles picobello. Italienfans erkennen im zweiten Wortteil das italienische bello, also „schön“. Sollten Sie im Land, in dem die Zitronen blühen, etwas als picobello loben, also als ausgezeichnet, werden Sie allerdings auf Unverständnis stoßen. Pico nämlich ist die italienisierte Form von „piekfein“ und existiert im Italienischen nicht.
Provinz
In der Verwaltung bezeichnet dieses Wort ein Gebiet oder einen Landesteil. Oft aber meint, wer Provinz sagt, ein etwas rückständiges Hinterland. Im lateinischen provincia, von dem das Wort stammt, klingen beide Bedeutungen an: Provincia war die „Verwaltung eines unter römischer Oberherrschaft stehenden Landes außerhalb Italiens“.
Tohuwabohu
Im Kinderzimmer herrscht Tohuwabohu, also ein wildes Durcheinander? Egal wie groß sie ist, die Unordnung erreicht keinesfalls die Ausmaße dessen, was dieses hebräische Wort ursprünglich meint. Dort bezeichnet tohu wa-bohu nämlich „das unvorstellbare Chaos am Beginn der Zeit“. Martin Luther machte in seiner Bibelübersetzung übrigens „wüst und leer“ daraus.