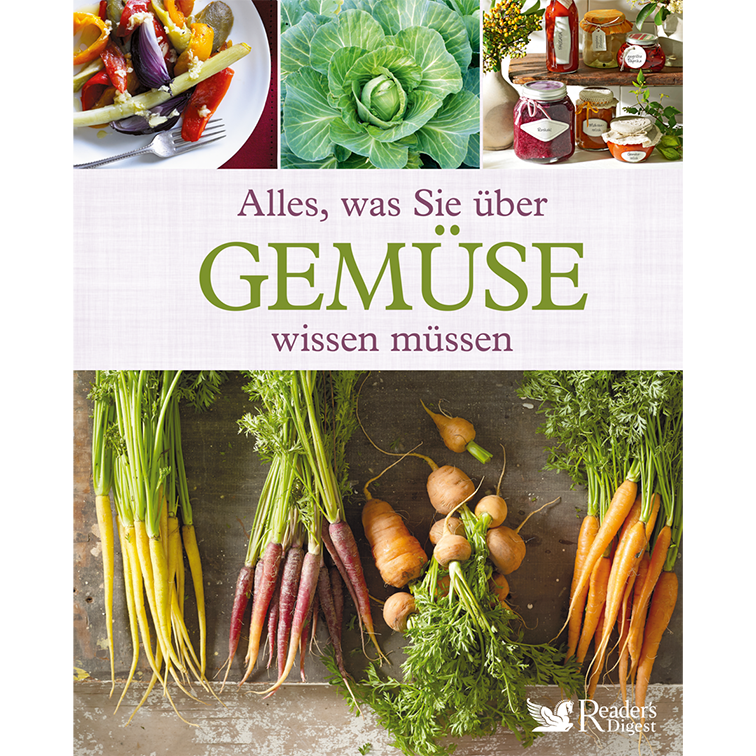Tschüss Wegwerf-Kultur! hier kommt die Reparatur Revolution
Reparieren statt Wegwerfen lautet das Gebot der Stunde. Würde die Welt auf eine Kreislaufwirtschaft umstellen, könnten wir die Menge der Rohstoffe, die wir der Natur entnehmen, um ein Drittel reduzieren.

©
Flora Collingwood-Norris spielte mit ihrem Welpen namens Stitch und trug dabei eines ihrer Lieblingsstücke aus zweiter Hand: einen korallenroten Kaschmirpullover. Stitch, ein schwarzer Pudelmischling, sprang hoch, schnappte nach ihrem Ärmel und riss mit seinen Zähnen mehrere Löcher hinein.
Collingwood-Norris, heute 37, wollte den Pullover nicht entsorgen. „Ich kann es nicht ertragen, schöne Kleidung wegzuwerfen“, erklärt sie. Als Strickwarendesignerin in Galashiels, Schottland, ist sie gewohnt, ihre Pullover selbst anzufertigen. Aber dann beschloss sie, etwas Neues auszuprobieren: das Flicken. Anstatt zu versuchen, die Reparatur möglichst unmerklich zu halten, wandte sie sich dem „sichtbaren Flicken“ zu, einem Trend, der bei Kleidungsstücken unverkennbare Reparaturspuren hinterlässt: Näherinnen und Näher versehen beschädigte Kleidung mit Blumen oder anderen Mustern. „Jedes Mal, wenn man etwas geflickt hat, ist es, als hätte man danach ein neues Kleidungsstück“, sagt Collingwood-Norris. Sie hat sogar damit begonnen, andere Dinge aufzuarbeiten – etwa den Bezug des roten Sofas, auf dem sie während unseres Videointerviews sitzt.
Leider haben die Menschen sich daran gewöhnt, Dinge zu ersetzen, anstatt sie zu instand zu setzen. Weltweit werfen wir jedes Jahr 92 Millionen Tonnen Textilien weg. Ein weiteres wachsendes Problem ist der Elektronikschrott: Schätzungsweise 50 Millionen Tonnen fallen jedes Jahr an. Etwa ein Drittel der Treibhausgasemissionen stammt aus der Herstellung von Waren und Verbrauchsgütern. Laut der niederländischen Nichtregierungsorganisation Circle Economy könnten wir die Menge der Rohstoffe, die wir der Natur entnehmen, um ein Drittel reduzieren, wenn die Welt auf eine Kreislaufwirtschaft umstellt.
Recht auf Reparatur
Während das Flicken von Kleidung eine Fähigkeit ist, die jeder erlernen kann, ist das Reparieren elektronischer Geräte nicht so einfach. Einige Produkte sind sogar so beschaffen, dass dies gar nicht möglich ist. Unternehmen wie Apple und Samsung wurden zu Geldstrafen verurteilt, weil sie Geräte entwickelt haben, die leicht kaputtgehen oder schnell veraltet sind, sodass die Verbraucher gezwungen sind, neue Modelle zu kaufen. Doch eine globale Bewegung für das sogenannte Recht auf Reparatur wehrt sich gegen die Wegwerfkultur. Die Verbraucher wollen in der Lage sein, das, was sie gekauft haben, zu reparieren – um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern und um Geld zu sparen.
Im März 2023 verabschiedete die Europäische Kommission eine Richtlinie zum Recht auf Reparatur, in der unter anderem gefordert wird, dass Unternehmen fünf bis zehn Jahre lang Ersatzteile für ihre jeweiligen Produkte anbieten. In vielen US-Bundesstaaten wurden Gesetze zum Recht auf Reparatur vorgeschlagen, und Australien hat bereits ein Gesetz zur Reparatur von Kraftfahrzeugen verabschiedet.
Online-Anleitungen
Früher reparierten die Menschen viele Dinge selbst oder ließen sie in örtlichen Werkstätten wieder herrichten. Heute ist es oft günstiger, selbst teure Haushaltsgeräte zu ersetzen, als sie instand zu setzen. Das ändert sich nun aber langsam dank online verfügbarer Informationen. Die beliebte Website iFixit.com hat bereits mehr als 100 Millionen Reparaturen ermöglicht. iFixit wurde Anfang der 2000er-Jahre von Kyle Wiens und Luke Soules in den USA gegründet. Nachdem sein Notebook kaputtgegangen war, stellte Wiens fest, dass es keine Reparaturanleitungen gab. Mithilfe seines Klassenkameraden Soules gelang es Wiens, der in seiner Kindheit zusammen mit seinem Großvater Radios und Haushaltsgeräte zerlegt hatte, den Computer wieder zum Laufen zu bringen. Soules und er verfassten ein Anleitung für das Gerät und stellten sie auf die von ihnen eingerichtete Website.
20 Jahre später enthält die Datenbank von iFixit fast 100.000 Reparaturanleitungen. „Wir sehen, dass die Hersteller jetzt Interesse zeigen, den Nutzern die Möglichkeit zu geben, Dinge zu reparieren“, sagt Elizabeth Chamberlain, Direktorin für Nachhaltigkeit bei iFixit. Unternehmen wie Microsoft, Samsung, HP, Patagonia und The North Face verkaufen Ersatzteile und stellen über iFixit Reparaturanleitungen zur Verfügung.
Repair Cafés
Das erste sogenannte Repair Café, in dem Freiwillige anderen helfen, wurde 2009 in Amsterdam, Niederlande, eröffnet. Inzwischen gibt es weltweit mehr als 2700 Standorte des Netzwerks (www.repaircafe.org/de). Die Organisatoren richten Veranstaltungen an Orten wie Bibliotheken und Gemeindezentren aus. Dorthin bringen Menschen mit Reparaturkenntnissen ihre Werkzeuge und anderes Equipment wie 3-D-Drucker oder Nähmaschinen mit und versuchen, kostenlos alles wieder funktionstüchtig zu machen. Und sie zeigen den Besuchern, wie diese manches selbst reparieren können.
„Es ist eine gesellige Veranstaltung mit Gesprächen über das, was repariert wird, und über die ganze Idee der Reparatur“, sagt Paul Magder, Mitgründer eines Repair Cafés in Toronto, Kanada. Er ist der Meinung, dass der Gemeinschaftssinn eine große Anziehungskraft ausübt, und hat beobachtet, dass die Nachfrage stetig zunimmt. Allerdings mangelt es an Reparaturkundigen im Alter zwischen 20 und 40 Jahren. „Reparieren erfordert Fähigkeiten, die jüngere Menschen nicht haben, einfach weil es ihnen an Erfahrung fehlt“, sagt Christophe Gatt, Präsident der Repair Cafés Paris. „Deshalb versuchen wir, unser Wissen zu teilen.“ Ende 2022 startete die Gruppe das erste Repair Café für Kinder ab fünf Jahren. „Wenn wir verstehen, wie etwas funktioniert, nutzen wir es auch besser und verantwortungsvoller“, sagt Gatt.
Reparierbare Handys
Mobiltelefone gehören zu den am häufigsten weggeworfenen elektronischen Geräten. Deshalb versuchte Fairphone ab 2013, die Branche zu revolutionieren. Das niederländische Unternehmen wollte zeigen, dass es möglich ist, ein Smartphone zu produzieren, das instandgesetzt werden kann.
Heute ist das Fairphone in den meisten europäischen Ländern erhältlich. Die Kunden können ihre Telefone mit Ersatzteilen wie Kameras, Batterien und Lautsprechern, die sie direkt über das Unternehmen beziehen, selbst reparieren. Das einzige benötigte Werkzeug ist ein kleiner Präzisionsschraubendreher, wie er für die Wartung von Brillen oder Uhren verwendet wird.
Einige größere Unternehmen folgen nun dem Beispiel von Fairphone: Im März brachte das finnische Telekommunikationsunternehmen Nokia ein Smartphone auf den Markt, das so konzipiert ist, dass es leicht wieder funktionsfähig gemacht werden kann. Da die Telefone zerlegbar sind, sind sie leichter zu recyceln.
Vergangenes Jahr führte auch Apple Reparaturmöglichkeiten ein. Kunden können online Werkzeuge leihen oder kaufen, Handbücher herunterladen und die benötigten Ersatzteile bestellen, sei es ein neuer Bildschirm, eine neue Batterie oder ein neues Kameramodul.
Um die Instandsetzung zu erleichtern, sind neuere Geräte wie das iPhone 14 so aufgebaut, dass sie sich leichter öffnen lassen als frühere Modelle. Nach der Verabschiedung der EU-Richtlinie über das Recht auf Reparaturen wird auch vorgeschrieben, dass Akkus einfach zu entfernen und zu ersetzen sind.
Nachhaltige Mode
Vor einigen Jahrzehnten begannen Bekleidungshersteller damit, Verbraucherinnen und Verbraucher mit billiger Kleidung dazu zu verlocken, häufiger und mehr zu kaufen. Sie versuchten immer schneller wechselnde Trends zu schaffen – Stichwort „Fast Fashion“. Für die Umwelt war dies katastrophal: Drei Fünftel aller Kleidungsstücke landen innerhalb eines Jahres nach ihrer Herstellung auf einer Mülldeponie. Außerdem wird bei der Produktion von Kleidung viel Wasser verbraucht – für die Herstellung einer Jeans beispielsweise werden 7500 Liter benötigt. Die Antwort darauf heißt „Slow Fashion“, also hochwertige, handgefertigte und lokal hergestellte Kleidung. Zudem entscheiden sich immer mehr Menschen dafür, gebrauchte Kleidung über soziale Medien oder in Secondhandläden zu kaufen.
Und wie Flora Collingwood-Norris flicken die Menschen zunehmend ihre Kleidung. Den korallenroten Pullover, den ihr Hund Stitch zerrissen hatte, versah sie mit bunten Punkten, die Ellbogenpartien bedeckte sie mit kreisförmigen Sonnenuntergängen und fliegenden Vogelsilhouetten. Der Pullover ist inzwischen Teil einer Ausstellung in einem Museum in Devon, Großbritannien, das die Wiederherstellung von Kleidung im Laufe der Geschichte bis zur Gegenwart zeigt.
Collingwood-Norris bietet mittlerweile Online-Flickkurse für Menschen auf der ganzen Welt an. Außerdem gibt sie Ratschläge an ihre Instagram-Follower und veröffentlichte 2021 das Buch Visible Creative Mending for Knitwear (etwa: Sichtbares kreatives Ausbessern von Strickwaren). Die Britin ist froh, dass das Reparieren wieder populär wird. „Es hat ein paar Generationen übersprungen, aber es ist wirklich aufregend zu sehen, dass es wieder kommt“, sagt sie. „Es stimmt mich optimistisch für die Zukunft, dass es eine Bereitschaft gibt, Gewohnheiten zu ändern und neu zu bewerten.“